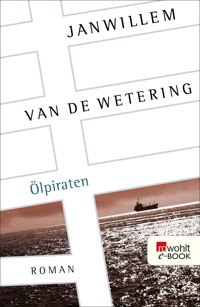4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Amsterdam-Polizisten
- Sprache: Deutsch
Straßenkrieger: Ein skurriler Fall für den Commissaris in New York Im Central Park wird die Leiche eines holländischen Versandbuchhändlers gefunden. Die New Yorker Polizei geht von einem natürlichen Tod aus, doch Johan Termeer, der Neffe des Toten, vermutet ein Verbrechen. Er bittet den Commissaris um Hilfe, der während eines internationalen Polizeikongresses in der Metropole eigene Nachforschungen anstellt. Schon bald findet er viele Spuren, die ins Nichts führen, und steht vor einem hochphilosophischen Rätsel. Janwillem van de Wetering, der selbst mitten in den einsamen Wäldern Maines lebt, schreibt Kriminalromane als philosophische Traktate. In Straßenkrieger müssen seine Helden Grijpstra und de Gier selbst über Gut und Böse nachdenken und ihren Weg finden. Mit feinem Humor und spielerischer Leichtigkeit gelingt es van de Wetering, seine metaphysischen Ideen mit den Strukturen des Krimigenres in Einklang zu bringen. Tauchen Sie ein in die skurrile Welt des Commissaris und seiner Amsterdamer Kollegen, die in New York auf Verbrecherjagd gehen. Straßenkrieger ist ein ungewöhnlicher Kriminalroman, der zum Nachdenken anregt und mit schwarzem Humor unterhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Janwillem van de Wetering
Straßenkrieger
Roman
Aus dem Englischen von Hildegard Höhr und Theo Kierdorf
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Eins
«Ja», sagte der Mann, dessen Namen der Commissaris nicht genau verstanden hatte, «es geht um meinen Onkel. Der ist tot, ermordet. Und darum, dass ich bei der freiwilligen Polizei diene, schon seit Jahren, für die Königin, und auch für Sie. Und dass so etwas einfach so passieren kann in New York. Das ist doch schrecklich, finden Sie nicht auch, Herr Commissaris?»
Der Commissaris, Leiter der Amsterdamer Kriminalpolizei, seufzte. Da dieser Mann namens Johan Termeer (er hatte seinen Namen noch einmal gesagt) seine Aufzählung mit einem Fragezeichen beendet hatte, erwartete er offenbar eine Antwort von ihm. Der Commissaris hätte natürlich einfach zustimmen können, dass es in der Tat schrecklich sei und dass alles immer schlimmer würde. Der Onkel geht in aller Seelenruhe in einem Park spazieren, dazu auch noch im Central Park in New York, der reichsten Stadt des mächtigsten Landes der Welt, … Gott stehe uns bei! – Sonntagmorgen – die Sonne scheint – Kinder spielen – Musik – Ballons – und dann stirbt der gute alte Mann zwischen den Azaleenbüschen, und keiner weiß warum. Das ist doch furchtbar! Niemand weiß genau, woran er gestorben ist. Kein Zeuge weit und breit. Und als man am nächsten Tag seine sterblichen Überreste findet, ist der ganze untere Teil des Torsos von Tieren oder Vögeln oder wer weiß von wem weggefressen worden. Die Leiche von Onkel Bert, dem einzigen Verwandten auf der Welt, in einem verdammten Park. Ohne Kleider, ausgeraubt, zerstückelt. Zwei abgetrennte Beine und nur der obere Teil vom restlichen Körper. Der geliebte Onkel röchelt ein letztes Mal, während in der Nähe auf der frisch gemähten Wiese die «Park Stompers» spielen.
Johan Termeer pfiff – gar nicht mal so schlecht – «When the Saints Go Marching In».
Der Commissaris runzelte die Stirn. «Und die Polizei?»
«Das New York Police Department?», fragte der Neffe. Nun, das NYPD ignorierte die Geschichte einfach. Sie legten die ganze Sache, den Mord oder Totschlag, mit dem Vermerk «Herzanfall» zu den Akten.
«Wenn man dann selbst bei der Polizei ist – na ja, nur in der Reserve, als unbezahlter Freiwilliger, aber immerhin, das ist ja schließlich auch ein Teil der Polizei – aber nützt einem das irgendetwas? Vor allem, wenn man so weit von zu Hause weg ist?»
Es hatte eine Weile gedauert, bis man ihn überhaupt darüber informiert hatte, dass Onkel Bert tot war. Er hatte es erst am nächsten Tag in aller Frühe erfahren. Wegen der sechsstündigen Zeitverschiebung und weil der Nachbar des Onkels, Charlie, nicht gleich darauf gekommen war, den einzigen noch lebenden Verwandten darüber zu informieren, dass Bert Termeer nicht mehr unter den Lebenden weilte. Okay, dieser Verwandte lebte auf der anderen Seite des Ozeans, aber du meine Güte, heutzutage, bei den modernen Telefonverbindungen, Satelliten und Anrufbeantwortern war es ja wohl keine große Sache mehr, mit jemandem in Übersee Kontakt aufzunehmen.
«Oder?»
Der Commissaris runzelte erneut die Stirn, um zu bestätigen, dass die Gedankenlosigkeit der Leute wirklich abscheulich sei.
Was machte man also in einem solchen Fall? Man vertraute seinen eleganten Haarpflegesalon in Amsterdams luxuriösem Vorort Buitenveldert seinem Partner Peter an. Dann flog man mit dem nächsten KLM-Flug selbst nach New York, suchte die Polizeiwache am Central Park auf und sprach dort mit dem diensthabenden Beamten – oder besser gesagt, man versuchte mit ihm zu sprechen; das Englisch ließ zu wünschen übrig.
Und geschah dann irgendetwas?
Nichts geschah!
Man bekam zu hören, es sei ein Unfall gewesen. Onkel Bert sei während eines Spaziergangs im Central Park von einem herabfallenden Ast oder sonst was getroffen worden, von einem Ball, einem Felsbrocken, mitten auf die Brust. Daran sei er zwar noch nicht gestorben, dafür aber an dem darauf folgenden Herzanfall. Ein Schock oder so etwas Ähnliches. Das war jedenfalls die Meinung des Herrn Parkpolizisten gewesen.
Lieber Himmel!
Was blieb einem da anderes übrig, als wieder nach Hause zu fliegen. Und in der 707 machte man sich dann so seine Gedanken.
Man war doch schließlich selbst bei der Polizei, und Amerika und die Niederlande waren befreundete Länder. Die Polizei hatte doch internationale Verbindungen, wegen Drogenhandel, Wirtschaftsverbrechen und Ähnlichem. Da musste es doch wohl möglich sein, für Aufklärung zu sorgen.
Wenn man sich nun an den höchsten erreichbaren Vorgesetzten wenden würde – Erreichbarkeit war natürlich ein entscheidender Faktor – wenn man hinginge und mit diesem Halbgott einmal unter vier Augen reden würde?
Und das hatte Adjudant[1] Grijpstra schließlich ermöglicht, ein Profi, ein guter Mann, bei dem man ein Jahr lang in der Abendschule gesessen und für das Polizeidiplom gebüffelt hatte.
Durch Vermittlung von «Adjudant Stahlbürste» – so war Grijpstra in der Schule wegen seines silbergrauen, kurzgeschorenen Haars genannt worden – war es einem gelungen, in das große, antik eingerichtete Refugium des Chefs des Morddezernats vorzudringen. Und da saß nun der «Kleine alte Herr», wie er von den Kollegen liebevoll genannt wurde, und forderte einen auf, sein Anliegen vorzutragen.
Und das tat man dann.
«Ja», bemerkte der Commissaris. Er versuchte, das spärliche Sonnenlicht zu genießen, das den Perserteppich zwischen ihm und Johan Termeer in ein geheimnisvolles Licht tauchte, vor allem an den Stellen, wo die orangefarbenen Muster den roten Rand fast berührten. Lieber hätte er sich hinter seinem mit Schnitzereien verzierten Schreibtisch verschanzt. Aber das ging nicht, da der Besucher selbst bei der Polizei und nicht einfach nur irgendein lästiger Bürger war.
Ein solches Treffen zwischen Kollegen, so musste man es nennen – und dem stimmte er zu –, sollte in einer offenen Gesprächsatmosphäre stattfinden; deshalb saß er seinem Besucher unmittelbar gegenüber. Gastgeber und Gast saßen jeweils in einem dicken Ledersessel, nur durch ein aus Ebenholz geschnitztes antikes chinesisches Kaffeetischchen voneinander getrennt. Das gute Stück stammte noch aus der Kolonialzeit; es war eine Leihgabe des niederländischen Instituts für nationalen Kunstbesitz in Den Haag.
Der Commissaris bot seinem Gast Verkade-Plätzchen und Douwe-Egberts-Kaffee an – eine Behandlung der Sonderklasse. Hoffentlich wusste der Besucher das zu würdigen.
Man sollte für die Sorgen Untergebener stets ein offenes Ohr haben, das galt auch für die niedrigeren Ränge, versuchte er sich einzureden. Ein höherer Polizeibeamter sollte sich immer so verhalten, wie «es einem guten Familienvater anstünde».
Eigentlich, dachte er bei sich, hatte er keine Zeit für solchen Unsinn. Er musste nach Hause, zum Koninginneweg, wo seine Frau Katrien mit dem Mittagessen auf ihn wartete. Sie würde es im Garten servieren: wahrscheinlich dünn mit Roastbeef belegte Schnittchen und eine Tasse Hühnersuppe. In seinem Alter war Hühnersuppe eine Wohltat, Balsam für seine schmerzenden Knochen. Früher war er nie zum Mittagessen nach Hause gegangen, aber jetzt, wo seine Pensionierung näher rückte, erlaubte er sich solche Verschnaufpausen. Nur noch ein paar Monate, dann war alles überstanden.
Commissaris der Amsterdamer Polizei, Leiter der Abteilung Schwerverbrechen, der viel gepriesene Chef des berühmten Morddezernats. Das klang gut, aber mehr auch nicht. Im Grunde war er nichts weiter als ein schmächtiger alter Herr in einem aus der Mode gekommenen Anzug. Er hatte ihn vor fünfzehn Jahren für viel Geld in der Van Baerle Straat gekauft, in einem jener Läden, in denen sich das Personal noch vor dem Kunden verneigte, wenn es nicht gar katzbuckelte. – Ob heute überhaupt noch jemand wusste, was Katzbuckeln war?
Heute arbeitete in den Herrenbekleidungsgeschäften nur noch jene Art von Old Boys, die einem, wenn man nicht aufpasste, jovial auf die Schulter klopften oder gar in den Po kniffen.
«Commissaris?»
Er schreckte aus seinen Gedanken hoch.
«Ja, mein Junge?»
«Dürfte ich Sie um Ihre Meinung zu dieser ganzen Angelegenheit bitten?»
«Am vergangenen Sonntag», sagte der Commissaris zusammenfassend, nachdem Reserve-Hoofdagent Termeer ihm zu verstehen gegeben hatte, er wolle mit «Jo» angesprochen werden, «fand man deinen Onkel Bert Termeer im Central Park tot auf. Der Nachbar deines Onkels, Charlie, rief dich an, um dir mitzuteilen, dass ‹etwas Schlimmes passiert sei›. Als du hörtest, dein Onkel sei im Park an einem Herzanfall gestorben, kam dir die Sache merkwürdig vor, und du nahmst das nächste Flugzeug zum Kennedy Airport …»
Der Commissaris nickte wohlwollend. Sein einladendes Lächeln entblößte lange gelbliche Mäusezähnchen. «Ist das richtig?»
«Genau so war es, Mijnheer.»
«Dein Englisch ist so gut, dass du Charlies Nachricht verstehen konntest?»
«Sömsing bet heppent, Önkel det», sagte Jo Termeer mit bestem Amsterdamer Akzent. «Ich sehe mir viele amerikanische Filme an. Det heißt ‹alles vorbei›.»
«Ja», sagte der Commissaris. «Nachbar Charlie hatte also deine Telefonnummer?»
«Er hatte sie in Onkel Berts Schreibtisch gefunden», sagte Jo Termeer, dem offenbar plötzlich wieder eingefallen war, dass er als Polizist möglichst genau zu berichten hatte. «Onkel Bert hat seinen Arbeitsraum und seine Wohnung von Charlie gemietet. Charlie war der Vermieter und Nachbar des Onkels. Er hatte einen Schlüssel von Onkel Berts Wohnung. Außer den beiden wohnte niemand in dem riesigen Gebäude. Sie waren aufeinander angewiesen. Onkel Bert hatte einen Buchversand, und Charlie half ihm manchmal dabei. Das Gebäude liegt in der Watts Street, Tribeca, New York City.»
«Sie wohnten nicht zusammen?»
Termeer schüttelte den Kopf. «Charlie wohnt in der obersten Etage. Mein Onkel hatte die restlichen Räume gemietet. Getrennte Haushalte.»
Der Commissaris änderte seine Taktik. Er wollte seinen Gesprächspartner genauer kennenlernen. «Du hast das nächste Flugzeug genommen. Teuer?»
Das Ticket war ziemlich billig gewesen, obwohl Jo so kurzfristig gebucht hatte. Man musste nur die richtigen Freunde haben.
«Freunde?»
Termeer meinte Marilijn, das Mädchen vom Reisebüro. Wenn man sich mit Marilijn gut stand, war Reisen spottbillig. Er und Peter kannten sie.
«Eine Freundin?»
«Geschäftlich. Mein Partner Peter schneidet ihr immer gratis die Haare.»
Marilijn hatte ihm auch ein Hotelzimmer in New York besorgt; zwar eines mit Aussicht auf den Luftschacht, aber sechzig Dollar, was wollte man mehr?
«Einen Augenblick», sagte der Commissaris. Das rote Lämpchen an dem Aufnahmegerät, das zwischen Zuckerdose und Milchkännchen stand, leuchtete nicht mehr. Er wechselte die Batterien. «Weiter, mein Junge. Was hast du nach deiner Ankunft gemacht?»
«In New York bin ich gleich zu der Polizeiwache gegangen, die den Fall bearbeitete. Zuerst habe ich den diensthabenden Polizisten befragt, dann einen Detective Sergeant, einen gewissen Hurrell. Hurrell wusste zwar von der Geschichte, wollte sich aber nicht näher dazu äußern.»
Jo knurrte. «Verdammtes Arschloch.»
Er erschrak über seine eigene Ausdrucksweise.
«Entschuldigen Sie, Mijnheer.»
Er errötete, während er am Commissaris vorbei in die Luft starrte.
Jos Züge waren makellos, dachte der Commissaris. Termeer hätte als Schauspieler in Werbespots mitwirken können. Ein Held. Der Typ von Autofahrer, der an der Kreuzung anhält, um eine alte Frau über die Straße gehen zu lassen. Der ehrliche Finder. Das Model in der Zeitung, das seine Zähne mit der neuesten Zahnpastamarke putzt.
Gerade Nase, energischer Mund, gleichmäßig gerundetes Kinn. Die großen wasserblauen Augen wären wahrscheinlich klarer gewesen, wenn nicht Kummer oder vielleicht auch Frustration sie getrübt hätten. Möglicherweise war er auch einfach nur schüchtern, weil er als Reservepolizist in die geheiligten Gefilde des Präsidiums vorgedrungen war. Oder ihm war ganz einfach sein vulgärer Ausrutscher peinlich.
«Wirst du von Onkel Bert erben?», erkundigte sich der Commissaris in beiläufig-freundlichem Ton.
Termeer zuckte mit den Schultern. «Ich bin der einzige Verwandte, aber ich brauche kein Geld. Peter und ich sind die Eigentümer unseres Geschäfts. Das wirft gutes Geld ab.»
«Steuerfrei meinst du?»
Termeer zwinkerte ihm zu. «Genau, Mijnheer. Früher haben Peter und ich die Partei der Arbeit gewählt, aber die verschenken doch nur die Steuergelder an diejenigen, die von Arbeit gar nichts wissen wollen!»
«Du meinst die Arbeitslosen?»
«Kennen Sie das große Schild an der Obdachlosensiedlung am Ostzubringer?», fragte Termeer. Er war offenbar besorgt, der Commissaris könnte ihn missverstehen. «Haben Sie dieses Schild jemals auf dem Heimweg gelesen, Mijnheer? Nachdem Sie selbst den ganzen Tag gearbeitet hatten?»
Der Commissaris kannte das Schild nur zu gut. Die Bewohner der Obdachlosensiedlung hatten es aufgestellt.
«HALLO, IHR TROTTEL!», stand darauf. «HABT IHR HEUTE SCHÖN GEARBEITET?»
Sechzig Prozent der Amsterdamer Bevölkerung bezogen Arbeitslosenunterstützung.
«Sie sind doch wohl kein Sozialist, Mijnheer?», fragte Termeer.
Der Commissaris rief sich selbst zur Ordnung. Zur Sache. Es ging um diesen toten Onkel. Lag hier eine ernstzunehmende Beschwerde vor?
«Und welche Partei wählst du, Jo?»
«Ich wähle nicht, Mijnheer.»
«Die Hoffnung aufgegeben?»
«Seit dem Jahre null.» Termeer erklärte, was er damit meinte. In dem Jahr, in dem ihm klar geworden war, dass die ständig zunehmende Bevölkerung die Oberfläche des Planeten kahl schlagen würde, begann er seine Einstellung grundsätzlich zu revidieren. Ihm war plötzlich die Erkenntnis gekommen, dass «es niemals mehr besser werden würde», dass «Hoffnung nur zu Enttäuschung führe». Das hatte er von Peter. Peter war weiser als er. Das waren Naturmenschen immer. Als Peter einmal in seine Heimat, die frühere südamerikanische Kolonie Surinam, gereist war, hatte er mit eigenen Augen gesehen, wie dort der Regenwald abgeholzt wurde, um die Bedürfnisse einer ungehemmt wachsenden Bevölkerung zu befriedigen.
«Gib alle Hoffnung auf», sagte der weise Naturmensch Peter manchmal, «und genieße, was noch übrig ist. Übe dich im Abgeklärtsein.»
Der Commissaris lächelte.
Das schien Jo zu verletzen. «Sind Sie anderer Meinung?»
«Mein lieber Junge», setzte der Commissaris an, «wie steht es denn mit deinem Wunsch nach Gerechtigkeit? Ist das etwa Abgeklärtsein? Bist du nicht hierher gekommen, um den Mord an deinem Onkel zu rächen?»
Termeer schüttelte betrübt den Kopf.
Der frei schweifende Geist, der von eigennützigen Begierden heruntergezogen wird. Er versuchte, diese Einsicht in Worte zu fassen.
«Ist das auch eine von diesen Naturvölker-Weisheiten? Zitierst du deinen Partner Peter?»
Er meinte, wenn zwei Männer zusammenlebten, so springe der Funke der Intuition manchmal über. «Meinen Sie nicht auch, Mijnheer?»
Der Commissaris dachte über sein Zusammenleben mit Katrien und mit Schulze, der Schildkröte, nach. Er nickte. «Du und Peter, ihr lebt zusammen?»
«Über dem Geschäft. In Buitenveldert in einem großen Apartment. Die Hypothek ist bereits abbezahlt.»
«Homosexuell?»
«Ja, Mijnheer», sagte Termeer ohne Scheu.
«In Ordnung», sagte der Commissaris.
Homosexualität brauchte man heutzutage nicht mehr zu verbergen; nicht einmal seine eigene Generation, die nun das Pensionsalter erreichte, tat das. Aber die Polizei war nun einmal besonders konservativ. Überholte Einstellungen hielten sich bei ihr lange. Und in der freiwilligen Polizei saßen die reaktionärsten Typen. Die Kandidaten für die Polizeireserve mussten eine Überprüfung über sich ergehen lassen. Homosexuelle wurden, sofern sie ihre sexuelle Präferenz erwähnten, nicht zugelassen, nicht wegen ihrer Homosexualität, sondern aus anderen Gründen. Im Prüfungskomitee saßen alte pensionierte Polizeioffiziere, also der gleiche alte Schrott, zu dem er – der Commissaris blickte grimmig drein – bald selbst gehören würde … konservativ und senil …
«Zähe alte Böcke», murmelte er leise.
«Wie bitte?», fragte Termeer.
Nichts, er habe nur so vor sich hin sinniert. So eine Überprüfung von Anwärtern für die freiwillige Polizeireserve war im Grunde ziemlich harmlos. Kaffee, Zigaretten, ein paar Worte zur Begrüßung. Die Bewerber wurden einzeln vor die Kommission gebeten. Der Oberbock fragte, warum der Kandidat sich berufen fühle, in seiner Freizeit zu «dienen und zu beschützen», und das auch noch unbezahlt.
Ob er irgendwelche faschistischen Neigungen hätte?
Machtgelüste? Das Bedürfnis, Prostituierte zu verhaften und im Streifenwagen zu befummeln?
Nein?
Dann sei ja alles bestens.
«Verehrte Kommissionsmitglieder! Als Vorsitzender schlage ich vor, diesen Bewerber zur Polizeischule zuzulassen, zur Abendschule, denn er muss ja tagsüber seinem Beruf nachgehen.
Ich meine, bringt ihm bei, wie man mit einer Handfeuerwaffe umgeht, steckt ihn in eine Uniform, und lasst ihn alle Examen bestehen.
Wenn er alle Hürden nimmt, darf er sich eine Polizeinadel an die Brust stecken. Er darf bei den Fußballspielen im Olympiastadion aufpassen. Er darf dafür sorgen, dass niemand mit Bananen auf nichtweiße Spieler der gewinnenden gegnerischen Mannschaft wirft. Er hat das ‹Gashahn›-Zischen zu unterbinden, wenn Spieler der gegnerischen Mannschaft, die dem jüdischen Glauben angehören, Tore schießen. Er darf am Nikolaustag am Straßenrand stehen und darauf aufpassen, dass die kleinen Kinder nicht unter die Hufe der Pferde geraten, und außerdem darf er dafür sorgen, dass niemand mit Pfeffernüssen auf das Gemächte des heiligen Mannes zielt.
Haha. Ja, auf Wiedersehn, Sie dürfen gehen. Man hat Sie aufgenommen. Ein echter Patriot, mit besonders großem P für Pups. Wir danken Ihnen, dass Sie dem Staat dienen wollen. Sagen Sie bitte dem nächsten Idioten, er soll hereinkommen, sind Sie so nett?»
Der Commissaris glaubte nicht, dass die Reservisten-Zulassungskommission ausgesprochen feminin wirkende Typen akzeptieren würde, Männer mit Ohrringen und ausgefallener Kleidung, aber dieser Johan Termeer hatte nichts von alldem an sich.
Der Commissaris hatte persönlich nichts gegen Homosexuelle. Allerdings hatte er auch nichts für sie übrig. «So wie man Goldfische mag», hatte er einmal bei einem Gläschen gesagt, um ein paar hoch gestellte Kollegen zu beeindrucken. Katrien war nicht beeindruckt gewesen. Sie hatte es für geschmacklos gehalten. Und zu Recht, dachte der Commissaris bei sich.
«Ja, also, Termeer. Dieser, ähhh, Peter, von dem du gerade gesprochen hast, ihr lebt zusammen? Schon länger, nehme ich an.»
«Seit zwölf Jahren.» Termeer richtete sich auf, als ob er allen Anlass hätte, stolz darauf zu sein.
Der Commissaris stellte fest, dass der Beschwerdeführer nicht nur gut, sondern auch sehr gepflegt aussah: Hose aus gebleichtem Leinen, Sportjackett aus braunem Tweed, cremefarbenes Baumwollhemd, Seidenkrawatte mit Batikmuster. Er trug Stiefel aus Velourleder, das sorgfältig aufgebürstet war.
«Erwartest du ein nennenswertes Erbe?», fragte der Commissaris. «Onkel Bert war Besitzer eines Buchversands?»
Termeer zuckte mit den Schultern. «Geld, aber das brauche ich nicht. Ich komme gut zurecht.»
«Erzähl mir von diesem Versandhandel.»
«Er verkaufte Bücher», sagte Termeer. «Dazu stellte er einen Katalog zusammen. Spirituelle Literatur, antiquarisch. Er kaufte die Bücher in Antiquariaten in ganz Amerika, nahm sie in seinen Katalog auf und verschickte diesen an Interessenten.»
«Ein großes Unternehmen?», fragte der Commissaris.
Termeer neigte seinen Kopf leicht zur Seite. «Eine beachtliche Liste, und er bot die Bücher gewöhnlich zum Dreifachen seines Einkaufspreises an. Aber natürlich hatte er Kosten.» Termeers Kopf senkte sich. «Vielleicht auch Schulden. Ungedeckte Schecks.»
Der Commissaris dachte an seinen verstorbenen Bruder Therus. Therus hatte einen Versandhandel für Autozubehör gehabt. Ein profitables Unternehmen. Therus war mit sechzig in seinem nagelneuen silbergrauen Mercedes-Sportwagen gestorben, während er in der Nähe des schicken Vororts Laren hupend, fluchend und mit geballten Fäusten in einem Stau festsaß. Therus hatte sein Geld in Gesellschaft jugendlicher Begleiterinnen auf Schweizer Berggipfeln ausgegeben.
«War dein Onkel profitgierig?»
Das glaubte Jo nicht.
«War er kinderlos?»
«Er war nie verheiratet», sagte Termeer.
«Auch homosexuell?»
«Früher war er hier in Amsterdam mit seiner Zimmerwirtin befreundet, mit Carolien.»
«Und er hatte Räume in einem New Yorker Gebäude gemietet?»
«In der Watts Street. Ein dreistöckiges Haus mit einem geräumigen Kellergeschoss. Das Gebäude liegt in Tribeca, unten in Manhattan, in der Nähe des Hudson. In dem Gebäude wurde früher Kaviar abgefüllt. Charlie lebt im obersten Stock, mein Onkel hatte den Keller und die unteren beiden Stockwerke. Riesige Räume, wirklich riesig. Im Keller hatte er die Bücher gelagert.»
Charlie hatte ihm manchmal im Buchversand ausgeholfen, Daten in den Computer eingegeben und Bestellungen fertig gemacht. Das Gebäude in der Watts Street wirkte zwar von außen völlig heruntergekommen, und der Aufzug ähnelte einem Raubtierkäfig, aber die Wohn- und Arbeitsräume selbst waren in sehr gutem Zustand.
«Hast du deinen Onkel hin und wieder besucht?»
«Einmal», sagte Termeer. «Vor langer Zeit bin ich einmal mit einer Reisegruppe nach New York geflogen, mit Stadtführung, so wie die Japaner es hier in Amsterdam machen, mit einem Führer an der Spitze und einem Führer am Ende, und alle schwenken bunte Plastiktulpen. Man muss sich schon sehr große Mühe geben, dabei verloren zu gehen. Wir haben Brücken und Museen besichtigt. Wir hatten einen freien Nachmittag, da habe ich Onkel Bertus besucht. Und jetzt war ich wieder da, wegen des Todesfalls.» Termeer nickte und seufzte. Er wiederholte das Wort in seinem speziellen Englisch: «Det.»
Der Commissaris öffnete die Dose mit den Verkade-Plätzchen. Grijpstra und sein Assistent, de Gier, waren bereits darüber hergefallen. Die Plätzchen mit der Mokkaglasur und die Löffelbiskuits, seine Lieblingsplätzchen, fehlten.
Er hielt seinem Gast die Dose hin. «Vielleicht ein Sans-pareil?»
Termeer dankte und nahm das angebotene Plätzchen.
«Grijpstra hat dieses Gespräch arrangiert», sagte der Commissaris. «Kennst du Grijpstra gut?»
«Den kennt wohl jeder bei der Reserve», antwortete Termeer. «Meister Stahlbürste war auf der Polizeischule mein Lehrer. Er hat uns beigebracht, wie man Protokolle schreibt, wann man einen Bürger festnehmen darf und wann nicht. Wir haben viel Spaß zusammen gehabt, aber trotzdem ließ er uns nichts durchgehen. Außerdem ist er ein Idealist.» Termeer wurde plötzlich sehr ernst. Offenbar war er innerlich bewegt. «Er hat uns beigebracht, die Bürger zu achten und diesen Trotteln zu dienen.»
«Zitierst du Grijpstra?»
«Diese Trottel von Bürgern bringen sich ständig selbst in Schwierigkeiten.» Termeer imitierte überzeugend Grijpstras brummige Stimme. «Und sie stellen uns ein, damit wir sie wieder aus der Scheiße holen können.»
Ja, dachte der Commissaris, und wie steht es mit Grijpstra? Vater von zu vielen Kindern, die jetzt größtenteils von der Wohlfahrt lebten. Von seiner Ehefrau entfremdet. Im Augenblick mit einer ehemaligen Prostituierten verlobt, die ehrgeizige Pläne hatte. Der Commissaris hustete. Zur Sache. Dieser Termeer schien ein anständiger Kerl zu sein, verantwortungsbewusst und nicht ohne Humor.
Aber Äußerlichkeiten können täuschen.
Es wurde Zeit, sich näher mit den Hintergründen der Angelegenheit zu befassen. Dabei war ein etwas vertraulicherer Ton von Nutzen. «Mein Junge, nun erzähle mir doch mal …»
Termeer erzählte, er sei in Heerhugowaard, einem Dorf in Nordholland, als Sohn eines Kleinbauern geboren. Doch sein Vater war früh gestorben. Seine Mutter war mit einem Kerl davongelaufen, der mit einer Zweizylinder-BMW gekommen war, einem Motorrad von der ganz teuren Sorte. Offenbar ein Deutscher, den sie noch aus der Besatzungszeit gekannt hatte. Jo schien seiner Mutter drei Verbrechen vorzuwerfen: zunächst einmal Ehebruch, denn Jos Eltern hatten während des Krieges geheiratet. Da der Deutsche der Feind war, kam Landesverrat hinzu. Jo war gegen Kriegsende geboren worden, konnte also nicht das Kind des Deutschen sein. Doch die Mutter hatte ihr eigenes Kind im Stich gelassen.
Die Mutter, die herumgehurt und ihr Vaterland verraten hatte, ließ ihr Kind in der Obhut ihres völlig überarbeiteten Ehemanns zurück. Jos Vater machte Bankrott und erhängte sich in der Scheune über den Köpfen seiner tuberkulösen Kühe.
Eine ländliche Tragödie, die schließlich doch noch eine einigermaßen glückliche Wendung nahm, denn das blonde Waisenkind …
(«Wie alt warst du da, Jo?»)
(«Acht Jahre, Herr Commissaris.»)
… wurde von Onkel Bert in Amsterdam adoptiert. Onkel Bert war damals Straßenhändler auf dem Büchermarkt am Oudemanhuispoort, am Rande des Rotlichtviertels, wo es noch anständig zuging und keine Prostituierten in Schaufenstern saßen. Der Onkel sorgte gut für den Jungen, der seinen Schulabschluss machte und dann Friseur wurde. Nachdem Jo sich eine eigene Existenz aufgebaut hatte, emigrierte der Onkel in die USA.
«Aus einem bestimmten Grund?»
Jo zuckte die Achseln. Der Onkel war ein Abenteurer gewesen. Holland war ein kleines Land. Er hatte sich auf englischsprachige spirituelle Literatur spezialisiert. Der amerikanische Buchversand-Markt war riesengroß. Er war wohl schon immer von Amerika begeistert gewesen. An den Wänden seiner Amsterdamer Wohnung hatten Landkarten von Amerika gehangen. Er war in den Staaten herumgereist und hatte in Bangor, Maine und Boston gewohnt. Am liebsten war er jedoch in New York gewesen, wo er insgesamt etwa fünf Jahre gelebt haben musste.
«Ein ganz schöner Sprung vom Oudemanhuispoort», sagte der Commissaris.
«Ja, mein Onkel war sehr unternehmungslustig.»
«Hat Tante Carolien ihn begleitet?»
«Sie wollte nicht», sagte Termeer. «Sie war zehn Jahre älter als er. Tante Carolien sah für ihr Alter jung aus und Onkel Bert alt, aber der Unterschied zwischen beiden wurde doch immer größer. Und sie war krank geworden.»
«Lebt sie noch?»
Termeer schüttelte den Kopf. «Multiple Sklerose. Gelähmt. Sie sah auch nicht mehr gut. Ich habe sie ab und zu in einem Heim an der Leidsegracht besucht.»
«Schlimm?»
«Nein, überhaupt nicht.» Termeer schien sich nun zu entspannen; er redete ohne Scheu. Als Jo noch ein kleiner Junge gewesen war, hatte Tante Carolien Onkel Bert oft zu sich geholt. Sie hatte dann nur mit durchsichtiger Unterwäsche und Stiefeln bekleidet auf der Treppe gestanden und seinen Onkel geneckt. Manchmal hatte sie auch noch einen Hut mit Paradiesvogelfedern getragen. Eine sehr außergewöhnliche Frau.
«Sie war keine … ähhh»
«Für Geld?», fragte Termeer. Das glaubte er nicht. Er hatte Tante Carolien zwar einmal mit einem Milchmann gesehen und einmal unter einem kräftig zustoßenden Postboten, aber das waren eher Zufallskontakte gewesen, rein zu ihrem Vergnügen. Sie war Eigentümerin eines großen Giebelhauses gewesen und hatte von der Zimmervermietung gelebt. Außerdem hatte sie ein paar Wertpapiere gehabt.
«Hat dein Onkel für das Heim bezahlt, in dem sie starb?»
«Nein, das war nicht nötig. Carolien ist immer eine selbständige Frau gewesen, und sie ist auch selbständig in den Tod gegangen, ohne Zustimmungserklärung ihres Arztes: bequem in ihrem Bad, mit einem Plastikbeutel über dem Kopf, nachdem sie zuvor ein paar Gläser geleert hatte.»
Jo Termeer lächelte.
Der Commissaris wartete.
«Tante Carolien», fuhr Termeer fort, «ich mochte sie sehr gerne.»
Er erzählte dem Commissaris, der Onkel habe zusammen mit seiner Hauswirtin gelegentlich kleine Reisen unternommen, und manchmal habe Jo sie begleiten dürfen. Einmal waren sie zu dritt in Paris auf dem Markt gewesen, um alte Bücher zu suchen. Onkel Bert hatte einen antiken Rollstuhl entdeckt, aber der Händler war ziemlich arrogant gewesen. So waren sie manchmal in Frankreich: zu fein, um sich mit Ausländern abzugeben, die ihre Muttersprache verunstalteten. Später waren sie noch einmal an dem Stand mit dem Rollstuhl vorbeigekommen. Carolien hatte gesagt: «Den werde ich bald brauchen.» – Eine Vorahnung. – Als der Händler einen Augenblick nicht aufpasste, hatte sich Tante Carolien in den Rollstuhl gesetzt, mit verzogenem Gesicht, sabbernd und mit spastisch zitternden Wangen. Onkel Bert hatte kräftig geschoben, und weg waren sie gewesen.
«Und du?»
Termeer grinste. «Ich habe den Händler abgelenkt, so getan, als hätte ich etwas klauen wollen, und ich ließ mich schnappen. Der Mann durchsuchte mich, konnte aber nichts finden.»
Der Commissaris nickte, als er sich die Szene vorstellte.
Termeer lachte. «Das werde ich nie vergessen.»
Der Commissaris drehte das Band im Recorder um und gab seinem Besucher mit erhobener Hand ein Zeichen, solange zu schweigen.
«So. Und wie alt bist du jetzt?»
Jo Termeer war gerade vierzig geworden.
Ein vierzigjähriger kleiner Junge, dachte der Commissaris. Kurz geschoren, gut angezogen, athletisch, höflich und beredt.
«Wie lange hat dein Onkel in Amerika gelebt?»
Onkel Bert hatte über zwanzig Jahre in Amerika gelebt, und Tante Carolien war seit vier Jahren tot.
Der Commissaris schaltete das Aufnahmegerät aus. Er versprach, über Interpol und mit Hilfe anderer direkterer Beziehungen Erkundigungen einzuziehen.
«Sie werden sich das nicht zufällig selbst einmal anschauen?», fragte Termeer.
Der Commissaris entschuldigte sich. Er bedauere, aber New York, das müsse Kollege der Reserve Jo doch wohl verstehen, liege außerhalb der Zuständigkeit eines Polizeibeamten der Stadt Amsterdam. Außerdem stehe er kurz vor seiner Pensionierung.
«Aber …»
Nein, der Commissaris werde ganz sicher nicht nach Amerika reisen. Es sei nicht so, dass er einem, äh, Kollegen einen Gefallen abschlagen wollte. Er würde sehen, was er für den freiwilligen Hoofdagenten Johan Termeer tun könne, aber Jo solle sich davon bitte nicht allzu viel versprechen.
Der Commissaris war der Meinung, er habe nun genug getan, und wollte sich mit gestrengem Blick hinter seinen Schreibtisch setzen. Er machte Anstalten aufzustehen. Termeer erhob sich gleichzeitig mit ihm und wuchs immer weiter in die Höhe. Im Stehen war er fast dreißig Zentimeter größer als der Commissaris und schaute in dieser Haltung auf den Vorgesetzten herab.
Ein beachtlicher Gegner, dachte der Commissaris, während er zu ihm hochspähte und seinen Blick verstohlen zur Seite streifen ließ, denn Termeer hatte auffällig breite Schultern. Merkwürdig, dass ihm vorher nicht aufgefallen war, wie groß sein Besucher war.
Eine Frage der Einstellung? Der Vorgesetzte und der Untergebene hatten sich einfach so gegenübergestanden, Zwerg und Riese, nachdem Adjudant Grijpstra Termeer hereingebracht hatte, aber da war der Commissaris von sich selbst überzeugt gewesen: der leitende Polizeibeamte in seinem eindrucksvoll möblierten Büro. Woher kam plötzlich dieses Gefühl von Kleinheit? Empfand man Unterschiede in der Körpergröße stärker, wenn man von Schuldgefühlen geplagt wurde?
Termeer sprach immer noch, mit tieferer Stimme als vorher und gar nicht mehr untertänig. «Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe, Commissaris. Aber ich dachte, weil ich all die Jahre bei der Polizei gedient habe, unbezahlt …»
Auch der Commissaris entschuldigte sich, ohne es wirklich zu meinen.
Termeer beugte sich zu ihm hinab. «Sie fahren doch hin und wieder nach Amerika? Adjudant Grijpstra hat gesagt, eine Schwester von Ihnen hätte früher dort gewohnt und Sie hätten dort Freunde.»
Antoinette, die Sekretärin des Commissaris, trat ein, um das Kaffeegeschirr abzuräumen. Sie «nahm sich die Freiheit» (wie sie selbst sagte, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie Termeer kannte), «sich einzumischen».
«Sie haben doch sicher nichts dagegen, Mijnheer?»
Der Commissaris ließ seinen Blick im Zimmer umherschweifen, in der Hoffnung, dass dies alles nicht mehr lange dauern würde, bewunderte erneut den im Sonnenlicht leuchtenden Teppich, die niedrig hängenden Porträts von Polizeichefs längst vergangener Zeiten und die leuchtenden Geranienblüten auf der Fensterbank.
Ihr Mann Karel, erklärte Antoinette, habe kürzlich bei der Einrichtung von Jos und Peters neuem Haarpflegesalon mitgeholfen.
Was für ein Zufall!
«Und du arbeitest bei uns bei der Reserve?», fragte Antoinette Jo Termeer. Sie schaute den Commissaris an. «Wieder so ein Teilzeitpolizist, der unentgeltlich der Gemeinschaft dient.» Dann wandte sie sich Termeer wieder mit jener Vertraulichkeit zu, die sich entwickelt, wenn man Freunden dabei hilft, in ihrem eleganten Geschäft einen neuen Teppichboden zu verlegen.
«Warst du nicht damals dabei, als dieser Jugoslawe festgenommen wurde?», fragte Antoinette Termeer. «Dieser Gangster, der einen Berufspolizisten aus der Warmoesstraat niedergeschossen hat?»
«Wie klein die Welt doch ist», sagte der Commissaris.
«Dieser Polizist hat sich nie mehr ganz davon erholt», erläuterte Antoinette. «Sein rechter Arm hängt immer noch schlaff herunter. Aber ohne Jo Termeer wäre er heute tot.»
Jo erzählte Antoinette, dass sein Onkel im Central Park in New York ermordet worden sei. So weit weg. Da könne man kaum etwas unternehmen, vor allem, wenn man nur wenig Englisch spreche.
«Ist er ausgeraubt worden?», fragte Antoinette.
Jo fasste noch einmal kurz alles zusammen.
«Der arme alte Mann», sagte Antoinette. «Und Sie nehmen sich dieser Sache an, Herr Commissaris?»
Das hatte der Commissaris ganz und gar nicht vor.
«Mit der Post ist eine Einladung gekommen», sagte Antoinette und hielt einen geöffneten braunen Umschlag in die Höhe. «Für einen Polizeikongress in New York.» Antoinette schnippte Staub vom Ärmel des Commissaris. «Es ist schön dort. Karel und ich sind letztes Jahr hingeflogen. Wir haben alle Warhols gesehen und den Flugzeugträger, der auf dem Fluss liegt. Karel sagt, er sei eine Art Kunstwerk. Grauen und Gewalt sind seiner Meinung nach auch Kunst.» Antoinette faltete ein Blatt auseinander, das sie aus dem Umschlag gezogen hatte. «Ihr Kongress beschäftigt sich auch mit diesem Thema, mit Gewalt heute. Schauen Sie sich nur das Foto auf der Vorderseite der Einladung an. Ein totes Mädchen, das Reste von Erbrochenem in den Mundwinkeln hat. Igitt.»
Antoinette schloss angeekelt die Augen. Dann schaute sie Termeer wieder an.
«Ist er nicht ein Glückspilz? Umsonst eine Woche New York! Und wir dürfen dafür Steuern bezahlen. Aber so ist es nun einmal mit den Hohen und Mächtigen dieser Welt.»
Der Commissaris wirkte erstaunt.
Antoinette strahlte. Jetzt, wo der Commissaris kurz vor seiner Pensionierung stand – er würde ihr sehr fehlen –, war ihr Umgang miteinander viel vertraulicher geworden. Sie drückte sich ein wenig gegen ihn und schaute auf seinen kahl werdenden Kopf hinunter. «New York, was für eine Stadt! Mit den Raubüberfällen scheint es gar nicht so schlimm zu sein, wenn man nur ein bisschen aufpasst. Und für uns ist dort jetzt alles so billig. Es gibt Restaurants aus aller Welt. Jeden Tag kann man etwas anderes probieren. Alles ist dort anders. Und all die verschiedenen Nationalitäten!» Antoinettes Augen weiteten sich. «Und diese Gebäude, all das Glas!»
Für kurze Zeit herrschte Schweigen.
«Wenn Sie doch sowieso hinfliegen …», setzte Termeer erneut an.
Der Commissaris runzelte die Stirn. «Ich fliege aber nicht.»
Zwei
«Und er fliegt doch», sagte Brigadier de Gier zwei Tage später. Adjudant Grijpstra war bei de Gier in dessen Apartment zum Tee, weil Grijpstra an jenem Abend vorzeitig von seiner Freundin weggegangen war.
«O ja, o ja, o jaaa?», hatte Grijpstra gesagt, während er die Treppe von Nellies Wohnung hinabgestapft war.
Nellie führte ein Hotel am Rechtboomsloot. An diesem Tag war ein Wasserrohr geplatzt und das Essen angebrannt. Wegen der beiderseitigen Gereiztheit verlief ihr sexuelles Beisammensein an jenem Abend nicht besonders befriedigend.
«Aber es war befriedigend!», hatte Grijpstra gesagt.
«Für dich vielleicht», erwiderte Nellie und versuchte, ihm zu erklären, was sie unter «zusammen» verstand. Aber in Grijpstras Ohren war das nur Kritik.
Er war müde gewesen, nachdem er an jenem Tag mehrere Stunden lang einen drogensüchtigen Einbrecher verhört hatte. Der Junkie war immer wieder eingeschlafen und hatte völlig vergessen, wo er eingebrochen hatte, was er dort hatte mitgehen lassen und wo die Beute geblieben war.
«Oder auch nicht», hatte er jeder Aussage hinzugefügt, nicht, um die Ermittlungen zu behindern, sondern um auf den relativen und chaotischen Charakter aller Dinge hinzuweisen.
«Aber was weißt du schon darüber? Häh? Du tote Hose? Du musst es selbst mal probieren, Mann. Dann sitzt du bei Gott auf der Treppe und kapierst auch endlich mal was. Dann brauchst du freie Seelen wie mich nicht mehr vollzulabern.»
Grijpstra zog Kroketten aus dem Automaten in der Leidsestraat. Er hätte nach Hause gehen können, in seine hübsche Maisonette an der Lijnbaansgracht, die seine Familie vor ein paar Jahren verlassen hatte. Um jede Erinnerung an seine Frau zu vermeiden, hatte er sie gedrängt, das gesamte Mobiliar mitzunehmen. Und bisher hatte er die großen Räume noch nicht neu möbliert. Damals war die Maxime «Ein intelligenter Mann braucht nicht viel» sein Leitsatz gewesen. Mittlerweile hatte er eher das Gefühl, dass die leeren Räume Grijpstra nicht mehr brauchten. «Reine Leere, vom Leuchten des Nichts durchstrahlt», hatte der Poet Grijpstra jubiliert, als «Sie» und «die Krachmacher» endlich ausgezogen waren. An jenem Tag hatte die Sonne geschienen.
Erscheinungen veränderten sich. Er sah das leere Apartment nun als getreues Abbild von Hollands ständig wolkenverhangener Atmosphäre. «Zugige Abwesenheit von Notwendigkeiten, teilweise beleuchtet von einer baumelnden Glühbirne», dichtete Grijpstra vor sich hin.
Ein Türke hörte ihm zu. Er war früher einmal von den Holländern willkommen geheißen worden, um unangenehme harte Arbeit zu verrichten. Doch die Rationalisierung hatte ihn überflüssig gemacht. Er bekam nun Arbeitslosengeld, weil er eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hatte. Der Türke war ein dünner Mann in einem fadenscheinigen Mantel, der wie Grijpstra auf die Straßenbahn wartete.
«Hast du was gesagt, Freund?»
«Die leeren Räume, die ich mein Zuhause nenne, haben mich zu einem Gedicht inspiriert», antwortete Grijpstra.
Er wiederholte die Zeile: «Zugige Abwesenheit …»
Der Türke lächelte. «Du zarte Seele.»
Grijpstra nahm das Kompliment mit einem Niesen zur Kenntnis.
Der Türke wünschte ihm Gesundheit.
Es regnete nun stärker. Grijpstra drängte sich rückwärts unter das Dach des Wartehäuschens. Der Türke machte es ihm nach. Regentropfen platschten auf den Asphalt und sprangen von dort wieder hoch, gegen die Hosenbeine der beiden.
«Zuhause», sagte Grijpstra. «Leer, still.»
Der Türke kannte diese Worte zwar, konnte aber keine Bedeutung mehr damit verbinden.
«Zwei Frauen, zwei Fernseher», entgegnete er. «Fünf Kinder, die zwischen den beiden Flimmerkisten hin und her laufen. Und die Nachbarn über mir streiten sich auf dem blanken Holzfußboden.»
«Sie sprechen aber gut Holländisch», sagte Grijpstra.
«Das ist nicht so schwer», antwortete der Türke gereizt. «Nicht so viele Wörter und auch nicht allzu viel Grammatik.»
Grijpstra gefiel das. Er reichte dem Türken eine Krokette aus seiner Tüte.
«Schwein?», fragte der Türke misstrauisch.
«Kalb», beruhigte ihn Grijpstra jovial.
Der Türke sagte, er habe schon öfters Schwein gegessen, und zwar nicht aus Versehen. Er sei gegen religiöse Vorschriften. Er esse, Allah sei gepriesen, was ihm schmecke. Aber wenn er Schwein esse, wolle er wenigstens wissen, dass er sündige. Sein Auge fiel auf die Bremslichter eines Autos. Der Türke schluckte den Bissen, den er gerade im Mund hatte, hinunter, lächelte, reckte sich und deklamierte: «An der Straßenbahnhaltestelle in der Fremde in vernichtender Dunkelheit glüht meine Seele plötzlich rot auf, von Sünde beschienen.»
Grijpstra applaudierte seinem Dichter-Kollegen.
Der Türke sagte, auf türkisch falle es ihm leichter, zu dichten, aber er habe gelernt, sich im Rahmen seiner sprachlichen Beschränktheit verständlich zu machen. Bisher seien seine holländischen Gedichte noch nicht so gut gelungen. Dann hob er einen Finger.
Der türkische Hund sagt: «Wie dankbar ich bin»,
und legt seinem Herrchen ein Würstchen hin.
«Das reimt sich sogar.» Der Türke stieß Grijpstra vertraulich an. «Gefällt dir?»
Grijpstra stieß den Türken ebenfalls an. «Gefällt mir.»
Der Kalbskroketten kauende Türke stieg in die Straßenbahn. «Sei gegrüßt, mein Freund.»
Grijpstra winkte ihm nach. «Sei gegrüßt.»
Der Adjudant nahm den Bus nach Buitenveldert. Er hätte sich vorher telefonisch anmelden können. Tatsächlich hatte er sogar die Münze für das Telefon schon in der Hand gehabt, sie aber wieder in die Tasche gesteckt. Angenommen, de Gier war nicht zu Hause – dann hätte Grijpstra sich die ganze Busreise sparen können. Aber ihm gefiel es, in überfüllten Bussen zu sitzen und vor sich hin zu starren. «Sinnlose Stille mit völlig Fremden teilen.»
De Gier war zu Hause, öffnete aber nicht, weil er gerade eine CD mit Musik aus Papua-Neuguinea hörte.
Grijpstra schlug wie wild gegen die Tür und ließ den Finger auf dem Klingelknopf.
«Täbris», sagte de Gier zu seiner Katze, «sie sind wieder da. Hast du was dagegen, wenn ich durch die Tür schieße?»
«Gestapo!», rief Grijpstra, weil de Gier jüdische Vorfahren hatte und oft über seine Rachegelüste sprach. «Nur ein einziges Mal, Henk», sagte de Gier jedes Mal. «Ich würde mich danach wesentlich besser fühlen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus?» De Giers jüdische Großmutter war in Rio de Janeiro von einem Bus überfahren worden, nachdem es ihr gelungen war, aus Holland zu fliehen, noch bevor die Deutschen das Land besetzt hatten. De Giers Rachegefühle waren eher prinzipieller Natur – Gut gegen Böse. Der Gute tötet den Bösen – nachdem er ihn vielleicht vorher verprügelt hat.
Während de Gier auf diese Gelegenheit wartete, hielt er sich zurück und half deutschen Touristen. Er war auch bekannt dafür, dass er besonders rücksichtsvoll mit deutschen Verdächtigen umging.
Zu Grijpstra hatte er einmal gesagt, vielleicht sei die Phantasie das einzige, was zähle.
«Gestapo, mein Lieber.» Grijpstra lehnte sich gegen die knarrende Haustür.
De Gier öffnete ganz plötzlich die Tür in der Hoffnung, dass sein Opfer vornüberfallen würde. Doch Grijpstra war rechtzeitig zurückgetreten.
«Ich würde den heutigen Abend lieber allein verbringen», sagte de Gier und trat zur Seite, sodass Grijpstra eintreten konnte. «Ich bin mir sicher, dass du Verständnis dafür hast.»
Grijpstra war froh, jemanden zu kennen, der Wasser für ihn aufsetzte und Brot in den Toaster schob. De Gier, zehn Jahre jünger als der Adjudant, sein unmittelbarer Vorgesetzter, sah aus wie ein Filmstar – das meinte Grijpstra zumindest. Das kurze gelockte Haar war frisch gewaschen und geföhnt, und seinen großen Schnurrbart hatte er offensichtlich gerade gebürstet. Er schlenderte lässig in seinem gestreiften Baumwollkimono umher. ‹Mister B-Movie›, dachte Grijpstra freundlich. ‹Unser Actionheld, im Augenblick gerade in einer Pause zwischen Kämpfen und Vögeln.›
«Wie geht es Wie-heißt-sie-doch-gleich?», fragte Grijpstra, als de Gier Tee, Anschovistoasts und Servietten, geschmackvoll auf einem verbeulten Silbertablett arrangiert, über den Tisch schob.
«Ich verstehe Wie-heißt-sie-doch-gleich nicht», sagte de Gier.