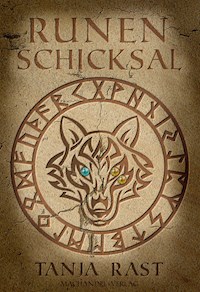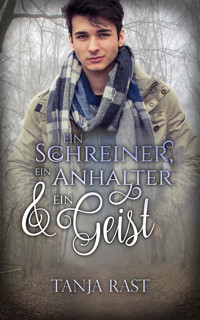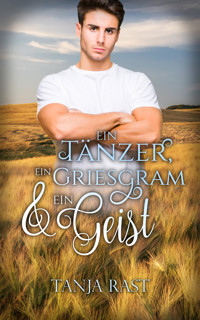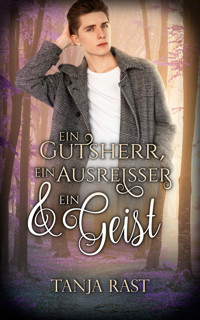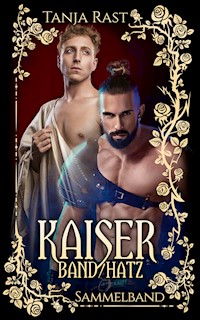4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Epische High Fantasy mit Helden, Schlachten, Magie und einer Romanze, die sich wie ein rotes Seidenband durch die Geschichte zieht und weder drohende Niederlagen noch selbst den Tod fürchtet. Orientierungslos und krank wie ein Hund findet Teiro sich in der unter Angriff stehenden Hauptstadt wieder. Glücklicherweise kann er sich dem kleinen Trupp rund um Kanzlerin Ghenis anschließen, die die Stadt als Letzte verlässt. Während Teiro begreift, dass er obendrein seine Erinnerungen verloren hat, erfährt er mehr über die resolute Frau, die alles daran setzt, ihr Reich zu verteidigen. Denn Ghenis ist etwas Besonderes: Sie ist eine der Wenigen, die die Götter hören kann. Doch als ihr Reich angegriffen wird, wartet sie vergebens auf den Gott des Krieges, der die Verteidiger unterstützen sollte. Stattdessen vernimmt sie Hilfeschreie aus der Götterwelt – und dann nur noch betäubende Stille.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Teiro
Tanja Rast
Inhaltswarnungen
Kann Spuren von Erdnüssen enthalten!
Es gibt Inhalte, die Betroffene triggern können, das heißt, dass womöglich alte Traumata wieder an die Oberfläche geholt werden. Deswegen habe ich für diese Personen eine Liste mit möglichen Inhaltswarnungen für alle meine Romane zusammengestellt:
www.tanja-rast.de/inhaltswarnungen
1.
Flucht über den Mar
Ghenis vernahm die Schreie der sterbenden Göttin, hielt sich zitternd an der Stuhllehne fest und konnte kaum noch atmen.
Ihr Herz pumpte, bis es zu zerspringen drohte, während ihr Schweiß über die Wangen rann. Damit hatte sie nicht gerechnet. Wutgebrüll des Gottes des Krieges vielleicht, der die Soldaten des Reichs mit einer Stimme wie Donnerhall anfeuerte, ihm in die Schlacht zu folgen. So wie er sie seit Hunderten Jahren, seit Menschengedenken anführte, wenn dem Reich der zwei Flüsse, Herrschaftsgebiet der beiden Königinnen, Gefahr drohte.
Wie jetzt.
Ghenis lauschte in den Äther, doch die Schreie waren verklungen. Leise, raschelnde Atemzüge füllten ihre Wahrnehmung, klangen nach Schmerz und unendlicher Schwäche. Und endeten.
Absolute Stille hüllte Ghenis ein. Sie schüttelte die Vision, die Verbindung zur Götterwelt ab und stemmte sich auf weichen Beinen vom Stuhl hoch.
Noch vor einer Stunde hatte sie die Truppen des feindlichen Heeres über der Erhebung einige Meilen vor der Stadt auftauchen sehen. Nicht aus dem Herzland des Reichs, was die einzige Erleichterung war. Nun lagen die Hauptstadt Mardien Hald und vor allem der breite Strom Mar zwischen den Eindringlingen und dem wirklichen Reich.
Dort auf der Hügelreihe verharrten die Angreifer. Helm an Helm, Speerspitze neben Speerspitze stand siegesbewusst der Feind. Als rechnete er mit keiner nennenswerten Gegenwehr. Ein gewaltiges Heer, das noch größer zu werden schien, als es sich dort auf der Hügelreihe einnistete.
Doch der Gott des Krieges würde jeden Moment erscheinen, die Truppen der Königinnen an sich reißen und im wilden Galopp den Feinden entgegen sprengen, um wie ein Keil in ihre Reihen zu fahren, für Chaos und Panik zu sorgen.
So, wie er es immer tat.
Ghenis humpelte zum Fenster und starrte hinab auf den Vorplatz des Palasts, wo Truppen sich seit den frühen Morgenstunden sammelten, da Feuersignale der Grenztürme von einem Angriff zu sprechen begonnen hatten. Die Männer dort auf dem Platz standen in Gruppen beieinander, blickten immer wieder in offenkundiger Nervosität zum Tor des Palasts, dann zur anderen Seite zum großen Portal, das in die Stadt und zu den Brücken über den Mar führte. Dort würde er erscheinen. In schwarzer Rüstung, einen glutroten Mantel über die breiten Schultern geworfen. Wie ein Banner wehte dieser Umhang über die Kruppe seines Kriegspferdes. Deutlicher als jede Standarte zeigte die leuchtende Farbe, wo der Gott des Krieges sich befand, wohin die Truppen ihm zu folgen hatten, damit er sie zum Sieg führte.
Ghenis sah ihn vor sich, wie sie ihn einmal schon in Wirklichkeit hatte erblicken dürfen. Jeder Zoll der schwer gepanzerten Gestalt schien ihr greifbar. Fast meinte sie, seine Atemzüge zu hören und das schwere Aroma des Bluts an seinen Waffen zu riechen.
Doch kein prachtvolles Ross stampfte mit beschlagenen Hufen auf die Pflastersteine. Kein Rot wogte im Wind. Kein tiefer Schrei aus einer göttlichen Kehle rief die Männer zu den Waffen.
Leise wehte Musik zu Ghenis empor. Marschmelodien, die die Seelen und Herzen der Männer mit Mut erfüllen sollten.
Mutig mochten sie sein, doch es fehlte ihnen ein Anführer. Generale besaß das Reich selbst zu Genüge, doch noch nie zuvor hatten diese das Heer in eine Schlacht führen müssen.
Ghenis wandte sich ab, schluckte hart, da Galle ihr die Kehle hinaufstieg. Alles Anzeichen ihrer Erschöpfung und Verwirrung. Sie wollte sich auf ihrem Bett in dicke Decken einrollen und schlafen. Bestimmt entpuppte sich all dies nur als Albtraum, wenn sie endlich wieder aufwachte. Wahrscheinlich schlief sie und wandelte auf kalten, unsicheren Beinen im Traum umher.
Doch die Schreie hatten ihre Wirbelsäule mit gestoßenem Eis und den Magen mit Kälte gefüllt und ihr Herz zum Rasen gebracht.
Dies war Wirklichkeit. Sich an eine andere Hoffnung zu klammern, war töricht, gefährlich und sehr wahrscheinlich tödlich.
Ein Klopfen an der Tür ließ Ghenis herumfahren. Schmerz zuckte durch das schwache Bein, und sie musste sich am Stuhl festhalten, gegen den auch ihr Stab lehnte.
Noch bevor Ghenis eine Aufforderung rufen konnte, schwang die Tür auf, und der kleine Page der Königinnen blickte furchtsam ins Zimmer. »Kanzlerin, meine Königinnen brauchen dich.«
»Deine Königinnen sollten schon vor einer Stunde die Stadt verlassen haben«, erwiderte Ghenis, packte den Stab, der ihr als Stütze diente, wenn die Winterkälte das schwache Bein mit Schmerz füllte. Sie humpelte zur Tür. »Sind wenigstens schon ihre Sachen gepackt? Die Kronjuwelen und die Siegel?«
Der Page nickte und hielt Ghenis die Tür weit auf. »Sie wollen nicht gehen. Sie sagen, sie können die Stadt nicht im Stich lassen. Und sie sagen, der Gott des Krieges wird jeden Moment erscheinen.«
Ghenis verschwieg vor dem Knaben, was sie in der Verbindung zur Götterwelt vernommen hatte. Ein Geschenk hatten ihre Eltern diese Gabe genannt. Ghenis hatte diese extrem direkte Verbindung niemals für etwas so Besonderes gehalten. Die Götter waren da und nahe. Die Göttin der Fruchtbarkeit half gemeinsam mit ihren Kindern bei der Ernte, band eigenhändig Korngarben und unterstützte die Bauern beim Verladen und Dreschen. Da erschien es Ghenis oft selbstverständlich, dass sie die Götter hören konnte, wenn diese es wünschten. Zumindest als Kind hatte sie so gedacht, während sie der sanften Stimme des Gottes der Bücher lauschte. Später hatte Ghenis begriffen, dass diese Gabe wirklich etwas Außergewöhnliches war, dass nur ganz wenige außer ihr sie ebenfalls besaßen.
Wie furchtbar dies sein konnte, stand ihr nun klar vor Augen.
Die Göttin hatte um Hilfe geschrien. Nach den Menschen, denen sie diente und die sie verehrten, die sie in Not anriefen und um Beistand baten. Zum ersten Mal, soweit Ghenis wusste, hatte nun eine Göttin um Unterstützung gerufen. Und es hatte nichts gegeben, was Ghenis hätte tun können. Wie sollte ein Sterblicher in das Reich der Götter aufsteigen? Wie ein Sterblicher etwas besiegen, was selbst einen Gott niederrang? Und trotzdem … sie hatte helfen wollen. Ihre Muskeln hatten sich erhitzt und auf Kampf vorbereitet wie in jener Zeit, als Ghenis noch dem Heer angehört hatte.
Doch blieb Ghenis hilflose Zeugin des Sterbens.
Ganz beruhigt hatte sie sich noch nicht, als sie dem Pagen über die breiten Flure folgte. Beamte hasteten umher, trugen Kisten mit Papieren, Wertgegenständen und allen Dingen, die sie für absolut überlebenswichtig hielten.
Ghenis sammelte sich und ihre Kraft. Der Stab pochte beruhigend auf kalten Marmor, gab ihr Halt nicht nur als Stütze, sondern auch als Symbol ihres Amtes. Sie war die Kanzlerin, verdammt. Die Göttin mochte gefallen sein und Trauer Ghenis erfüllen, doch hier auf Erden, in diesem Palast und dieser Stadt gab es Menschen, die Ghenis retten konnte. Wenn sie nur Ordnung in das Chaos bringen könnte.
Sie hielt einen vorbeihastenden Mann auf. »Sind die Kutschen der Königinnen bereit für die Abfahrt?«
Der Beamte ließ fast sein Bündel Schriftrollen fallen, blickte fahrig um sich, wohl, ob ein Gehilfe in der Nähe wäre, der der Kanzlerin die gewünschten Auskünfte geben konnte. Dann riss er sich merklich zusammen. »Die Wagen stehen bereit. Die schnellsten Pferde eingespannt. Habe ich gehört.«
»Hörensagen genügt mir nicht. Überprüfe das. Und falls das noch nicht geschehen ist, sorge dafür, dass die Kutschen vorbereitet sind. Jetzt. Ich will die Königinnen unterwegs in die Sicherheit der Felsenburg wissen. Sorge für ihre Leibgarde.«
»Der Gott des Krieges …«
»Bislang keine Spur von ihm. Ich weiß, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um uns zu helfen. Er will uns nicht enttäuschen oder gar im Stich lassen. Doch das feindliche Heer ist groß und der Gott noch nicht erschienen. Wir legen nicht die Hände in den Schoß und überlassen alles den Göttern. Wir nutzen ihre Hilfsbereitschaft nicht aus. Sorge für deine Königinnen!«
Der Mann nickte endlich und rannte wieder los.
Besorgt blickte der Page sich um.
»Du gehst mit deinen Königinnen, mein Junge, hab keine Angst«, hörte Ghenis sich selbst sagen. Ihre Stimme klang ganz ruhig, so wie immer, fand sie. Das war sie sich selbst auch schuldig.
Wieder klopfte der Stab auf den Marmor, und der Junge rannte voraus und öffnete für Ghenis das große Portal zu den Gemächern der Königinnen.
Wie ein Bienenstock, aber nicht halb so geordnet. Ghenis hätte sich gerne dafür gescholten, dass sie nicht schon lange hier erschienen war, um Ruhe und Ordnung in das wilde Durcheinander zu bringen. Doch die Gabe hatte sie daran gehindert, ihren Pflichten als Kanzlerin nachzukommen. Kein Mensch hatte der sterbenden Göttin zur Hilfe kommen können, und so hatte sie zumindest einen Zeugen verdient, der voll Mitgefühl für sie war und um sie trauerte.
Ghenis neigte zum Gruß leicht das Haupt. Sie fiel nicht auf ein Knie nieder wie der kleine Page. Die Königinnen achteten das Amt. Und sie waren gütig und wussten um die Verletzung, die Ghenis humpeln ließ und es ihr unmöglich machte, nach einem Kniefall mühelos wieder aufzustehen.
»Ghenis, wo ist der Gott des Krieges? Er sollte unsere Truppen gegen den Feind führen.« Alrona, die Sanfte, ältere der beiden Königinnen. Das schlohweiße Haar unter dem goldenen Stirnreif umwogte das schmale Gesicht wie eine Wolke aus Schnee. Doch die klarblauen Augen blickten wach und besorgt.
»Ich weiß es nicht, meine Königin. Ich bin überzeugt, dass er sobald wie möglich zu unserer Unterstützung eilen wird. Bis dahin sind wir auf uns alleine gestellt. Wir sind keine Kinder, die auf Hilfe warten müssen. Je mehr wir selbst leisten, desto eher haben wir seine Hilfe verdient, meinst du nicht?«
»Du willst, dass wir die Stadt verlassen.« Kenia trat vor, die junge Königin, deren Energie Ghenis begeisterte. An Weisheit konnte Kenia es nicht mit Alrona aufnehmen, aber sie hatte die Fähigkeit, Dinge anzupacken, die Kraft und Vernunft erforderten. Und mitunter einen Fußtritt, damit sie ins Rollen kamen.
»Zu eurer Sicherheit. Weicht hinter den Mar zurück. Doch bleibt dort nicht stehen. Flieht hinter den Dien und in das Gebirge in die Felsenburg. Frauen und Kinder werden sich euch anschließen. Sollte der Feind den Mar überschreiten, können wir mit dem Dien im Rücken das Hinterland verteidigen. Aber euch beide muss ich in Sicherheit wissen. Erst dann kann ich aufatmen.«
»Ich fühle mich ein wenig feige dabei.«
»Das kann ich verstehen, Kenia. Aber da draußen zieht eine Übermacht auf. Selbst wenn der Gott des Krieges unsere Soldaten in die Schlacht führt, könnte das Ergebnis unsicher sein.«
»Du warst selbst Soldatin, ich weiß, dass du die Lage einschätzen kannst. Doch was werden unsere Truppen sagen, wenn Alrona und ich die Stadt verlassen, um uns irgendwo in den Bergen zu verstecken?«
»Sie werden erleichtert sein, dass ihr die Last von ihren Schultern genommen habt. Ihr kümmert euch um das Volk und überlasst die Schlacht und das blutige Handwerk jenen, die dafür ausgebildet wurden. Dem Gott des Krieges, unserem Heer und mir. Wir decken den Rückzug.«
Kenia blickte Alrona an, und endlich nickte die alte Königin. Ghenis atmete lautlos auf. Es würde alles leichter werden, wenn nur diese beiden in Sicherheit waren. Sie und ihre Erbinnen, denn jede Königin bestimmte zu Lebzeiten die eigene Nachfolgerin. Eine weise Einrichtung, wie Ghenis fand, verminderte die öffentliche Ernennung der Erbin doch mögliche Nachfolgekriege, wie sie früher – vor dem Eingreifen des Gottes des Krieges – wohl beinahe an der Tagesordnung gewesen waren. Vor vielen, vielen Hundert Jahren. Damals drohte das Reich, in blutigen Familienfehden und auch in Bürgerkrieg und Hunger zu versinken. Doch der Gott des Krieges war auf die Erde herabgestiegen und hatte – wenn Ghenis die Schriften der Chronisten interpretierte und vor allem zwischen den Zeilen las – wohl einige Köpfe zusammengeschlagen, um den Verstand darin wieder zur Arbeit anzutreiben.
Ghenis mochte diesen Gott von allen am liebsten. Auch wenn dies in einem grundsätzlich friedlichen Reich ungewöhnlich erschien. Die Weisheit des Gottes der Bücher, die Hilfe der Göttin der Fruchtbarkeit, die Unterstützung durch den Gott der Heilkraft – Ghenis war bereit, all das einzutauschen gegen den gewaltigen Krieger in schwarzer Rüstung und glutrotem Mantel. Vor allem jetzt, da Feinde vor den Toren der Stadt Aufstellung bezogen, ein Lager errichteten und Wälder niederholzten, um Kampfmaschinen daraus zu bauen.
Während die Königinnen nun endlich aufbrachen, alle ihre Lakaien und Pagen, Zofen und Leibdienern mit sich nahmen, lauschte Ghenis die ganze Zeit auf einen jubilierenden Aufschrei, der aus Hunderten von Kehlen aufbranden sollte, sobald der Gott des Krieges sich seinen Soldaten zeigte. Er musste einfach erscheinen.
Sie straffte sich, grüßte die Königinnen zum Abschied, obwohl sie wusste, dass sie kurz vor der Abfahrt der Kutschen einen letzten Moment mit den beiden Herrscherinnen verbringen würde. Doch jetzt, da diese Sorge von ihr genommen war, galt es, sich mit den gewöhnlicheren Dingen auseinanderzusetzen. Die Generale würden vor Ghenis antreten, und sie würde einen aus deren Reihen zum Kommandanten der Stadtverteidigung ernennen. Natürlich nur so lange, bis göttliche Verstärkung erschien.
Um die Verantwortung beneidete Ghenis den Mann nicht. Auch wenn sie selbst ähnlich schwer zu tragen hatte.
Verflucht sei der Tag, an dem auf dem Übungsplatz ihre Deckung nicht gut genug gewesen, an dem der Speer ihrer Partnerin zwischen die Panzerstücke von Ghenis’ Rüstung gefahren war. Ghenis wusste, dass sie ohne diese Verwundung und deren Folgen einen guten General abgegeben hätte. Doch wenn sie selbst nicht in der ersten Reihe kämpfen, nur im Hintergrund als Bogenschützin Hilfe leisten konnte, dann reichte das nicht. Es genügte auch deswegen nicht, weil das Heer größtenteils aus Männern bestand, die es gewohnt waren, sich göttlicher – und überaus männlicher – Führung zu unterwerfen.
Sie erreichte das Portal zum Vorplatz, das Wächter ihr offenhielten. Als Ghenis auf die flachen Stufen trat und den Blick über die versammelten Truppen fliegen ließ, die hoffnungsvoll zu ihr sahen, ertönte der Alarm von den Wehren.
Dabei zog bereits die Abenddämmerung auf! Es schneite leicht, und der Wind blies eisig über Mardien Hald. Wie konnte jetzt ein Angriff erfolgen? Das feindliche Heer war doch gerade noch mit dem Lager beschäftigt gewesen, mit dem Errichten von Palisaden, dem Fällen von Bäumen! Es musste sich um einen Versuch handeln, nur eine Prüfung, wie gut die Verteidigung aufgestellt war.
Wie von einer fremden Macht gelenkt wandte Ghenis den Blick zum Tor. Dort begann die Straße aus dem Palastviertel durch die Stadt und über den stürmischen Fluss Mar, wand sich an Häusern und Werkstätten vorbei bis zum Stadtportal, das den Weg an Ackerland und Weiden, an Gehöften und Marktflecken entlang bis zu den Ufern des sanften Flusses Dien und über ihn hinweg zu den Bergen eröffnete. Dorthin würden die Königinnen sich zurückziehen, in ihrem Gefolge Landbevölkerung, die vor dem Feind floh und Schutz in den Höhlen finden würde. Dort sollte – musste – jetzt das große Pferd mit seinem kriegerischen Reiter erscheinen.
Doch der freigelassene Platz vor dem Tor blieb leer. Ein Beben stieg von Ghenis’ Fußsohlen auf, zitterte durch ihre Beine. Angst und Enttäuschung mischten sich mit Wut.
»Kanzlerin?«
Sie riss sich mit Gewalt los von der Erwartung, vor dem Tor im blau werdenden Licht der Dämmerung den roten Mantel wehen zu sehen. Es kostete mehr Kraft, als Ghenis erwartet hatte. Verdammt! Dabei waren die Verteidiger alles andere als hilflos!
Zwei der Generale. Und sie sahen ebenso verunsichert aus, wie Ghenis sich fühlte. Als ob sie alle mit einem Mal Waisen geworden waren.
Doch sie fasste die Männer fest ins Auge und war erleichtert, dass zumindest Leidan hier war. Ein Mann jenseits der Vierzig, der sich durch ständige Kritik an jeder Entscheidung hervortat, der nachdachte, bevor er den Mund aufmachte. Und der sich um seine Soldaten sorgte wie ein Vater. Genau der General, den sie nun brauchte, um die Stadt zu verteidigen.
»General Leidan, dir übertrage ich das Amt des Stadtkommandanten. Verteidige Mardien Hald, so lange es möglich und sinnvoll ist. Ich kümmere mich persönlich darum, die Königinnen in Sicherheit zu bringen.«
»Es ist Winter, Kanzlerin. Wie können die Angreifer jetzt einen Krieg beginnen?«
Die falsche Tageszeit, die falsche Jahreszeit. Niemand führte im Winter Krieg. Proviantzüge blieben im halbgefrorenen Boden stecken, verirrten sich im Schneefall. Verwundete erfroren, bevor ein Heiler sie erreichen konnte. Alles war falsch, und doch schienen die Angreifer alles richtig zu machen, da sie ihre Beute mehr als nur verwirrten.
»Ich weiß. Aber das ändert nichts daran, dass wir die Stadt und unser Reich verteidigen. Es wurde Alarm gegeben, General Leidan. Tu etwas! Warte nicht auf den Gott des Krieges. Er wird erscheinen, wenn er es für richtig hält. Bis dahin bist du sein Stellvertreter. Beweg dich, Mann!«
Leidan salutierte, obwohl Ghenis keinen militärischen Rang mehr innehatte. Nicht mehr.
Als Leidan zu den Männern stürzte und Befehle zu bellen begann, die nichts von seiner Verunsicherung offenbarten, erhielt Ghenis einen Moment Zeit für Angst und Zweifel, während ihr Blick wieder zu dem leeren Platz vor dem Tor zu der eigentlichen Stadt flog.
Die Götter selbst waren angegriffen worden. Natürlich halfen sie einander, verteidigten sich und konnten nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Erst musste der Angriff auf ihr Heim abgewehrt werden, bevor sie ihren Schützlingen auf der Erde zur Hilfe kamen.
Ghenis lauschte in den Äther. Sie schloss die Augen und dachte so konzentriert wie möglich mitten im Gewirr rennender Soldaten, klappernder Rüstungen und gellender Alarme von der Wehr an die Götter. Mütterliche Freundinnen, väterliche Beschützer. Ghenis ballte die Fäuste, versuchte sich vorzustellen, wie ihr eigener Hilferuf die Götter erreichte. Wie sich der Gott der Heilkraft erhob, nach seinen Arzneien und Verbandsmaterialien griff. Einmal schon hatte Ghenis an seiner Seite im Lazarett gearbeitet, und vielleicht hatte sie sich ein klein wenig in den älteren Gott verliebt, der so sanft und geduldig mit den Verwundeten umging. Ganz gewiss hatte er ihr Bein gerettet.
Doch noch wurden seine Hilfeleistungen nicht gebraucht. Noch war es nicht zum Zusammenstoß gekommen. Doch er bereitete sich ganz bestimmt auf seinen Einsatz vor.
Sie stellte sich vor, wie der Gott des Krieges seine Rüstung anlegte, hatte die Bilder so fest und sicher vor Augen, dass sie sich beinahe selbst überzeugte. Er musste unterwegs sein, seinen Schützlingen beizustehen. Sie roch nahezu das kalte Metall der Panzerung, das Fett, das zur Pflege verwandt wurde. Und dann verschwamm alles glutrot vor ihren Augen, als er den Mantel anlegte, herumwirbelte und panzerstarr und gefährlich zu den Menschen herabstieg.
Lärm umtoste Ghenis. Kriegsgeschrei von zwei Seiten einer Wehrmauer. Durch Kasernenhöfe und eine zweite Mauer vom Palastviertel getrennt, wo die Festung aufragte, die Mardien Hald beschützte. Verteidiger, die mit ihrem Gebrüll Angreifer einzuschüchtern suchten, damit es gar nicht erst zu einem Zusammenstoß an der Mauer kam. Gellendes Geifern von der anderen Seite.
Wer griff an und warum? Ghenis wusste es nicht. Noch einmal ordnete sie ihre Gedanken, presste sie in eine Form und mühte sich, sie durch den Äther zu senden, damit sie denjenigen erreichte, der in Mardien Hald bitterlich benötigt wurde.
Doch als Ghenis die Augen öffnete, war der Platz vor dem Tor immer noch leer. Keine Funken sprühten unter beschlagenen Hufen auf, keine schwarze Rüstung glitzerte vom Frost im Licht der Laternen.
Nur Schnee bedeckte den großen Hof zwischen Palast und Tor. Dicke Flocken fielen vom sich verdunkelnden Himmel und ließen die Spuren der Soldaten verschwinden, als wären die Männer niemals hier gewesen. Nur eine Erinnerung unter weißer Decke.
Ghenis atmete tief durch. Hier hatte sie bewirkt, was ihr möglich gewesen war. Nun galt es, die königliche Kavalkade in Bewegung zu setzen, falls dies noch nicht geschehen war. Ganz gewiss strömten schon Flüchtlinge durch das Tor zu den Bergen. Das Glück wollte es, dass Mardien Hald durch den breiten Fluss Mar zweigeteilt war. Innerhalb der Stadtmauern gab es genügend Brücken, um vom Palastviertel zum Portal zu gelangen. Doch außerhalb von Mardien Hald gab es nur ein paar Bauernfähren. Das feindliche Heer konnte so leicht nicht übersetzen, nicht in das Herz des Landes vordringen. Es sei denn, sie überrannten die Hauptstadt, die wie ein Korken einen Flaschenhals verschloss.
Hart klopfte der Stab auf den Boden, stäubte Schnee beiseite. Ghenis arbeitete sich behutsam über den gepflasterten Hof. Unter der weißen Decke lag Schneematsch, der nun langsam zu Eis gefror. Ghenis spürte, wie die Schneeflocken auch in ihrem Haar Halt fanden. Ihr Atem beschlug vor ihrem Gesicht zu dicken Wolken, und hinter ihr schwoll der Kampflärm immer mehr an.
Die Verteidiger hatten das Palastviertel verlassen, das wie ein Kirschkern inmitten der Frucht lag, diesseits des Mar umgeben von Kasernenhöfen und Werkstätten. Die Wohnbereiche der Stadt Mardien Hald lagen beinahe vollkommen auf der anderen Seite des Stroms. Auf der großen Wehranlage trafen nun die Soldaten der Königinnen mit denen der Eindringlinge zusammen. Ghenis wusste immer noch nicht, wer über die Grenzen gekommen war, um Mardien Hald anzugreifen. Doch Übergriffe waren in den letzten Jahrhunderten immer wieder vorgekommen. Zu große Bodenschätze gab es im Gebirge, zu reich lagen die Weiden und Äcker im Schutz der Hauptstadt. Überfluss zog seit jeher Neider an.
Wer es nun war, der seine Truppen wie Flutwellen an die Stadtmauer warf, konnte Ghenis auch später noch herausfinden. Nun hatte sie andere Aufgaben. Energisch schob sie die Gedanken an den fremden Feldherrn beiseite. Das hatte Zeit.
Ungebeten flatterte ein Bild aus ihrem Gedächtnis auf. Jener Tag, der sie für den Soldatendienst unfähig zurückließ, lag noch zwei Jahre in der Zukunft. Ghenis war eine vollwertige Kriegerin. Und als solche war sie mit ihrem Streitwagen im Gefolge des Gottes des Krieges in eine Schlacht gefahren. Bogenschützen hinter ihr, rechts und links, alle im Streitwagen, der sie rasch in Position fahren konnte. Ghenis entsann sich der schwarz gefiederten Schauer von Geschossen, die in das feindliche Heer niedergingen. Und wie eine Lohe inmitten der Krieger leuchtete der rote Mantel und wies den Truppen von Mardien Hald den Weg ins Herz der gegnerischen Armee. Direkt zu deren Oberbefehlshaber, der vor dem Gott des Krieges die Waffen streckte, bevor dieser ihn noch ganz erreicht hatte.
Hünenhaft und unbesiegbar, der muskulöse Körper durch die schwarze Rüstung noch betont, das Gesicht hinter den Streben eines Helms verborgen. Jeder Zoll an ihm hatte von Kraft gesprochen und jedes Herz mit Mut erfüllt.
Er fehlte im Hier und Jetzt, und Ghenis hoffte, dass der Angriff auf die Götter nicht bedeutete, dass der Gott gar nicht erscheinen würde. Sein Volk brauchte ihn!
Sie erreichte den Schutz eines kleinen Torhauses und atmete auf, da sie dem scharfen Wind dadurch entkam. Dann lächelte sie, als sie auf den Hof der weitreichenden Pferdestallungen blicken konnte. Dort stand nicht eine einzige Kutsche, doch im Schnee zeichneten sich noch die Radspuren ab. Die Königinnen mit ihrem Hofstaat waren unterwegs Richtung Gebirge. Gut, dass sie nicht auf Ghenis gewartet hatten. Eine Sorge weniger.
»Götter, ich danke euch, dass wenigstens dies ohne Schwierigkeiten vollbracht ist. Ich flehe euch an, über die Königinnen zu wachen, sie zu schützen und ihnen weiterhin Weisheit und Weitsicht zu verleihen.«
Keine Antwort. Aber das fand Ghenis normal. Lange nicht jedes Gebet zu den Göttern wurde auch beantwortet. Sie kannte die Geschichte des jungen Ehemannes, der auf Knien die Götter angefleht hatte, seiner Frau bei der Geburt beizustehen. Als er sich wieder aufraffte, um zitternd nach der Gebärenden zu sehen, der keine Hebamme hatte helfen können, beugte sich eine alte Frau über das Bett, im Arm das kleine Kind. Die Göttin der Fruchtbarkeit hatte den Hilferuf sofort auf ihre eigene Art beantwortet, keine Zeit verschwendet und Mutter und Kind gerettet.
Doch Ghenis mit ihrer Gabe vernahm oft eine leise wirkliche Reaktion auf ihre Gebete. Manchmal nur halb verständliche Silben, ein andermal beruhigende Worte. Aber jetzt herrschte absolute Stille im Äther. Stille, die Ghenis Angst lehrte, wie sie sie nie gekannt hatte. Selbst in dem Moment nicht, da ein Heiler ihr sagte, das Bein müsse abgenommen werden.
Sie lehnte sich schwer gegen die Mauer des Torhauses, entlastete für einen Moment das schmerzende Bein und überlegte fieberhaft, was es als Nächstes zu tun gab.
Dumpfes Pochen, das scheinbar selbst die Erde erbeben ließ, riss sie aus ihren Gedanken. Wie Donnerhall rollte das Geräusch über die schneebedeckte Stadt. Wie ein Steinfall in den Bergen, eine einstürzende Mine.
Ghenis atmete eiskalte Luft durch den Mund ein, spürte das Donnern in jeder Pore und jedem Knochen, in der alten Narbe ihres Beins.
Bei Schnee und Dunkelheit ein Überfall, und jetzt krönten die Angreifer ihre Bemühungen noch. Verflucht!
Drei Stunden später sah sich Ghenis zur Flucht gezwungen. Bombardement hatte die Wehrmauern so schwer beschädigt, dass die Generale die Stadt als verloren bezeichneten. In einem großartigen Schlachtengetümmel wollten sie sich dem Feind entgegenwerfen, um so die Flucht der Stadtbewohner zu decken. Doch Leidan war gefallen, wurde ihr gesagt, und Ghenis hatte sich entsetzlich gefühlt, als sie einen anderen General zum Stadtkommandanten ernannte. Und dann noch einen …
Ghenis verschaffte sich einen Überblick von den Zinnen des Palastturms aus. Ihr Herz sank. Eine letzte Schlacht? Eher ein blutiges Abschlachten der eigenen Truppen. Jeder Soldat, den die Generale vorwärtswarfen, konnte sich freuen, falls er noch fünf Atemzüge machen durfte, bevor er umgebracht wurde. Eine Verschnaufpause brachte dieser Ausfall niemandem. Es war unsinnig.
Doch nun war es an den Generalen, die Entscheidungen zu treffen, um den Feind so lange wie möglich aufzuhalten. Eine Kanzlerin, so ehrenvoll sie auch war und behandelt wurde, hatte nichts mehr zu melden. Das hatten die Männer Ghenis spüren lassen. Ebenso, dass sie in Mardien Hald schon seit Stunden als überflüssig empfunden wurde.
Ghenis war erschöpft. Bis zu dieser fatalen Nachricht hatte sie in der Stadt gewirkt, war durch Schneetreiben und über Eis gehumpelt, hatte Flüchtlingszüge organisiert und vor allem dafür gesorgt, dass im schlimmsten Fall dem Feind keinerlei Vorräte in die Hände fielen. Von wegen überflüssig! Nur in den Kasernen befanden sich noch Lebensmittel, die Rationen der Soldaten. Alles so verpackt, dass bei einem Rückzug jeder Mann Essen für vier Tage mit sich trug.
Doch all das schien nun vergebens. Die Stadt schien schon tot und aufgegeben. Die verwaisten königlichen Pferdeställe, die leer stehenden Bürgerhäuser waren nur die für Ghenis sichtbaren Zeugnisse. Nirgends ein Licht, keine Bewegung in den verschneiten Straßen mehr zu sehen.
Die Wehr brach unter dem Ansturm zusammen, und die Generale sahen keinen Ausweg mehr.
»General, ich habe die Zahlen unserer Gegner gesehen. Jeder unserer Männer wäre nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Tau in der Morgensonne, verdampft, bevor er auch nur einen Feind mit sich in den Abgrund ziehen kann.«
»Wir decken den Rückzug der Zivilbevölkerung, Kanzlerin. So lange es uns nur möglich ist, werden wir Mardien Hald und als letzte Verteidigungslinie den Mar halten und vor dem Eindringling beschützen.«
»Ihr verwandelt die Stadt in ein Schlachthaus für unsere eigenen Männer!«
»Kanzlerin, mische dich nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst.«
Blut schoss in Ghenis’ Wangen. Für einen Moment war sie fassungslos. Diese Generale wollten als Helden sterben und sahen das sogar als die Krönung ihrer Karriere und ihres Lebens an.
Doch einer beugte sich vor und sprach ganz leise und eindringlich: »Die Götter haben uns verlassen, flüstern die Männer. Sie haben Angst und fragen sich, was sie falsch gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie uns wirklich im Stich gelassen haben, Kanzlerin Ghenis, aber ich bin überzeugt, dass sie uns prüfen wollen. Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Mehr vermag kein Mensch. Da draußen auf der Wehr sind Heldentaten vollbracht worden. Und jetzt werfen wir alles vorwärts. Wenn dies auch eine Prüfung ist, wird der Gott des Krieges uns nicht länger alleine kämpfen lassen.«
Ghenis fand diese Gedanken unsinnig, unpassend, wenn sie an die Götter dachte. Sie wollte aufbegehren, schluckte die harsche Erwiderung jedoch. »Aber ich soll die Stadt verlassen?«
»Nur zur Sicherheit.«
Sie sprang auf, Schmerz im Bein, Eiseskälte in Magen und Brust.
»Du bist es, die eine direkte Verbindung zu den Göttern hat, Kanzlerin. Was hörst du?«
Nicht ein Laut aus dem Äther.
Sie stand alleine inmitten der Generale, war sich der lauschenden Meldeläufer an den Türen bewusst und hatte nur eine Antwort. Sie hörte nichts, seitdem die Schreie der Göttin verklungen waren, seitdem sie aufgehört hatte zu atmen.
Waren die Götter tot?
Unmöglich.
»Bring dich in Sicherheit, Kanzlerin. Hier kannst du nichts mehr bewirken. Schlag dich durch zu den Königinnen in der Felsenburg. Wir halten die Mauern so lange wie möglich.«
Es war ein winziger Haufen, der sich durch das Portal des Palastviertels in die verlassene Stadt schlich, Spuren im Schnee hinterließ, die nur wenige Atemzüge später durch frisches Weiß geschlossen wurden.
Ein Flüchtlingstross wartete kurz hinter dem großen Tor auf sie, hatte ein Meldeläufer Ghenis versichert. Sie hoffte, dass dies der Wahrheit entsprach. Denn zu Fuß würde sie ihre jämmerliche Flucht nicht lange durchhalten – geschweige denn die Felsenburg noch in diesem Winter erreichen!
Schmerzen zogen sich wie eisige Spinnweben durch das schwache Bein. Alleine der Stab, den Ghenis vor dem Abmarsch mit Lederstreifen umwickelt hatte, um ihm eine gewisse Tarnung zu verleihen, half ihr, nicht zurückzufallen. Sie trug nur leichtes Gepäck. Lebensmittel, ein Feuerstein, etwas Zunder. Eine Wasserflasche baumelte unter dem Kapuzenumhang am Gürtel. Ebenso ein Dolch. Für Bogen und Köcher hatte sie nicht mehr genug Platz und Kraft. Doch beides fehlte ihr. Mit dem Säbel mochte sie untauglich sein, doch einen Pfeil könnte sie in allergrößter Not auch im Sitzen abfeuern, wenn der Bogen nur klein genug war. Zu spät, nun befand sie sich jenseits des Palastviertels und hielt auf den Mar zu, der sich in rasender Geschwindigkeit durch sein gemauertes Bett wälzte und hoffentlich die letzte Verteidigungslinie darstellte. Sonst gab es nur noch den Dien …
Die Generale hatten ihr zwei ältere Soldaten mitgegeben, die wahrscheinlich tüchtig genug waren, um Ghenis durch das winterliche Reich zu schaffen, wenn ihre eigenen Kräfte dazu nicht mehr reichten. Dazu eine Handvoll Knechte aus den geleerten Stallungen und zwei Mägde aus dem Palast – wohl aus Rücksichtnahme einer Frau gegenüber, von der die Generale dachten, sie würde sich inmitten einer reinen Männergesellschaft unwohl fühlen. Ghenis verwünschte die Militärs dafür, denn die Mädchen hielten den kleinen Trupp auf. Die hätten schon vor Stunden fortgeschickt werden müssen, statt nun an Ghenis zu kleben.
Sie erschraken an jeder Ecke, wenn nur ein Fensterladen über ihnen klapperte. Außerdem trugen sie Berge an Gepäck mit sich. Ghenis argwöhnte, dass sie einiges aus dem Palast hatten mitgehen lassen.
Aus ihrer Soldatenzeit wusste sie, wie mit Plünderern umgegangen wurde. Doch irgendwie widerstrebte es ihr, ein Wort zu sagen, das eine Durchsuchung des Gepäcks und somit eine weitere Verzögerung bedingt hätte. Sie waren ohnehin viel zu langsam, denn hinter ihnen warfen sich jetzt die verbliebenen Truppen über die zerstörte Wehr den Feinden entgegen.
Ghenis hatte von der Turmzinne aus Banner in der Dunkelheit gesehen und zerbrach sich nicht erst seitdem den Kopf, wer der Angreifer sein könnte. Bis zu ihrer Flucht hatte ihr niemand Nachricht gebracht, welche Zeichen auf den Fahnen des Feindes zu erkennen waren. Die Männer an der Kampfeslinie hatten Wichtigeres zu tun, für die bedeutete es keinen Unterschied, Namen zu erkennen. Doch Ghenis lenkten diese Überlegungen von den Schmerzen im Bein und dem eisigen Wind ab, dem sich nun das Rauschen des Flusses anschloss.
Der breite Strom teilte die Stadt. Brücken verbanden die beiden Ufer, doch nach dem Willen des Militärs gab es nur noch eine einzige, die ein sicheres Übersetzen möglich machte. Alle anderen waren absichtlich beschädigt worden, um die feindliche Armee im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen zu lassen, sollte sie den Mar überqueren wollen.
Schwarz wälzte der Strom sich durch sein Bett aus gemauerten Ziegelsteinen, was die Geschwindigkeit des Wassers noch erhöhte. Weiße Schaumkronen blitzten in der Dunkelheit, als Ghenis’ Gruppe sich vorsichtig über die verschneite Brücke bewegte.
Es knirschte unter den Stiefeln, Frost härtete die weichen Flocken, ließ sie harsch zu Eis erstarren. Ghenis kämpfte um rasche Fortbewegung. Unter dem Schnee lagen die Pflastersteine mit einer glitschigen Eisschicht bedeckt, die jeden Schritt zur Gefahr machte. Die Fingerkuppen wurden taub vor Kälte, da Ghenis sich mit einer Hand am steinernen Brückengeländer festhielt und sich gleichzeitig schwer auf den Stab stützte.
Die Stadt lag in Dunkelheit, nur hinter den einsamen Wanderern leuchtete es rot und golden von der Schlacht, die ohne Rücksicht auf Verluste oder gar Wetter und Jahreszeit nun bis in die Nacht hinein wütete und alles verschlang, was ihr in den Weg kam.
Eines der Mädchen schrie auf und wies in die schwarzen Fluten, die sich rasch unter der Brücke hinweg wälzten. Ghenis’ Blick folgte dem ausgestreckten Zeigefinger. Dort trieb eine Leiche, halb unter Wasser, nur als grober Umriss erkennbar. Unmöglich zu bestimmen, aus welchem Heer der Mann stammte. Wenn es denn ein Mann war.
Ein zweiter Körper trieb vorbei, während Ghenis sich noch über die Brüstung beugte und dem ersten nachsah. Dann erblickte sie direkt auf dem gemauerten Weg, der links und rechts den Kanal flankierte, einen großen, dunklen Schatten.
Gleichzeitig mit den Mädchen, wie es schien, denn beide umklammerten einander und keuchten entsetzt auf. Oder sie hatten noch etwas anderes gesehen, wer konnte das schon so genau sagen.
»Kanzlerin, da unten …«, begann einer der beiden Soldaten.
»Ich sehe es. Im Wasser treiben Tote, und da scheint noch einer zu liegen. Auf der Seite des Flusses, die sicher sein sollte. Ich will das überprüfen.«
»Wir sollten rasch zum Tor«, erwiderte er drängend.
»Mit ein wenig Nachdenken sollte dir klar sein, dass das jemand von uns sein muss. Ich lasse niemanden, in dem vielleicht noch ein Rest Leben steckt, in dieser Nacht im Schnee liegen. Ist es ein feindlicher Soldat, der sich knapp aus dem Wasser hat retten können, darfst du ihm gerne den Rest geben. Aber wenn er zu uns gehört, wird er nicht dort liegen und erfrieren, nur weil wir feige sind, verflucht!«
Sie stapfte an dem Soldaten und seinem Kameraden vorbei, rutschte einmal fast aus, als sie auf schieres Eis trat, und meisterte den Abstieg auf der angeblich sicheren Seite der Brücke trotzdem, ohne zu stürzen.
Sie umrundete den Brückenpfeiler und gelangte auf den gemauerten Weg. Mit jedem Schritt, den sie näher an den dunklen Schatten ging, erschien die Gestalt ihr größer. Eindeutig ein Mensch, noch eindeutiger ein Mann. Ghenis kannte keine Frau solcher Körpergröße.
Dann entdeckte sie, dass der Schnee rund um die hünenhafte Gestalt zum Teil geschmolzen war. Der Mann musste sich tatsächlich aus dem Fluss gezogen haben und hier zusammengebrochen sein.
Sie erblickte einen Umhang, der von Raureif und Eis bedeckt war. Lange, muskulöse Unterschenkel in schwarzem Leder, eine große Hand, die wie Halt suchend in den Schnee gekrallt war. Und unter dem Kerl eine Pfütze …
Ghenis atmete scharf ein und bereute es sofort. Sie hielt sich eine Hand vor den Mund, als das ganz besondere Aroma von Erbrochenem sich den Weg in ihre Lungen suchte und dort festsetzte.
Der Soldat, der vor wenigen Momenten noch ihre Weisung hatte anfechten wollen, eilte an ihr vorbei und kniete neben dem großen Mann nieder, in der Hand bereits den blanken Dolch. Der Soldat streckte die Hand aus, legte sie auf den frostbestäubten Mantel, und der Hüne am Boden stieß ein leises Knurren aus, halb ein Stöhnen. Er wandte den Kopf, und die Kapuze rutschte beiseite, gab unter einem grauen Pelzbesatz ein blasses Gesicht frei. Dunkle Augen, die wie nasse Kohlen schimmerten, richteten sich mit einem eindeutig fragenden Ausdruck auf das Gesicht des Soldaten.
»Kannst du gehen? Die Stadt wird überrannt«, sagte Ghenis und wunderte sich, wie ruhig ihre Stimme klang.
Der dunkle Blick flog zu ihr, heftete sich auf ihr Gesicht, und tief in Ghenis stieg Wärme auf – wie angesichts eines tapsigen Hundewelpen.
Große Augen, lange Wimpern und eine solche … Unschuld in diesem Blick, der unsicher und verwirrt schien.
Doch der Fremde nickte nach einem Wimpernschlag und machte mühevolle Anstalten, sich aus der Dreckpfütze zumindest auf Hände und Knie zu stemmen. Er war vollkommen durchnässt von Erbrochenem und geschmolzenem Schnee, und Ghenis wusste, wie heftig er frieren würde, bis der Frost die Feuchtigkeit aus seiner Kleidung gezogen hatte, nachdem sie zuerst steif wie ein Brett an dem Mann kleben würde.
Der Soldat sprang auf und trat einen Schritt zurück, offenkundig nicht bereit, dem Fremden zu helfen. Doch in gewisser Weise tat er das Richtige. Wenn der große Kerl nicht alleine gehen konnte, würden sie alle ihm helfen müssen – oder ihn in der fragwürdigen Sicherheit eines Kellers zurücklassen. Doch es war nicht mehr weit bis zum Tor, wo der Flüchtlingstross warten sollte.
Ghenis fühlte, wie ihr Mund trocken wurde, als sie den qualvollen Bemühungen des Mannes zusah, wie dieser sich vor ihren Augen in die Senkrechte stemmte und scheinbar immer größer wurde.
Bis er sich vorbeugte, eine Hand auf seine Bauchdecke gepresst, und keuchend nach Atem rang, bevor er trocken würgte. Es klang schmerzhaft, und Ghenis spürte wie aus reinem Mitgefühl ebenfalls Brechreiz in ihrer Kehle kitzeln. Dazu kam der Gestank, der von dem Mann und seiner Kleidung ausging.
Entweder war der große Kerl halb ertrunken gerade noch an Land geklettert – oder er war ein Säufer.
Ghenis’ Kiefermuskeln spannten sich an. Gleichgültig. Er war vor allem ein riesiger Kerl, dessen Muskelmassen selbst unter dem nun gefrierenden Umhang gut auszumachen waren. Wenn er sich erholt hatte oder vollkommen ausgenüchtert war, würde er sich schon nützlich machen können. Obwohl der Kerl sie bei Weitem überragte, fand Ghenis die Sicherheit, ihm Schnaps jeder Art sicher vorenthalten zu können.
»Wir müssen weiter«, sagte der Soldat, und Ghenis bemerkte, dass er soeben die Anrede als Kanzlerin umging. Nicht aus Unhöflichkeit, wie sein Blick ihr bewies, denn in diesem lag nichts Anmaßendes. Der Soldat traute dem Hünen nicht, und angesichts des Größenunterschiedes, obwohl Letzter mit nach vorne gezogenen Schultern und leicht gekrümmt dastand, konnte Ghenis es dem Soldaten nicht verdenken.
»Ich weiß.« Ghenis wandte ihre Aufmerksamkeit von dem Soldaten auf den Neuzugang. »Du, wie heißt du?«
Ein kurzer Moment des Zögerns, eine angestrengt gerunzelte Stirn, was den verwirrten Gesichtsausdruck noch verstärkte. Verflucht, hatte der Kerl sich vollkommen um den Verstand gesoffen?
»Teiro.« Eine tiefe Stimme, wie gemacht, um Befehle über einen Kasernenhof oder ein Schlachtfeld zu brüllen. Und doch eine Sanftheit in dem vollen Klang, die Ghenis an ihren ersten Lehrer erinnerte, der ihr Zahlen und Buchstaben beigebracht hatte.
»Gut, Teiro. Du wirst mit uns Schritt halten müssen. Wir müssen dringend weiter.«
Er nickte und bemühte sich, sich gerader aufzurichten. Tatsächlich fiel er nicht zurück, als die Gruppe zur Brücke zurückkehrte und wieder auf die Straße fand.
Ghenis behielt alle Anwesenden scharf im Auge. Die Mädchen hielten sich dicht beieinander und schienen trotz aller Gefahr, in der die kleine Gruppe schwebte, aufgeregt miteinander zu tuscheln. Von allen Mägden des Palastviertels hatte der General Ghenis ausgerechnet zwei dumme Hühner mitgegeben. Nun, das waren wahrscheinlich die Letzten, die sich noch im Gebäude befunden hatten, weil sie zu dämlich gewesen waren, von sich aus die Flucht zu ergreifen. Oder weil sie zu sehr damit beschäftigt gewesen waren, Schubladen und Kommoden zu durchstöbern.
Die Knechte verhielten sich still und wollten ganz offensichtlich die bisherige Marschgeschwindigkeit erhöhen. Sie wirkten auf Ghenis wie junge Hasen, die hastig davonrannten, kaum dass ein Jagdhund sich zeigte.
Sie warf einen Blick zurück über die Schulter, wo Flammenrot die Nacht erhellte. Lagen die Verteidiger bereits tot auf der zusammengestürzten Wehr? Oder wurde dort wirklich noch gekämpft? Standen vielleicht nur noch die Mauern des Palastviertels zwischen den Angreifern und dieser kleinen Schar Flüchtlinge? Und der Fluss Mar, über den nur noch eine einzige Brücke führte?
Trotz der Schmerzen im Bein gab Ghenis sich Mühe, etwas schneller zu gehen. Hart klopfte der Stab auf den Boden, und bei jedem Schritt meinte sie, sich etwas schwerer darauf stützen zu müssen.
Sie nahm links von sich den gewaltigen Schatten wahr, der Teiro war. Seine Kleidung knirschte, sie war schon gefroren. Der große Mann ging leicht vornübergebeugt, klang atemlos und stank zum Steinerweichen. Einmal stützte er sich mit einer Hand an der Fassade eines Hauses ab, würgte und erbrach sich erneut. Wie viel Flusswasser hatte er geschluckt? Oder wie viele Flaschen Schnaps?
Der Soldat führte sie von der Hauptstraße fort in eine Nebengasse.
»Was soll das?«, fragte Ghenis, die sich über den solcherart unvermeidlichen Umweg überhaupt nicht freute. Verflucht, sie wusste noch nicht einmal, wie sie den geraden Weg zum Tor bewältigen sollte. Außerdem war das Ausweichen in Nebenwege Unsinn. Der Wind verwirbelte den Schnee und ließ jegliche Spur unter frischem Weiß verschwinden. Abgesehen vielleicht von den feuchten Flecken, die von Teiros zurückgelassenen Mageninhalten herrührten.
»Ich möchte nicht auf jener Linie gehen, die auf direktem Weg vom Fluss zum Tor führt. Falls sie über Reiterei verfügen, holen sie uns allzu leicht ein und rennen uns in Grund und Boden.«
»Wir verlieren Zeit. Die Flüchtlinge werden nicht ewig warten.« Noch vernahm Ghenis keinerlei Lärm, der auf direkte Nähe der Verfolger hinwies. Sie stapfte durch den Schnee und ärgerte sich über den Umweg. Nur eine längere Diskussion hätte noch mehr Verzögerung bedeutet.
Sie rutschte auf verborgenem Eis aus, unterdrückte einen lauten Fluch und rang um ihr Gleichgewicht, als eine große Hand sich wie eine Stahlklammer um ihren Oberarm schloss und ihr Missgeschick ausglich. Ghenis starrte zur Seite und sah direkt in Teiros dunkle Augen. Umgehend ließ der große Kerl sie wieder los, und sie konnte weitergehen. Nun war er ihr so nahe, dass sie sich ein kurzes, leises Gespräch erlauben konnte, ohne Gefahr zu laufen, mögliche Verfolger auf sich aufmerksam zu machen.
»Du bist in den Fluss gefallen? Wo? Wer war dein Hauptmann?«
Wieder runzelte er die Stirn und schien angestrengt nachzudenken. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Ich weiß es nicht.«
Ghenis hämmerte den Stab auf den Boden, um ihrer Ungeduld Ausdruck zu verleihen. Ein Fahnenflüchtiger, ganz wundervoll. Angesichts des Feinds und der bevorstehenden Erstürmung von Mardien Hald in eine dunkle Ecke verkrochen, Schnaps in sich gekippt und dann besoffen in den Fluss gefallen. Er schien auch keine Rüstung unter dem Umhang zu tragen. Ghenis war sich sicher, dass sie deren Klirren hätte hören müssen. Sie fasste den Hünen erneut fest ins Auge und schätzte ihn ab. Er musste einfach ein Krieger sein! Zu groß und schwer, als dass die Beamten ihm erlaubt hätten, trotz seiner offensichtlichen Beschränktheit weiter als Handwerker oder Bauer zu arbeiten. Solche Männer zog das Heer stets als Erste ein.
Im Ernstfall würde er sich schon bewähren. Falls er nur Ballast für die kleine Truppe darstellte, konnte Ghenis den großen Kerl auch bei einem Bauernhof aussetzen. Schweine sollte er füttern können.
Er wandte sich ab, stolperte zu einer dunklen Hausecke, und erneut hörte sie ihn würgen. Irgendwann musste er den ganzen Dreck doch los sein!
Im gleichen Moment erklangen ein unwirkliches Krachen und Getöse, und Schreie gellten zum grauschwarzen Firmament.
Ghenis lächelte böse und beschleunigte ihre Schritte. Die Eindringlinge hatten das Palastviertel überwunden und den Fluss entdeckt. Da konnten sie so leicht und schnell nicht übersetzen. Der breite Strom floss mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt und würde alles fortreißen, was er in die Fänge bekam. Mitunter erinnerte der Mar Ghenis an ein großes Raubtier mit immerwährendem Hunger. Trümmer und Ertrinkende nahm er nun mit sich, und gewiss würde dieses Treibgut auch die nächste Brücke zum Einsturz bringen. Wenn diese Stadt den Feinden schon in die Hände fallen musste, dann sollten sie herzlich wenig Freude an ihr haben!
Um eine enge Kurve herum, und dann konnte Ghenis schon die Stadtmauer über den Häuserfirsten aufragen sehen. Sie blickte sich nach Teiro um und atmete leise auf, da er wieder zu ihr aufgeschlossen hatte. Doch dann erstarrte Ghenis und drehte sich vollends um. Die Mädchen waren fort. Sie zählte hastig ihre übrigen Begleiter. Die Soldaten waren beide noch da, aber nur noch drei Knechte hielten sich eng bei den beiden Männern.
»Wir sind nicht mehr komplett.«
»Das ist mir egal«, erklang die geknurrte Antwort. »Ich habe den Auftrag, dich zu einem Flüchtlingstross zu bringen. Alleine das zählt. Wenn die dummen Gänse nicht mithalten können, ist das ihr Problem.«
»Auch die Knechte …«
Der Soldat wandte sich um. Ghenis sah in ein blasses Gesicht, in das Furcht in harten Linien eingemeißelt worden war. »Kanzlerin. Bitte. Sie versuchen, den Fluss zu überqueren. Selbst der Mar wird sie nicht für immer aufhalten. Du kannst kaum noch gehen. Ich will dich sicher auf einem Wagen wissen.«
Ganz leicht drehte Teiro sich und sah Ghenis an. Wie benebelt er auch sein mochte, die Amtsbezeichnung hatte er vernommen.
Ghenis biss sich auf die Unterlippe, um keine harsche Antwort zu geben. Die Sturheit des Soldaten rührte sie in gewisser Weise. Doch hatte man sie während ihrer Ausbildung in der Kaserne auch Leitsätze gelehrt, die im Augenblick selbst Teiro zugutekamen. Ein Soldat ließ einen Kameraden nicht zurück. Die Gruppe hielt zusammen. Jeder half dem anderen. Wenn das nicht mehr galt, was hatte dann noch Bestand?
2.
Schneetreiben in der Nacht
Teiros Körperhaltung veränderte sich leicht. Er richtete sich gerader auf und nickte dem Soldaten zu. »Weg hier.«
»Mein Reden«, stimmte der Mann mit allen Anzeichen der Erleichterung zu, dass jemand seine Partei ergriff.
Ghenis nickte ergeben. Sie fühlte sich mit einem Mal sehr müde und schwach. Kalt nistete der Schmerz in ihrem Bein, kroch hinauf bis in die Magengrube.
Es blieb natürlich an dem stinkenden Hünen, einen Arm um Ghenis’ Mitte zu legen und sie zu stützen. Jetzt erst begriff sie, wie sehr sie den Trupp trotz aller Mühe aufgehalten hatte, denn nun rannten sie beinahe die Gasse entlang, die sich in Richtung der Stadtmauer zwischen alten Häusern wand. Über ihnen berührten sich beinahe die Dachgiebel der nahe beieinanderstehenden Gebäude, raubten das letzte Quäntchen Sternenlicht, das den Weg hätte weisen können. Gnädigerweise verschluckten die Schatten über ihnen auch das Rot der Feuer. Ghenis beschloss, für Kleinigkeiten dankbar zu sein.
Beinahe lautlos stolperten sie im Laufschritt weiter. Unrat und Schuppen versperrten hin und wieder den Weg. Einmal mussten sie einen aufgegebenen, schneebedeckten Karren umrunden, der die Gasse beinahe vollkommen blockierte.
Ghenis bekam Seitenstechen und verfluchte leise den Umstand, dass sie ungeübt und diese Geschwindigkeit einfach zu viel war. Außerdem hüllte der Gestank aus Teiros Kleidung sie ein, machte das Atmen zu Schwerstarbeit. Alleine in ihrer Vermutung, dass er ein Krieger sein musste, sah sie sich angesichts des Arms um ihre Mitte bestätigt. Und in der Annahme, dass der Kerl ungerüstet war. Nichts passte zusammen. Würde ein Fahnenflüchtiger wirklich seine Ausrüstung und Bewaffnung von sich werfen? Vielleicht, weil er dann schneller fliehen könnte. Unwahrscheinlich, da er dann im Notfall wehrlos wäre.
Sie stieß sich das Schienbein an einem Holzkasten, verlor beinahe den Stab aus der von der Kälte tauben Hand und wurde angehoben, über ein Stück blankes Eis getragen, bevor Teiro ihr Bodenkontakt gestattete und ihr somit zumindest den Anschein von eigener Leistung wieder ermöglichte.
In dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit flog der Trupp um eine Biegung der Gasse – und blieb wie angenagelt stehen.
Feuerschein begrüßte sie. Fackeln. Doch kein Flüchtlingszug, der zitternd in der Kälte ausharrte, um die Kanzlerin willkommen zu heißen. Auf dem kleinen Platz vor dem Torkastell standen Soldaten in fremder Rüstung. Eine komplette Abteilung von mindestens fünfzig Männern, die das Tor in ihre Gewalt gebracht hatten. In den angrenzenden Häusern trieben sich weitere Gegner herum, plünderten oder suchten nach Leuten, die sich versteckt hatten, statt zu fliehen. Oh, verflucht, wie hatten die den Weg hierher so rasch gefunden? Wie den Fluss überquert und das Tor einnehmen können?
Einer der Knechte wirbelte herum und rannte den Weg zurück, den sie gekommen waren.
Teiro und die beiden Soldaten standen einen Moment still da und schienen fieberhaft zu überlegen. Ein Angriff auf diese Truppe war Selbstmord. Es waren zu viele.
Niemand sagte ein Wort, aber dann zog der geschrumpfte Trupp sich wie auf ein geheimes Signal lautlos ein Stück in die Gasse zurück, bis ein dunkler Torbogen erreicht war. Sechs Leute waren sie nur noch!
Ghenis verspürte das unsinnige Verlangen, in eines der Häuser zu gehen, sich ein Versteck in einer sehr dunklen Ecke zu suchen und zu schlafen. Entweder, bis das Bein nicht mehr wehtat, oder bis die Feinde sie entdeckten. In keinem Geschichtsbuch fand sich eine Erzählung solch aussichtsloser Lage. Die Geschwindigkeit war das Erschreckende. Kein Heer sollte so rasch eine Stadt einnehmen, sich in ihr orientieren und den Verteidigern immer einen Schritt voraus sein.
Fest presste Ghenis die Zähne zusammen, bis sie schmerzten. Hielt sich am Stab fest und suchte nach einer Möglichkeit, die Stadt doch noch zu verlassen. Alles andere käme einer Kapitulation gleich, und Ghenis hatte nicht vor, so leicht und schnell aufzugeben. Auch wenn der Gedanke an ein halbwegs warmes Versteck verlockend blieb und die Erschöpfung noch weiter verstärkte.
»Kennst du dich in der Stadt aus?«, fragte der Soldat Teiro, und natürlich schüttelte dieser wieder nur den Kopf.
Jetzt, da sie zur Ruhe kamen und einen Moment herumstehen mussten, fühlte Ghenis das Beben der gewaltigen Muskeln neben sich. Und bemerkte, dass Teiro wieder die Hand auf seine Magengrube presste. Seine Kiefermuskeln waren angespannt, und er wirkte blasser als noch vor wenigen Augenblicken.
»Sie sind zu schnell. So etwas habe ich noch nie erlebt. Aber endlich hatte ich genug Licht, um zu sehen, was auf den Bannern ist.« Der Soldat flüsterte nur, was angesichts der Nähe zu den feindlichen Truppen auch angeraten war.
»Später«, wisperte Ghenis als Antwort. »Wir müssen weiter.« Doch wohin? Es gab nur das eine große Tor zum Weideland und dem Gebirge. Doch gewiss musste es kleinere Pforten geben, oder?
Die Männer gehorchten. Langsam ging es durch den Torbogen in eine noch engere Gasse, in der Schnee sich hoch auftürmte.
Teiro wurde langsamer, suchte mit der freien Hand immer wieder Halt an einer Mauer. Seine Atmung wurde schärfer, blieb aber lautlos. Kleine, weiße Wolken markierten seinen Weg dadurch. Noch half der Hüne Ghenis, doch hatte sie das beängstigende Gefühl, dass seine Kraft verrann wie Sand in einer Uhr. Das war doch lächerlich! Sie konnte noch gehen, warum brach er fast zusammen?
»Wir suchen eine kleine Pforte. Es wird doch wohl einen weiteren Ausgang geben«, zischte sie kaum hörbar.
Die Soldaten reagierten nicht einmal, sondern trotteten nebeneinander her durch die Schneeverwehungen. Die Hausfronten sahen abweisend aus mit verriegelten Fenstern und Türen. Hin und wieder stand eine Pforte offen, doch war es zu dunkel, als dass Ghenis etwas im Inneren des Hauses hätte erkennen können.
Es fühlt sich wie ein Albtraum an, als würde sie in einer vollkommen verödeten Welt einen Weg suchen, nur um in einer Sackgasse nach der anderen zu landen. Als gäbe es keine Menschen mehr, hinfort gefegt vom Schnee … oder nächtlichen Ungeheuern. Sie kämpfte sich durch Verwehungen, in denen sie bis weit über die Knie versank. Selbst die Männer sahen aus wie Schatten von Menschen. Als könnte sie die Hand ausstrecken und durch die Gestalt greifen und nur kalte Luft spüren. Diese unsinnigen Gedanken mussten in Schmerz und Erschöpfung wurzeln, sagte Ghenis sich und versuchte, die wirren Bilder abzuschütteln.
Neben ihr brach unvermittelt Teiro in die Knie, rang nach Atem und erbrach rostfarbenen Schaum, der den Schnee sprenkelte. Zu Ghenis ehrlichem Erstaunen nahm sie keinerlei Alkoholdünste wahr.
Die Unterbrechung war Ghenis willkommen, auch wenn sie sich deswegen erbärmlich fühlte. »Du hast das Banner erkannt?«, fragte sie den Soldaten, der stehen blieb und mit einer Mischung von Abscheu und Angst den würgenden Teiro musterte. Als würde er abschätzen, wann der Hüne still im Schnee liegen blieb.
»Ich hab einen schwarzen Eber darauf erkannt.«
Ghenis dachte fieberhaft nach, wollte diese Erkenntnis im ersten Augenblick fortwischen, weil es zu unglaubwürdig klang. Zwischen ihrer Heimat und dem Reich Rantos, das den Keiler im Wappen führte, lag noch ein weiteres Reich: Lelwinien. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Nachbarn – und Bündnispartner – Rantos freies Geleit durch ihr Reich gewährt haben. Und wenn sie angegriffen worden wären, hätten wir Nachricht bekommen.« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Nein, du hast recht. Sie sind so unheimlich schnell. Sie können Boten, die uns warnen sollten, abgefangen haben.«
Zu schnell. Sie sollte sich glücklich schätzen, dass sie sich noch in der Stadt befand. Denn außerhalb der Mauern war die Jagd eröffnet worden. Nur auf eine kleine Kanzlerin? Oder auf die Königinnen? Götter, waren Alrona und Kenia rechtzeitig fortgekommen? Reichte die Geschwindigkeit ihres Trosses, dass sie das Gebirge erreichten oder zumindest den Dien überquerten, bevor die Truppen von Rantos sie einholten?
Es gab für Ghenis nur einen Weg: raus aus der Stadt. Hier würden die feindlichen Truppen sie vielleicht aufspüren. Ganz gewiss würden sie die Stadt plündern und dann irgendwann – ob sie sie nun suchten oder nicht – über die Kanzlerin stolpern. Was ihr dann bevorstand, mochte Ghenis sich nicht einmal ansatzweise in Gedanken ausmalen. Dafür wusste sie zu viel vom Soldatendasein und den speziellen Truppen, die wohl jeder Heerführer hinter den Reihen zurückhielt, bis es einen unglücklichen Gefangenen zu befragen galt.
Sie schluckte hart.
Neben ihr würgte Teiro schmerzhaft, als zerrisse es seine Innereien. Zitternd ließ er sich auf die Fersen sinken, rang nach Atem und gab sich dann Mühe, wieder auf die Beine zu kommen. Sie konnte ihm nicht einmal die Hand reichen, denn er würde sie von den Füßen reißen. Sie konnte nur hoffen, dass er bald alles los war, was da in seinem Magen rumorte.
Ghenis fragte sich, wie viel von der Unterhaltung Teiro gehört hatte, während er Schaum in den Schnee gekotzt hatte. Und wie viel er begriffen hatte.
»Eine Pforte. Es muss eine geben.«
»Es besteht die Möglichkeit, dass wir uns im Schatten eines Turmes abseilen«, sagte Teiro unvermittelt.
Ghenis starrte ihn fassungslos ein. Er hatte offenbar mehr mitbekommen, als sie gedacht hätte. Oder die Pause auf Knien zum Denken benutzt. Ob seine Idee ihr gefiel, war eine ganz andere Sache.
Der Soldat erteilte den Knechten geflüsterte Befehle, und die Jungen rannten den Weg voraus.
»Kanzlerin, wir kommen über diese und ein paar andere Gassen an die Mauer. Sogar an einen Turm. Die Jungen sehen zu, dass sie Seile finden und ob der Turm noch nicht eingenommen wurde.«
»Du willst uns wirklich abseilen?«
»Die bisher beste Idee, die ich gehört habe. Wenn dir etwas anderes einfällt außer der Suche nach einer Pforte, was uns einfach zu viel Zeit kostet, lass es mich hören. Mardien Hald ist eine Festung. Jede Pforte ist eine verkleinerte Ausgabe der Stadttore und von Weitem zu erkennen. Unsere Feinde sind schnell. Und offenkundig sind sie auch nicht dumm, Kanzlerin.«
Ghenis schoss einen zornigen Blick zu Teiro, der unter dieser stummen Anklage tatsächlich ein wenig kleiner wurde und wie verlegen auf seine Stiefelspitzen blickte. Dieses zu groß geratene Gaffobjekt mit dem Magen einer Schwangeren! Er hatte es geschafft, dass der Soldat indirekt Ghenis der Dummheit bezichtigt hatte! Das würden beide noch büßen, verflucht.
Ein Soldat und ein Knecht standen im Schatten des Turms jenseits der Stadtmauer im Schnee und drückten sich fest gegen das Mauerwerk. Sie mussten sich mehr als unbehaglich dort unten fühlen. Wie auf einem Silbertablett wachsamen Gegnern ausgeliefert.
Ghenis überprüfte ein letztes Mal den Knoten, der für ihre Sicherheit garantieren sollte. Sie fürchtete sich davor, dass das Seil womöglich auf halbem Wege losgelassen werden könnte.
Denn wozu verfügte die Gruppe über einen Bären von Mann, der scheinbar ohne die geringste Mühe schon zwei Gefährten abgeseilt hatte, die nun unten als Empfangskomitee und Wachen standen, um die Kanzlerin entgegenzunehmen? Während oben ein Soldat und ein Knecht ebenfalls Wache standen? Sodass nur Teiro blieb, um Ghenis am Seil baumelnd nach unten zu schaffen? Verflucht!
Das Seil schnitt in ihr Fleisch, das Bein schmerzte so sehr, dass Ghenis ihre Begleiter nur noch anschreien wollte. Der Stab erwies sich als hinderlich und sperrig, doch um nichts in der Welt wollte Ghenis ihn zurücklassen. Er war nicht nur Zeichen ihres Amts und ein guter Spazierstock. Im Notfall stellte er außer dem Dolch die einzige Waffe dar, die sie in Reichweite hatte. Wenn es dem tumben Hünen gefiel, ohne Waffen durch die Welt zu spazieren und Gefahren mit seinem verfluchten Kinderblick und nichts weiter zu begegnen, so musste das noch lange nicht auf Ghenis zutreffen!
Seine Hand lag beruhigend fest um ihren Oberarm, als sie über die Zinnen kletterte, die brüllende Qual im Bein so gut wie möglich ignorierte und sich des langen Wegs nach unten beständig bewusst war.
Dann schnitt das Seil noch härter ein, Ghenis’ Füße rutschten von der Mauer ab, und sie baumelte in der Luft. Mit der freien Hand tastete sie nach Fugen im eiskalten Stein der Wehr.