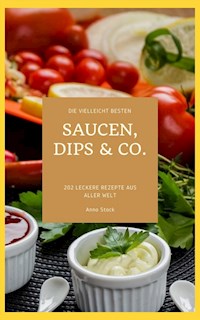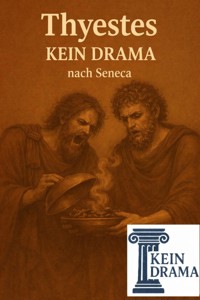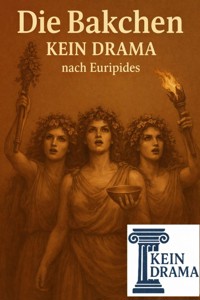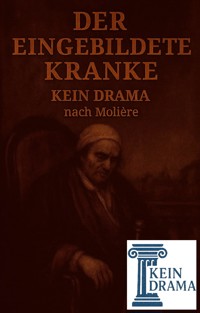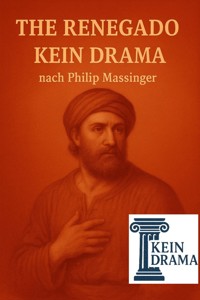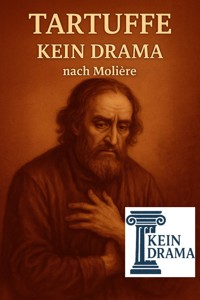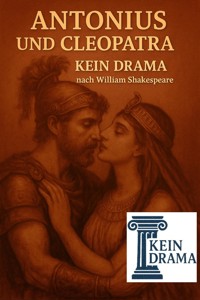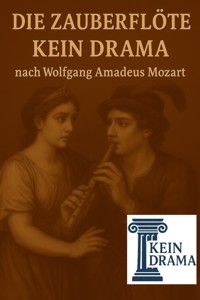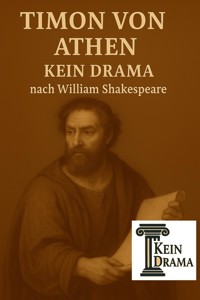
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Timon von Athen ist der großzügigste Mann seiner Stadt. Er verschenkt sein Vermögen an Freunde, finanziert Künstler, rettet Schuldner aus dem Gefängnis. Seine Feste sind legendär, seine Güte grenzenlos. Doch als sein Gold zur Neige geht und er selbst Hilfe benötigt, erlebt er eine bittere Wahrheit: Keiner seiner Freunde steht ihm bei.Verraten und ruiniert, flieht Timon in die Wildnis. Aus dem Philanthropen wird ein Misanthrop, aus bedingungsloser Liebe wird abgrundtiefer Hass. In seiner Höhle, fernab der Zivilisation, verflucht er die Menschheit und alles, wofür sie steht. Doch auch hier findet er keine Ruhe – Besucher kommen, jeder mit seinen eigenen Motiven, und zwingen Timon, sich der Frage zu stellen: Ist die Welt wirklich so korrupt, wie er glaubt? Oder hat sein eigener Idealismus ihn blind gemacht?Eine zeitlose Geschichte über Freundschaft und Verrat, Großzügigkeit und Habgier, Hoffnung und Verzweiflung – nach William Shakespeares düsterem Meisterwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Timon von Athen - Kein Drama nach William Shakespeare
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Kapitel 1: Das Fest der Freundschaft
Kapitel 2: Der Poet und der Maler
Kapitel 3: Ventidius' Befreiung
Kapitel 4: Lucullus, Lucius und die anderen
Kapitel 5: Flavius' Sorgen
Kapitel 6: Die leeren Kassen
Kapitel 7: Die Boten
Kapitel 8: Lucullus' Ablehnung
Kapitel 9: Lucius und die anderen
Kapitel 10: Das letzte Bankett
Kapitel 11: In der Wildnis
Kapitel 12: Das Gold im Boden
Kapitel 13: Alcibiades' Feldzug
Kapitel 14: Apemantus' Besuch
Kapitel 15: Die Kurtisanen und das Gold
Kapitel 16: Die Senatoren
Kapitel 17: Flavius' Treue
Kapitel 18: Timons Epitaph
Kapitel 19: Alcibiades' Gnade
Epilog
Nachwort
Impressum neobooks
Table of Contents
Timon von Athen – Kein Drama nach William Shakespeare
Anno Stock
Teil I: Der großzügige Athener
Kapitel 1: Das Fest der Freundschaft
Die Abendsonne tauchte die weißen Säulen von Timons Anwesen in goldenes Licht, als wäre das Haus selbst ein Tempel, geweiht den Göttern der Gastfreundschaft und des Überflusses. Über den Mauern der Stadt Athen, wo die Akropolis majestätisch gegen den verblassenden Himmel ragte, breitete sich die Dämmerung aus wie ein purpurner Mantel. Doch in den Hallen des reichsten Bürgers Athens hatte der Tag noch nicht sein Ende gefunden – hier begann er vielmehr aufs Neue, in einem Glanz, der die Sonne selbst herausfordern wollte.
Timon von Athen stand in seinem Atrium und beobachtete die letzten Vorbereitungen für das Fest, das er heute Abend geben würde. Es war nicht das erste seiner Art, und es würde gewiss nicht das letzte sein. Seine Großzügigkeit war in der Stadt so legendär wie die Weisheit Solons oder die Tapferkeit des Theseus. Männer sprachen seinen Namen mit Ehrfurcht aus, Dichter besangen seine Freigebigkeit, und wer immer in Not geraten war, wusste, dass Timons Tür ihm offenstand.
Er war ein Mann in den besten Jahren, kräftig gebaut, mit einem Gesicht, das Güte und Intelligenz ausstrahlte. Seine Augen leuchteten mit jener besonderen Freude, die nur jene kennen, die ihr Glück im Glück anderer finden. Sein Haar war dunkel, durchzogen von ersten silbernen Strähnen, die ihm eine gewisse Würde verliehen. Er trug ein schlichtes, aber feines Gewand aus tyrischem Purpur, dessen Saum mit Gold bestickt war – nicht aus Eitelkeit, sondern weil seine Position es erforderte, dass er würdevoll erschien.
„Flavius!" rief er, und seine Stimme hallte durch die Halle. „Sind die Amphoren aus Chios angeliefert worden?"
Sein Verwalter trat aus dem Schatten der Kolonnade. Flavius war ein Mann mittleren Alters, dessen schlanke Gestalt und sorgfältig gepflegtes Äußeres von jahrelanger Disziplin zeugten. Seine Augen, grau wie der ägäische Himmel vor einem Sturm, verrieten eine Sorge, die er nur mühsam zu verbergen suchte. Er trug eine Wachstafel unter dem Arm – jene verhängnisvolle Tafel, auf der er die Ausgaben seines Herrn notierte, Ausgaben, die längst jedes vernünftige Maß überschritten hatten.
„Ja, Herr", antwortete Flavius mit einer leichten Verbeugung. „Zwanzig Amphoren des besten Weins. Die Händler haben die Lieferung vor einer Stunde bestätigt." Er zögerte einen Moment, dann fügte er hinzu: „Herr, wenn ich einen Augenblick sprechen dürfte..."
Doch Timon hatte sich bereits abgewandt, sein Blick richtete sich auf die Sklaven, die große Bronzeschalen mit Früchten und Blumen arrangierten. „Herrlich, herrlich! Und die Musiker? Ich will, dass heute Abend die feinsten Klänge durch diese Hallen ziehen. Meine Freunde sollen in jedem Augenblick spüren, wie willkommen sie sind."
„Die Musiker warten bereits in der Seitenkammer, Herr." Flavius' Stimme war leiser geworden. „Aber ich muss mit Euch sprechen über—"
„Später, mein guter Flavius, später!" Timon lachte, eine herzliche, warme Melodie. „Heute Abend ist für die Freude bestimmt, nicht für Zahlen und Sorgen. Sieh nur, wie schön alles geworden ist! Die Götter selbst könnten an unserer Tafel speisen und würden sich nicht beklagen."
Flavius verbeugte sich erneut und trat zurück, die Wachstafel fester gegen seine Brust gepresst. In seinen Augen lag ein Schmerz, den nur jene verstehen, die eine Katastrophe kommen sehen und doch machtlos sind, sie zu verhindern. Er kannte die Zahlen. Er wusste, dass Timons Vermögen – so gewaltig es einst gewesen war – nicht endlos sein konnte. Die Ländereien waren bereits verpfändet, die Minen erschöpft, und die Schulden wuchsen wie Unkraut nach dem Frühlingsregen.
Aber Timon sah nichts von alledem. Für ihn waren Reichtum und Freundschaft untrennbar miteinander verwoben, zwei Aspekte derselben göttlichen Gabe. Gold war dazu da, geteilt zu werden. Was nützte es, Schätze zu horten, wenn man sie nicht nutzen konnte, um anderen Freude zu bereiten? Diese Philosophie hatte ihn zum beliebtesten Mann Athens gemacht – und würde ihn, wie Flavius mit wachsender Gewissheit ahnte, in den Ruin treiben.
Die ersten Gäste begannen einzutreffen, als die Sonne hinter dem Hymettos versank. Sie kamen durch das große Tor, über dessen Schwelle schon so viele gegangen waren, um Timons Großzügigkeit zu empfangen. Zuerst erschienen die Künstler, wie es ihre Art war – jene Schmeichler und Geschichtenerzähler, die stets wussten, wo ein reiches Mahl zu finden war.
Der Poet betrat das Atrium mit der stolzen Haltung eines Mannes, der seine Worte für Gold wägt. Er war hochgewachsen und mager, sein Gesicht trug die verhärmten Züge eines Menschen, der mehr Zeit in Weinschenken als an seinem Schreibpult verbrachte. Dennoch besaß er ein gewisses Charisma, jene trügerische Eloquenz, die die Reichen so gerne für Weisheit hielten.
Neben ihm ging der Maler, ein rundlicher Mann mit ölverschmierten Fingern und einem Lächeln, das zu breit war, um echt zu sein. Er trug unter dem Arm ein verhülltes Gemälde, und seine Augen glitzerten bei dem Gedanken an die Belohnung, die ihn erwartete.
„Timon!" rief der Poet aus, die Arme ausbreitend, als wollte er die ganze Welt umarmen. „Edelster der Athener, Freund der Musen, Schirmherr aller Künste!"
Timon eilte auf sie zu, sein Gesicht strahlend vor Freude. „Meine Freunde! Wie erfreut bin ich, euch zu sehen! Kommt, kommt herein. Heute Abend soll das Fest alle bisherigen übertreffen."
Der Maler enthüllte sein Werk mit einer theatralischen Geste. Es zeigte Timon selbst, dargestellt als eine Art Halbgott, umgeben von dankbaren Bürgern, die seine Gaben empfingen. Die Schmeichelei war so offensichtlich, dass selbst ein Kind sie durchschaut hätte, doch Timon lachte nur und klopfte dem Künstler auf die Schulter.
„Ihr schmeichelt mir zu sehr, mein Freund! Aber es ist ein schönes Werk, wahrlich. Flavius! Sorge dafür, dass unser guter Maler fünfzig Talente für seine Mühe erhält."
Flavius, der in der Nähe stand, zuckte kaum merklich zusammen. Fünfzig Talente – ein Vermögen, das für ein solches mittelmäßiges Werk verschwendet wurde. Doch er verbeugte sich und notierte die Summe auf seiner Tafel, während der Maler vor Dankbarkeit zu zerfließen schien.
„Ihr seid zu gütig, edler Timon! Zu gütig! Die Götter mögen euch segnen für eure Großzügigkeit!"
Weitere Gäste trafen ein. Lucullus, ein Senator von stattlicher Erscheinung und gepflegtem Bart, dessen Toga so makellos weiß war wie frisch gefallener Schnee. Lucius, ein anderer vornehmer Bürger, dessen Gesicht die falsche Herzlichkeit eines Kaufmanns trug, der einen guten Handel wittert. Sempronius, dessen dünnes Lächeln nicht bis zu seinen Augen reichte.
Sie alle kannten den Grund, warum sie gekommen waren. Nicht aus Liebe zu Timon – obwohl sie es laut verkündeten –, sondern wegen der Geschenke, die er verteilte wie andere Männer Almosen. Jeder von ihnen hatte bereits zahlreiche Male von Timons Freigebigkeit profitiert, und jeder von ihnen plante, heute Abend erneut seine Hand auszustrecken.
„Lucullus, mein teurer Freund!" Timon umarmte den Senator herzlich. „Wie geht es deiner Familie? Sind deine Söhne wohlauf?"
„Dank eurer Großzügigkeit, Timon", antwortete Lucullus mit einem Lächeln, das zu perfekt war, um aufrichtig zu sein. „Der Tutor, den Ihr uns empfohlen und bezahlt habt, ist ein wahrer Gelehrter. Meine Söhne machen große Fortschritte in Rhetorik und Philosophie."
„Nichts macht mich glücklicher als zu wissen, dass ich meinen Freunden von Nutzen sein kann!" Timons Freude war echt, ungetrübt von jedem Verdacht. „Ein Mann ist nur so reich, wie er andere reich machen kann."
In diesem Moment betrat eine Gestalt das Atrium, die sich deutlich von den anderen Gästen abhob. Apemantus, der Philosoph – oder wie manche ihn nannten, der Zyniker. Er war von gedrungener Statur, sein ungepflegter Bart und seine schlichte, fast ärmliche Kleidung bildeten einen scharfen Kontrast zu der Pracht ringsum. Seine Augen waren dunkel und durchdringend, der Blick eines Mannes, der zu tief in die menschliche Natur geschaut hatte, um noch an ihre Güte zu glauben.
„Ah, Apemantus!" rief Timon aus, ohne eine Spur von Verärgerung über das mürrische Auftreten des Philosophen. „Auch du bist gekommen! Ich freue mich, dass du dich zu uns gesellst."
Apemantus schnaubte verächtlich. „Ich bin nicht gekommen, um mich zu freuen, Timon. Ich bin gekommen, um zu essen – denn ein kostenfreies Mahl schmeckt selbst einem Philosophen. Aber täusche dich nicht: Ich durchschaue diese Versammlung von Schmeichlern und Schmarotzern."
Der Poet drehte sich beleidigt um. „Ihr nennt uns Schmarotzer? Wir, die wir die Kunst hochhalten und—"
„Ihr haltet nichts hoch außer euren Bechern", unterbrach ihn Apemantus kalt. „Und eure Kunst ist nichts als gefällige Lüge, verkauft an den Meistbietenden."
Timon lachte und legte beiden Männern eine Hand auf die Schulter. „Frieden, Freunde! Apemantus, deine raue Ehrlichkeit ist mir ebenso willkommen wie die feinen Worte unseres Poeten. In meinem Haus haben alle Arten von Wahrheit Platz."
„Alle Arten von Narretei, meinst du wohl", brummte Apemantus, ließ sich aber zu einem der Polster führen, die um die niedrigen Tische arrangiert waren.
Die Halle füllte sich zusehends. Juweliere kamen, um Timon ihre neuesten Stücke zu zeigen. Händler brachten exotische Waren aus fernen Ländern. Alle suchten seine Gunst, alle hofften auf seine Freigebigkeit. Und Timon empfing sie alle mit derselben offenen Herzlichkeit, unterschiedslos in seiner Güte.
Als die Dunkelheit vollständig hereingebrochen war und hunderte von Öllampen die Halle in ein warmes, flackerndes Licht tauchten, gab Timon das Zeichen für den Beginn des Mahls. Die Sklaven trugen Speisen auf, wie sie selbst in den Palästen der Könige selten zu finden waren. Gebratenes Wildschwein, mit Honig glasiert und mit Granatapfelkernen garniert. Fische aus dem Ägäischen Meer, so frisch, dass sie am Morgen noch geschwommen waren. Brot, das in Form von Tieren und mythologischen Gestalten gebacken war. Oliven, Feigen, Datteln. Und Wein – oh, der Wein floss in Strömen, dunkler Wein aus Chios, süßer Wein aus Thasos, würziger Wein aus Lesbos.
Timon saß in der Mitte seiner Gäste, nicht auf einem erhöhten Platz, wie es die Sitte verlangte, sondern auf gleicher Höhe mit ihnen. Er aß wenig, trank mäßig – seine Freude kam nicht aus der sinnlichen Befriedigung, sondern aus dem Anblick der glücklichen Gesichter um ihn herum.
„Ein Toast!" rief Lucullus, seinen Becher hebend. „Auf Timon, den großzügigsten Mann Athens, dessen Freundschaft wertvoller ist als alles Gold der Welt!"
„Auf Timon!" echote die Versammlung, und die Becher wurden geleert und sogleich wieder gefüllt.
Timon erhob sich, sein Gesicht strahlend im Lampenlicht. „Meine Freunde, ihr erweist mir zu viel Ehre. Ich tue nur, was jeder gute Mensch tun sollte – ich teile das, was mir gegeben wurde. Denn was ist Reichtum, wenn er nicht geteilt wird? Was ist Freundschaft, wenn sie nicht gepflegt wird? Ihr alle habt mir eure Gesellschaft geschenkt, und das ist ein Geschenk, das kein Gold aufwiegen kann."
„Fein gesprochen!" rief der Poet. „Wahrlich, die Götter selbst müssen euch lieben, Timon!"
Apemantus, der in einer Ecke saß und mehr beobachtete als aß, murmelte leise genug, dass nur sein Nachbar es hören konnte: „Die Götter mögen ihn lieben, aber diese Schmeichler lieben nur seinen Geldbeutel. Wenn die Quelle versiegt, werden sie schneller verschwinden als Tau in der Morgensonne."
Das Fest ging weiter, Stunde um Stunde. Die Musiker spielten auf ihren Leiern und Flöten, sanfte Melodien, die mit dem Gelächter und den Gesprächen der Gäste verschmolzen. Tänzerinnen führten ihre Kunst vor, ihre Bewegungen anmutig wie die des Morgennebels über dem Meer.
Und dann, als das Fest seinen Höhepunkt erreichte, geschah, was Timon so liebte: Ein Gast wagte es, um etwas zu bitten.
Es war ein junger Mann namens Ventidius, blass und offensichtlich niedergedrückt. Er gehörte nicht zu den regulären Gästen, war aber auf Empfehlung eines Freundes eingeladen worden. Er stand auf, seine Hände nervös an seinem Gewand zupfend.
„Edler Timon", begann er zögernd, „ich schäme mich, in dieser Stunde der Freude von meinen Sorgen zu sprechen, aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll."
Timon wandte sich ihm zu, sein Gesicht voller Mitgefühl. „Sprich frei, mein Freund. Wenn ich helfen kann, so will ich es gerne tun."
„Mein Vater..." Ventidius' Stimme brach. „Mein Vater liegt im Schuldgefängnis. Er schuldet einem Gläubiger fünfzig Talente, die er nicht bezahlen kann. Die Schande bringt unsere ganze Familie in Verruf. Ich habe versucht, das Geld aufzutreiben, aber vergebens. Und nun sitzt er in diesem schrecklichen Ort und..."
„Genug!" Timon sprang auf, seine Augen funkelten nicht vor Zorn, sondern vor Entschlossenheit. „Kein Freund eines Freundes soll in Ketten liegen, solange ich etwas dagegen tun kann. Flavius!"
Der Verwalter trat vor, seine Miene ausdruckslos, obwohl sein Herz schwer war.
„Flavius, sorge dafür, dass morgen bei Tagesanbruch fünfzig Talente an die Gläubiger von Ventidius' Vater gezahlt werden. Der gute Mann soll befreit werden und mit Ehren zu seiner Familie zurückkehren können."
Die Versammlung brach in Beifall aus. Ventidius fiel auf die Knie, Tränen der Dankbarkeit strömten über sein Gesicht.
„Herr, ich... ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Dies ist eine Schuld, die ich niemals zurückzahlen kann!"
Timon half ihm auf die Füße, seine Hände fest auf den Schultern des jungen Mannes. „Sprich nicht von Schulden zwischen Freunden. Wenn dein Vater frei ist, wenn deine Familie ihren Frieden wiedergefunden hat, dann ist das Dank genug für mich. Mehr brauche ich nicht."
Flavius notierte die fünfzig Talente auf seiner Tafel, seine Hand zitterte kaum merklich. Das würde weitere Kredite erfordern, weitere Verpfändungen. Aber er schwieg, wie er immer schwieg.
Lucius erhob sich nun, sein Gesicht strahlend vor gespielter Bewunderung. „Timon, Eure Großzügigkeit ist beispiellos! Wahrlich, es gibt keinen edleren Mann in ganz Athen. Erlaubt mir, als Zeichen meiner bescheidenen Dankbarkeit für Eure Freundschaft, Euch vier prächtige Pferde zu schenken, die gerade aus Thessalien eingetroffen sind."
Timon winkte ab. „Du bist zu gütig, Lucius! Aber ich kann solch ein Geschenk nicht annehmen, ohne es zu erwidern. Flavius, notiere: Lucius soll zwölf Pferde aus meinen Stallungen erhalten, die besten, die wir haben."
Lucius verbeugte sich tief, kaum in der Lage, sein triumphierendes Lächeln zu verbergen. Er hatte vier alte Pferde angeboten und würde zwölf edle Tiere erhalten – ein glänzendes Geschäft.
So ging es weiter durch die Nacht. Jeder Gast, der Timon ein bescheidenes Geschenk machte, erhielt ein weit größeres zurück. Der Juwelier, der einen silbernen Ring anbot, bekam eine goldene Kette. Der Händler, der exotische Gewürze brachte, wurde mit Seide und Elfenbein beschenkt.
Nur Apemantus saß abseits und beobachtete das Schauspiel mit wachsender Verachtung. Schließlich erhob er sich und trat zu Timon.
„Siehst du nicht, was hier geschieht?" fragte er leise, nur für Timons Ohren bestimmt. „Diese Männer sind keine Freunde. Sie sind Geier, die um ein Aas kreisen."
Timon legte ihm die Hand auf die Schulter, sein Lächeln unverändert warm. „Du bist zu misstrauisch, alter Freund. Die Menschen sind gut, wenn man ihnen nur Vertrauen schenkt. Ja, vielleicht erweisen sie mir Ehre wegen meines Reichtums – aber ist das nicht natürlich? Solange ich ihnen helfen kann, ihr Leben zu verbessern, solange ich Freude verbreiten kann, ist das nicht ein guter Gebrauch des Vermögens, das mir gegeben wurde?"
„Dein Vermögen ist endlich, Timon, deine Großzügigkeit nicht. Was wird geschehen, wenn der Tag kommt – und er wird kommen –, an dem du nichts mehr zu geben hast? Werden diese ‚Freunde' dann noch an deiner Seite stehen?"
„Du stellst eine unmögliche Frage", antwortete Timon sanft. „Denn solange ich lebe, werde ich teilen, was ich habe. Und sollte der Tag tatsächlich kommen, an dem meine Mittel erschöpft sind – nun, dann werde ich auf die Großzügigkeit meiner Freunde vertrauen, so wie sie jetzt auf meine vertrauen. Das ist das Wesen der Freundschaft: gegenseitige Unterstützung in guten wie in schlechten Zeiten."
Apemantus schüttelte den Kopf. „Du bist ein Narr, Timon. Ein edler, großherziger Narr, aber dennoch ein Narr. Eines Tages wirst du aufwachen und feststellen, dass du allein bist, umgeben von leeren Versprechungen und falschen Tränen."
„Und du bist ein Zyniker, der die Güte in den Menschen nicht erkennen kann", konterte Timon, doch seine Stimme war nicht hart. „Aber ich liebe dich trotzdem für deine Ehrlichkeit. Komm, trink mit mir. Lass uns auf die Menschheit anstoßen, so fehlerhaft sie auch sein mag."
Widerwillig hob Apemantus seinen Becher, und für einen Moment tranken die beiden Männer gemeinsam – der hoffnungsvolle Idealist und der bittere Realist, vereint nur in diesem flüchtigen Augenblick.
Die Nacht neigte sich ihrem Ende zu. Die Gäste begannen, sich zu verabschieden, jeder beladen mit Geschenken, jeder voll des Lobes für ihren großzügigen Gastgeber. Sie versprachen ewige Freundschaft, ewige Dankbarkeit. Ihre Worte waren süß wie Honig, und Timon glaubte jedem einzelnen.
Als der letzte Gast gegangen war und die Sklaven begannen, die Überreste des Festes aufzuräumen, stand Timon allein im Atrium. Die Öllampen waren bis auf wenige erloschen, und in der Stille konnte man das ferne Zirpen der Grillen hören.
Flavius trat zu ihm, die Wachstafel in der Hand.
„Herr", begann er vorsichtig, „wir müssen über die Ausgaben sprechen."
Timon drehte sich zu ihm um, sein Gesicht noch immer von der Freude des Abends erhellt. „Morgen, Flavius. Heute war ein guter Tag. Hast du die Gesichter meiner Freunde gesehen? Ihre Freude? Das ist es, wofür ich lebe."
„Herr, bitte. Es ist wichtig. Die Schulden—"
„Morgen", wiederholte Timon, diesmal bestimmter. „Heute Nacht möchte ich nur an das Gute denken. An die Freundschaft. An die Liebe, die Menschen füreinander empfinden können."
Flavius verbeugte sich, seine Schultern senkten sich in Resignation. „Wie Ihr wünscht, Herr."
Als der Verwalter gegangen war, trat Timon ans offene Fenster. Die Stadt lag unter ihm, still und friedlich in der Dunkelheit. Irgendwo da draußen würde morgen Ventidius' Vater aus dem Gefängnis befreit werden. Irgendwo würden Menschen aufwachen und sich an die Großzügigkeit erinnern, die ihnen zuteil geworden war.
Timon lächelte. Dies war sein Lebenszweck, seine Bestimmung. Er war reich, ja – aber nicht, um zu horten oder zu prahlen. Er war reich, um zu geben, um zu helfen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Und in diesem Moment, unter dem Sternenhimmel von Athen, umgeben von den Spuren seines verschwenderischen Festes, war Timon von Athen der glücklichste Mann auf Erden.
Er ahnte nicht, dass dieses Glück auf Sand gebaut war, dass die Flut bereits heranrollte, die alles wegspülen würde. Er konnte die Zukunft nicht sehen, in der seine Freunde sich von ihm abwenden würden wie Blätter im Herbstwind.
Noch nicht.
Noch war er der großzügige Timon, geliebt von allen, Freund der Welt.
Noch hatte die Tragödie nicht begonnen.
Kapitel 2: Der Poet und der Maler
Der Morgen brach über Athen herein mit jener klaren Helligkeit, die nur der Frühsommer kennt. Die Luft war noch kühl, erfüllt vom Duft der Blumen, die in den Gärten der Reichen blühten, und vom salzigen Hauch, den der Wind vom Piräus herauftrug. Die Stadt erwachte langsam – Händler öffneten ihre Läden, Fischer kehrten mit ihrem nächtlichen Fang zurück, und auf der Agora sammelten sich bereits die ersten Bürger, um die Neuigkeiten des Tages auszutauschen.
Doch in Timons Haus herrschte bereits geschäftiges Treiben. Flavius saß in seinem kleinen Arbeitszimmer, einem schmucklosen Raum, der in scharfem Kontrast zu der Pracht des übrigen Anwesens stand. Vor ihm lagen die Wachstafeln ausgebreitet, eine endlose Auflistung von Zahlen, die alle dasselbe erzählten: eine Geschichte des Verfalls, eine Chronik der finanziellen Selbstzerstörung.
Er hatte die Nacht kaum geschlafen. Immer wieder war er die Berechnungen durchgegangen, hatte nach einem Ausweg gesucht, nach irgendeiner Möglichkeit, die drohende Katastrophe abzuwenden. Aber die Mathematik war unerbittlich. Die Einnahmen aus Timons verbliebenen Ländereien reichten nicht aus, um auch nur die Zinsen der aufgenommenen Kredite zu decken. Die Silberminen, die einst das Fundament seines Reichtums gewesen waren, waren längst erschöpft oder verpfändet. Und jeden Tag kamen neue Forderungen, neue Bitten, neue Geschenke, die Timon mit seiner grenzenlosen Großzügigkeit erfüllte.
Flavius legte die Hände flach auf den Tisch und schloss für einen Moment die Augen. Er war Timon treu ergeben, hatte ihm zwanzig Jahre gedient, hatte seine Familie ernährt und sein Haus verwaltet, als noch Überfluss herrschte. Aber Treue allein konnte die Gesetze der Wirtschaft nicht außer Kraft setzen. Wenn es so weiterging, würden sie in weniger als einem Jahr vor dem Ruin stehen.
Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen düsteren Gedanken.
„Herein", sagte er, seine Stimme müde.
Einer der jüngeren Diener trat ein, ein Junge von vielleicht fünfzehn Jahren, dessen Gesicht die Nervosität verriet, die alle verspürten, wenn sie Flavius mit einer neuen Forderung konfrontieren mussten.
„Herr Flavius", begann der Junge zögernd, „der Poet und der Maler sind wieder da. Sie warten im Atrium und wünschen, den Herrn zu sprechen."
Flavius seufzte. Natürlich waren sie zurück. Das Fest war erst wenige Stunden vorbei, und schon kehrten die Schmarotzer zurück, angelockt vom Geruch des Goldes wie Fliegen vom Honig.
„Sag ihnen, dass der Herr noch ruht. Sie sollen später wiederkommen."
Der Junge zögerte. „Herr, sie sagen, es sei dringend. Sie haben neue Werke, die sie dem Herrn zeigen möchten."
„Natürlich haben sie das." Flavius erhob sich, seine Knochen schmerzten von der schlaflosen Nacht. „Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Vielleicht kann ich sie abwimmeln, bevor der Herr erwacht."
Er folgte dem Diener durch die stillen Korridore des Hauses. Die Sklaven waren noch dabei, die Spuren des gestrigen Festes zu beseitigen. Überall lagen zerbrochene Krüge, verwelkte Blumen, Essensreste. Es war ein trauriges Bild, diese Überbleibsel der Verschwendung im nüchternen Morgenlicht.
Im Atrium warteten tatsächlich der Poet und der Maler. Sie hatten sich auf einer der Marmorbänke niedergelassen und führten eine lebhafte Diskussion, die abrupt endete, als Flavius eintrat.
Der Poet sprang auf, sein Gesicht strahlend vor gespielter Freude. „Ah, der gute Flavius! Wie erfreut sind wir, Euch zu sehen! Ist der edle Timon bereits erwacht? Wir haben Werke von solcher Bedeutung geschaffen, dass wir nicht warten konnten, sie ihm zu präsentieren."
Flavius betrachtete die beiden Männer mit unverhohlenem Misstrauen. Der Poet trug heute ein neues Gewand, zweifellos mit dem Geld gekauft, das er gestern erhalten hatte. Der Maler hatte ein noch größeres Bild dabei, verhüllt unter einem kostbaren Tuch – ebenfalls zweifellos neu erworben.
„Der Herr ruht noch", sagte Flavius kühl. „Das Fest gestern Abend war lang, und er braucht seine Ruhe."
„Natürlich, natürlich!" Der Poet nickte eifrig. „Wir würden ihn niemals stören wollen. Aber vielleicht könntet Ihr ihm ausrichten, dass wir hier sind? Es wird nicht lange dauern, und ich versichere Euch, er wird von dem, was wir ihm zeigen, begeistert sein."
„Ich werde es ihm ausrichten", versprach Flavius, ohne die Absicht zu haben, es zu tun. „Kommt morgen wieder."
Doch bevor der Poet antworten konnte, hörten sie Schritte. Timon selbst erschien in der Tür, offenbar gerade erst erwacht, sein Haar noch zerzaust, aber sein Gesicht strahlend vor guter Laune.
„Flavius! Ich dachte, ich hörte Stimmen. Oh, seht nur! Meine Künstlerfreunde sind zurückgekehrt!" Er eilte auf die beiden zu, seine Arme ausgebreitet. „Welch eine Freude, euch so früh am Morgen zu sehen! Habt ihr gut geschlafen nach unserem Fest?"
„Wunderbar, edler Timon, wunderbar!" Der Poet verbeugte sich so tief, dass sein Kopf fast den Boden berührte. „Doch der Schlaf war kurz, denn die Muse ließ mir keine Ruhe. Ich musste aufstehen und ein Gedicht verfassen, inspiriert von Eurer Großzügigkeit!"
„Ein Gedicht? Für mich?" Timons Augen leuchteten. „Ihr seid zu gütig! Bitte, rezitiert es. Ich bin ganz Ohr."
Flavius wollte protestieren, wollte seinen Herrn davon abhalten, sich erneut von diesen Schmeichlern umgarnen zu lassen. Doch er wusste, es war zwecklos. Timon liebte die Künste, und mehr noch liebte er es, Künstler zu fördern – selbst wenn diese Künstler nichts weiter waren als geschickte Betrüger.
Der Poet räusperte sich theatralisch und begann mit übertriebener Gestik zu rezitieren:
„O Timon, Stern am Firmament Athens, Dessen Licht die Dunkelheit vertreibt! Wie der Fluss, der durch die Ebene fließt, So fließt dein Gold zu allen, die in Not geraten. Die Götter selbst beneiden deine Tugend, Und Zeus vom Olymp herab betrachtet dich Mit Staunen und mit Ehrfurcht. Denn niemals sah die Welt solch einen Mann, Der gab und gab und nichts zurückverlangte, Der Freunde liebte mehr als seinen Schatz, Der Herzen öffnete, wo andere sie verschlossen."
Die Verse waren mittelmäßig im besten Fall, voller kitschiger Metaphern und ungeschickter Metren. Aber Timon hörte zu, als wäre es Homer selbst, der sprach. Als der Poet endete, klatschte er begeistert in die Hände.
„Wundervoll! Wirklich wundervoll! Die Sprache der Musen fließt durch euch. Flavius, sorge dafür, dass unser Freund hundert Drachmen für dieses herrliche Werk erhält."
Hundert Drachmen für ein paar schlecht gereimte Zeilen. Flavius schluckte seinen Protest hinunter und notierte die Summe.
„Ihr seid zu großzügig, Herr", murmelte er.
„Unsinn!" Timon winkte ab. „Wahre Kunst ist unbezahlbar. Aber wir müssen den Künstler dennoch unterstützen, damit er weiterschaffen kann."
Nun trat der Maler vor, das verhüllte Gemälde in den Händen. „Edler Timon, auch ich habe etwas, das Eure Aufmerksamkeit verdient. Die ganze Nacht habe ich daran gearbeitet, von der Vision geleitet, die mir im Traum erschien."
Mit einer dramatischen Geste enthüllte er das Bild. Es war noch größer als das gestrige, und es zeigte eine allegorische Szene: Timon als Prometheus, der das Feuer – in diesem Fall dargestellt als goldene Münzen – von den Göttern stahl, um es den Menschen zu bringen. Die Technik war handwerklich solide, aber ohne Seele, ohne wahre künstlerische Tiefe. Es war das Werk eines Mannes, der malte, um zu verkaufen, nicht um auszudrücken.
„Seht!" rief der Maler aus. „Ich habe Euch als den Wohltäter der Menschheit dargestellt, als jenen, der das Göttliche zu den Sterblichen bringt!"
Timon betrachtete das Bild lange und ernst. Flavius hoffte einen Moment lang, dass sein Herr vielleicht doch die Schmeichelei durchschauen würde, die offensichtliche Manipulation. Aber dann sah er, wie Timons Gesicht weich wurde, wie Tränen in seinen Augen aufstiegen.
„Ihr ehrt mich zu sehr", flüsterte Timon. „Ich bin kein Prometheus, nur ein Mann, der versucht, seinem Nächsten zu helfen. Aber die Arbeit ist bemerkenswert. Flavius, zweihundert Drachmen für unseren talentierten Maler."
„Zweihundert, Herr?" Flavius konnte nicht anders, als zu protestieren. „Gestern habt Ihr ihm bereits fünfzig Talente gegeben."
„Und heute gebe ich ihm zweihundert Drachmen mehr. Ist das nicht der Fluch – oder besser gesagt, der Segen – des Reichtums, dass man ihn teilen muss?"
Bevor Flavius antworten konnte, erhob sich eine raue Stimme von der Seite. Apemantus war unbemerkt eingetreten und stand nun mit verschränkten Armen da, sein Gesicht eine Maske der Verachtung.
„Der Fluch des Reichtums, Timon, ist nicht, dass man ihn teilen muss, sondern dass er Schmeichler und Lügner anzieht wie Aas die Raben. Diese beiden hier sind Künstler? Ich nenne sie Betrüger und Schwindler!"
Der Poet fuhr herum, sein Gesicht rot vor Empörung. „Wie wagt Ihr es! Wir sind ehrliche Männer, die unser Brot mit unserer Arbeit verdienen!"
„Eure Arbeit!" Apemantus lachte bitter. „Ein Kind könnte bessere Verse schreiben, und was das Gemälde betrifft – mein Hund könnte auf eine Leinwand pissen und ein Werk von gleichem Wert schaffen!"
„Apemantus!" Timon trat zwischen die streitenden Männer, seine Stimme fest, aber nicht unfreundlich. „Ich verstehe, dass du skeptisch bist, alter Freund. Aber nicht alle Menschen sind von niederen Motiven getrieben. Diese Männer bringen mir Freude mit ihrer Kunst, und dafür möchte ich sie belohnen."
„Sie bringen dir Schmeicheleien, keine Kunst." Apemantus' Stimme war ruhiger geworden, aber nicht weniger eindringlich. „Und du bezahlst sie fürstlich dafür, dass sie dich einen Gott nennen. Merkst du nicht, dass sie dich zum Narren machen?"
Der Maler wollte protestieren, doch Apemantus fuhr fort, nun direkt an die beiden Künstler gewandt: „Sagt mir – wenn Timons Gold morgen verschwände, würdet ihr dann immer noch seine Freunde sein? Würdet ihr immer noch eure Gedichte über ihn schreiben, eure Bilder von ihm malen?"
Eine peinliche Stille senkte sich über das Atrium. Der Poet und der Maler wechselten nervöse Blicke. Schließlich war es der Poet, der antwortete, seine Stimme jetzt weniger sicher:
„Natürlich würden wir... Das heißt, wahre Kunst wird nicht vom Gold motiviert, sondern von..."
„Von was?" unterbrach ihn Apemantus. „Von der Bewunderung für einen Mann, den ihr kaum kennt? Von der reinen Liebe zur Wahrheit? Lügt nicht. Ihr seid hier, weil Timons Taschen tief sind, und aus keinem anderen Grund."
Der Maler setzte zu einer Verteidigung an, doch seine Worte klangen hohl: „Wir schätzen den edlen Timon für seine Tugenden, für seine—"
„Für seine Tugenden!" Apemantus schnaubte. „Ihr schätzt seine Münzen. Wenn er arm wäre, würdet ihr an ihm vorbeilaufen, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Und das Schlimmste ist, dass ihr nicht einmal die Ehrlichkeit habt, es zuzugeben."
Timon legte dem Philosophen beschwichtigend die Hand auf die Schulter. „Du bist zu hart mit ihnen, Apemantus. Ja, vielleicht wird meine Großzügigkeit geschätzt – aber ist das nicht menschlich? Wir alle suchen Vorteile, wo wir sie finden können. Das macht diese Männer nicht zu Schurken."
„Es macht sie auch nicht zu Freunden", erwiderte Apemantus. „Aber ich sehe, meine Worte erreichen dich nicht. Du bist entschlossen, die menschliche Natur für besser zu halten, als sie ist. Nun gut. Ich werde hier sein, wenn die Wahrheit sich offenbart. Und sie wird sich offenbaren, Timon. Das schwöre ich dir."
Mit diesen Worten drehte sich der Philosoph um und verließ das Atrium, sein Gang schwer vor Frustration.
Timon seufzte tief. „Vergebt ihm. Apemantus hat ein gutes Herz, auch wenn seine Worte manchmal scharf sind. Er meint es gut mit mir."
Der Poet und der Maler murmelten zustimmend, aber die Begegnung hatte ihnen sichtlich die Laune verdorben. Sie nahmen ihre Zahlungen entgegen – die Flavius mit zusammengebissenen Zähnen aushändigte – und verabschiedeten sich eilig, ihre früheren Lobeshymnen nun gedämpft.
Als sie gegangen waren, blieben Timon und Flavius allein zurück. Der Verwalter nutzte die Gelegenheit.
„Herr", begann er vorsichtig, „Apemantus hat nicht ganz unrecht. Diese Männer – viele eurer Gäste von gestern Abend – sie kommen nicht aus Liebe zu euch, sondern aus Liebe zu eurem Gold."
Timon wandte sich ihm zu, sein Gesicht ernst geworden. „Flavius, du dienst mir schon lange. Du bist mir treu ergeben, das weiß ich. Aber in diesem Punkt verstehst du mich nicht."
„Dann helft mir zu verstehen, Herr."
Timon ging zum Fenster und blickte hinaus auf die Stadt, die unter der Morgensonne glitzerte. „Sieh, Flavius, ich weiß, dass nicht alle Menschen rein gute Motive haben. Ich bin kein Kind. Ich sehe die Schmeichelei, ich erkenne die Habgier. Aber ich glaube auch, dass Menschen sich ändern können, dass Güte Güte erzeugt."
Er drehte sich um, seine Augen intensiv. „Wenn ich diesen Künstlern Geld gebe, ja, vielleicht kommen sie zunächst wegen des Goldes. Aber vielleicht – nur vielleicht – wird meine Großzügigkeit ihre Herzen berühren. Vielleicht werden sie verstehen, dass wahre Freundschaft mehr wert ist als Gold. Vielleicht wird sich ihre anfängliche Habgier in echte Zuneigung verwandeln."
„Und wenn nicht, Herr?"
„Dann habe ich zumindest versucht, das Beste in ihnen zu sehen. Ist das nicht besser, als jeden zu verdächtigen und in Misstrauen zu leben, wie Apemantus es tut?"
Flavius schüttelte langsam den Kopf. „Herr, ich bewundere euren Idealismus. Wirklich, ich tue es. Aber ich muss mit euch über eine andere Sache sprechen, die nicht länger warten kann."
„Die Finanzen", sagte Timon, seine Stimme seufzend.
„Ja, die Finanzen." Flavius holte seine Wachstafeln hervor. „Herr, eure Großzügigkeit ist legendär, aber euer Vermögen ist nicht unbegrenzt. Die Schulden wachsen täglich. Die Gläubiger werden ungeduldig."
Timon winkte ab. „Wir haben doch noch die Ländereien in Lakonien, nicht wahr? Und die Weinberge bei Marathon?"
„Die Ländereien in Lakonien sind bereits verpfändet, Herr. Die Weinberge ebenso. Tatsächlich ist fast euer gesamter Besitz bereits als Sicherheit hinterlegt für Kredite, die ihr aufgenommen habt, um... um eure Großzügigkeit zu finanzieren."
Zum ersten Mal sah Flavius echte Besorgnis in Timons Gesicht aufflackern. „Fast alles verpfändet? Aber wie kann das sein? Wir haben doch erst vor einem Jahr—"
„Vor einem Jahr hattet ihr noch Reserven, Herr. Aber erinnert ihr euch an die fünfzig Talente für Ventidius' Vater gestern? An die hundert Talente für den Wiederaufbau des Tempels letzten Monat? An die zweihundert Talente für die Witwenversorgung im Frühling? Diese Summen sind gewaltig, und sie kommen zu den täglichen Ausgaben hinzu – den Festen, den Geschenken, den Almosen."
Timon setzte sich auf die Marmorbank, plötzlich erschöpft wirkend. „Ich... ich wusste nicht, dass es so schlimm steht."
„Ihr wolltet es nicht wissen, Herr." Flavius' Stimme war sanft, aber bestimmt. „Jedes Mal, wenn ich versuchte, mit euch zu sprechen, habt ihr mich vertröst. Und ich – ich hätte durchsetzungsfähiger sein sollen. Das ist auch meine Schuld."
„Nein." Timon erhob sich wieder, seine Fassung zurückgewinnend. „Du hast deine Pflicht getan. Ich bin derjenige, der nicht hören wollte. Aber nun – was schlägst du vor? Was können wir tun?"
Flavius atmete tief durch. Dies war der Moment, auf den er gewartet hatte, den er gefürchtet hatte. „Herr, wir müssen eure Ausgaben drastisch reduzieren. Keine Feste mehr, keine großen Geschenke. Wir müssen versuchen, einige der verpfändeten Besitztümer zurückzukaufen, indem wir andere verkaufen. Und..." Er zögerte. „Und ihr müsst euch an eure Freunde wenden. All jene, denen ihr geholfen habt – sie sollten nun bereit sein, euch zu helfen."
Timon nickte langsam. „Du hast recht. Natürlich hast du recht. Ich habe so vielen geholfen – Ventidius allein schuldet mir fünfzig Talente. Lucullus hat oft meine Großzügigkeit genossen. Lucius ebenso. Sie werden mir sicher helfen, wenn ich sie darum bitte."
„Ich hoffe es, Herr." Aber Flavius' Stimme verriet seinen Zweifel.