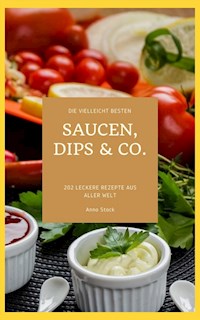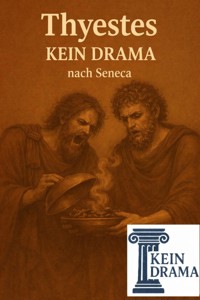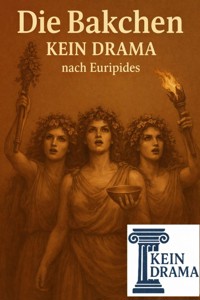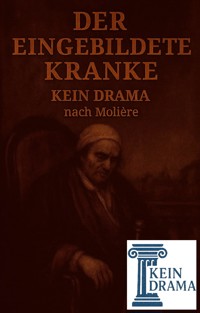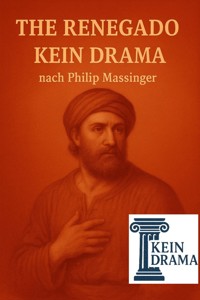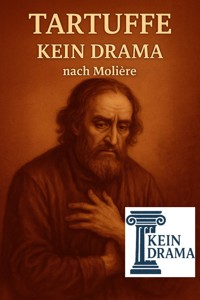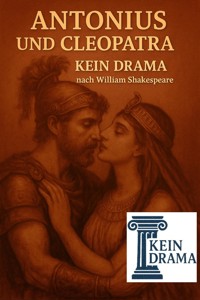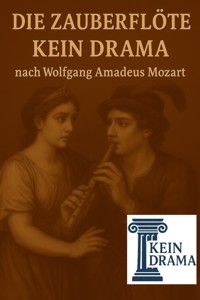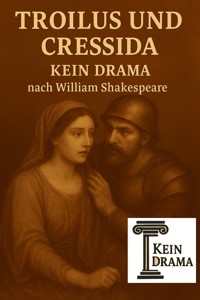
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Eine zeitlose Geschichte von Liebe, Verrat und dem Preis des Überlebens – Shakespeares dunkelste Tragödie neu erzählt. Troja im neunten Jahr der Belagerung: Die Stadt blutet, die Hoffnung schwindet, aber der junge Prinz Troilus entdeckt inmitten des Chaos etwas Unerwartetes – die Liebe. Cressida, Tochter des Verräters Calchas, ist klug, schön und ebenso gefangen in den Zwängen des Krieges wie er. Was als hoffnungsvolle Romanze beginnt, wird zur Zerreißprobe, als Cressida ins griechische Lager ausgeliefert wird. Getrennt durch feindliche Linien, müssen beide unmögliche Entscheidungen treffen: Troilus zwischen Liebe und Rache, Cressida zwischen Treue und Überleben. Während Troja seinem Untergang entgegentaumelt und Helden wie Hektor fallen, zerbricht auch die Illusion von Ehre, Heldentum und ewiger Liebe. Diese packende Romanadaption von Shakespeares "Problemstück" erzählt die Geschichte zweier junger Menschen, die versuchen, Menschlichkeit zu bewahren in einer Welt, die nur Zerstörung kennt. Eine Geschichte ohne einfache Antworten, ohne Helden in glänzender Rüstung – aber mit der zeitlosen Frage: Was bleibt vom Menschen, wenn alle Ideale zerbrechen? Für Leser, die große Emotionen, komplexe Charaktere und die dunklen Seiten klassischer Heldengeschichten schätzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Troilus und Cressida - Kein Drama nach William Shakespeare
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Kapitel 1: Troilus' Verlangen
Kapitel 2: Die Griechen und ihr Groll
Kapitel 3: List und Hierarchie
Kapitel 4: Aeneas' Botschaft
Kapitel 5: Nacht der Versprechen
Kapitel 6: Rat in Troja
Kapitel 7: Achills Zelt
Kapitel 8: Die grausame Nachricht
Kapitel 9: Der Abschied
Kapitel 10: Ankunft im griechischen Lager
Kapitel 11: Der Zweikampf
Kapitel 12: Beim Feind zu Gast
Kapitel 13: Die Beobachtung
Kapitel 14: Zwischen Liebe und Pflicht
Kapitel 15: Zerstörte Illusionen
Kapitel 16: Warnungen in den Wind
Kapitel 17: Der Tag des Zorns
Kapitel 18: Achills Erwachen
Kapitel 19: Hektors Ende
Kapitel 20: Trojas Klage
Kapitel 21: Bittere Wahrheiten
Epilog: Nach dem Fall
Nachwort
Impressum neobooks
Table of Contents
Troilus & Cressida – Kein Drama nach William Shakespeare
Ein historischer Roman
Anno Stock
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitel 1: Troilus' Verlangen
Die Morgensonne brach über die Mauern von Troja herein, golden und gleichgültig, wie sie es nun schon seit neun Jahren tat – neun Jahre Krieg, neun Jahre Belagerung, neun Jahre, in denen sich die Stadt langsam von innen her verzehrte wie ein Apfel, der von außen makellos aussieht, während das Innere längst verfault. Die Luft roch nach Rauch und Schweiß, nach Pferdemist und dem metallischen Hauch von Blut, der sich so tief in die Steine der Stadt eingefressen hatte, dass niemand mehr wusste, ob er echt war oder nur eine Erinnerung, die in den Nasen hängengeblieben war.
Troilus, jüngster Sohn des Priamos und Bruder des großen Hektor, stand auf den Zinnen der Stadtmauer und blickte nicht hinaus zu den griechischen Zelten, die sich wie eine eiternde Wunde am Strand ausbreiteten. Sein Blick war nach innen gerichtet, in die gewundenen Gassen der Stadt, zu einem bestimmten Haus mit weißen Mauern und einem kleinen Innenhof, in dem ein Granatapfelbaum stand. Dort wohnte sie. Cressida.
Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Das war nichts Neues. Seit Wochen plagte ihn diese brennende Unruhe, die keine Linderung kannte. Andere Männer – seine Brüder, die trojanischen Helden – fanden Erleichterung in der Schlacht, im Wein, in den Armen williger Frauen. Troilus fand nichts. Nur das quälende Bild ihres Gesichts, das sich hinter seine geschlossenen Lider brannte, wenn er versuchte zu schlafen.
Er war zwanzig Jahre alt und hatte schon mehr Männer getötet, als er zählen konnte. In der Schlacht war er furchtlos, fast tollkühn. Hektor hatte ihn mehr als einmal zurückpfeifen müssen, wenn sein jüngerer Bruder zu weit in die griechischen Reihen vorstieß. Aber hier, auf diesen Mauern, mit dem Gedanken an eine einzige Frau, fühlte er sich wie ein Feigling.
„Du siehst aus wie ein Mann, der sich selbst bei lebendigem Leib verbrennt", sagte eine Stimme hinter ihm. Troilus drehte sich nicht um. Er erkannte die schleppende, leicht spöttische Sprechweise seines Onkels Pandaros.
„Geh weg", murmelte Troilus.
„Charmant wie immer am Morgen." Pandaros trat neben ihn an die Brüstung. Er war ein rundlicher Mann mittleren Alters, dessen Gesicht die angenehme Weichheit hatte, die von gutem Essen und wenig körperlicher Anstrengung zeugte. Im Gegensatz zu seinen kriegerischen Neffen hatte Pandaros noch nie eine Waffe in Ernsthaftigkeit geschwungen. Seine Talente lagen woanders – in der Diplomatie, in der Vermittlung, im geschickten Weben von Worten und Verbindungen.
„Sie ist die Tochter meines Freundes Calchas", fuhr Pandaros fort, als hätte Troilus nichts gesagt. „Oder war es, bevor der Verräter zu den Griechen überlief. Ein Seher, der angeblich die Zukunft kennt. Ha! Wenn er wirklich gewusst hätte, was kommt, hätte er seine Tochter mitgenommen."
„Halt den Mund über sie", sagte Troilus scharf.
Pandaros lächelte. „Ah, also doch. Cressida. Ich hatte es mir gedacht. Du starrst auf ihr Haus, als könntest du die Mauern mit deinen Blicken durchdringen."
„Was willst du?"
„Dir helfen, mein Junge. Das ist es, was Onkel tun." Pandaros lehnte sich gegen die Brüstung, sein Bauch drückte gegen den Stein. „Du bist verliebt. Das ist nichts Schlimmes. Aber du leidest wie ein geschlagener Hund, und das ist peinlich anzusehen. Warum sprichst du sie nicht einfach an?"
Troilus presste die Kiefer zusammen. „Sie ist... sie ist nicht wie die anderen."
„Natürlich nicht. Wären sie das, würdest du nicht hier stehen und dich verzehren." Pandaros betrachtete seinen Neffen mit einer Mischung aus Belustigung und echtem Mitgefühl. „Cressida ist eine außergewöhnliche Frau. Intelligent, schön, und – was vielleicht am wichtigsten ist – sie steht allein da. Seit ihr Vater uns verraten hat, hat sie keinen männlichen Beschützer mehr. Das macht sie verwundbar."
„Eben deshalb", sagte Troilus heftig, „eben deshalb will ich nicht wie... wie einer dieser Geier sein, die sich auf sie stürzen."
„Edel gedacht. Und dumm." Pandaros seufzte. „Hör zu. Ich kenne Cressida seit ihrer Kindheit. Sie ist klug genug, um zu wissen, dass sie in dieser Stadt jemanden braucht, der für sie einsteht. Und du bist ein Prinz, ein Sohn des Priamos. Eine Verbindung mit dir würde ihr Sicherheit geben."
„Ich will nicht, dass sie mich aus Berechnung akzeptiert!"
„Natürlich nicht. Du willst, dass sie aus wilder Leidenschaft in deine Arme fällt, überwältigt von deiner strahlenden Schönheit und deinem jugendlichen Charme." Pandaros' Ton war trocken. „Das Leben ist keine Ballade, Troilus. Menschen haben immer mehrere Gründe für das, was sie tun. Das macht ihre Gefühle nicht weniger echt."
Troilus schwieg. Unten in der Stadt erwachte das Leben. Frauen trugen Wasserkrüge, Händler öffneten ihre Läden. Normale Dinge, als wäre da draußen nicht eine Armee, die nur darauf wartete, sie alle zu vernichten. Die Menschen von Troja hatten gelernt, mit dem Krieg zu leben wie mit einem chronischen Leiden – mal besser, mal schlechter, aber immer da.
„Lass mich mit ihr sprechen", sagte Pandaros. „Als alter Freund der Familie. Ich kann den Boden bereiten, könnte man sagen. Herausfinden, wie sie denkt, was sie fühlt. Und dann... dann arrangiere ich ein Treffen. Ganz diskret, ganz harmlos."
Troilus wandte sich endlich zu seinem Onkel um. In seinen Augen brannte etwas zwischen Hoffnung und Verzweiflung. „Du würdest das tun?"
„Ich bin ein Romantiker", sagte Pandaros mit einem schiefen Lächeln. „Und außerdem langweile ich mich. Dieser verdammte Krieg hat alle guten Geschichten schon verbraucht. Eine neue Liebesgeschichte – das wäre mal etwas anderes."
„Sprich nicht so über sie", warnte Troilus. „Als wäre sie... Unterhaltung."
„Alles ist Unterhaltung, wenn man alt genug wird, mein Junge. Aber ich verstehe dich. Du bist ernsthaft. Also gut, ich werde auch ernsthaft sein." Pandaros' Gesicht verlor seinen spöttischen Ausdruck. „Ich werde ihr sagen, dass mein Neffe, der tapfere Troilus, sich verzehrt vor Liebe zu ihr. Dass er ein guter Mann ist, trotz seiner königlichen Geburt. Dass er nicht einer dieser aufgeblasenen Wichtigtuer ist wie Paris. Ich werde ihr die Wahrheit sagen – dass du sie begehrst, ja, aber dass du sie auch respektierst. Das wird sie beeindrucken."
„Und wenn sie... wenn sie ablehnt?"
Pandaros zuckte die Achseln. „Dann leidest du weiter, ich vermute. Aber zumindest wirst du es wissen. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende."
Troilus wandte sich wieder der Stadt zu. Irgendwo in diesen Gassen war Cressida gerade aufgewacht. Vielleicht kämmte sie ihr dunkles Haar, vielleicht stand sie in ihrem Hof unter dem Granatapfelbaum. Er hatte sie nur aus der Ferne gesehen, bei öffentlichen Anlässen, auf dem Markt. Einmal hatte ihr Blick den seinen getroffen, für einen Herzschlag lang, und er hatte geglaubt, in diesen dunklen Augen etwas zu sehen – Anerkennung? Neugier? Oder nur die höfliche Gleichgültigkeit, mit der schöne Frauen die Blicke von Männern zur Kenntnis nehmen?
„Tu es", sagte er leise. „Sprich mit ihr. Aber Pandaros – bitte, mach mich nicht lächerlich."
„Würde ich nie wagen." Pandaros klopfte ihm auf die Schulter. „Vertrau deinem alten Onkel. Ich habe schon ganz andere Dinge ins Rollen gebracht."
Er watschelte davon, und Troilus blieb allein zurück auf der Mauer. Die Sonne stieg höher, und mit ihr die Hitze. Bald würden die Griechen wieder ausrücken, vielleicht würde es heute eine Schlacht geben. Hektor würde die Männer anführen, wie immer. Paris würde sich aufplustern wie ein Pfau. Aeneas würde solide und verlässlich kämpfen. Und Troilus würde mit dabei sein, würde in die Speere und Schwerter der Achaier rennen, würde töten und vielleicht getötet werden.
Aber in diesem Moment war nichts davon real. Real war nur das weiße Haus mit dem Granatapfelbaum, und die Frau, die darin wohnte, und die verzehrende Hoffnung, dass sie vielleicht, nur vielleicht, einen zweiten Blick auf ihn verwenden würde.
Cressida erwachte spät, wie es ihre Gewohnheit war. Die Sonne fiel bereits in hellen Streifen durch die Fensterläden und zeichnete Muster auf den Boden ihres Schlafzimmers. Sie blieb noch einen Moment liegen, die Augen geschlossen, und genoss diese kurze Phase zwischen Traum und Wirklichkeit, in der die Welt noch nicht ihre Forderungen stellte.
Dann kamen die Gedanken. Sie kamen immer.
Sie war allein. Das war das Wichtigste, das Grundlegende, das alles andere bestimmte. Ihr Vater, Calchas, war fort – hatte die Stadt verlassen, war zu den Griechen übergelaufen mit der Begründung, er habe in seinen Visionen Trojas Fall gesehen und wolle nicht mit der verfluchten Stadt untergehen. Ob das stimmte oder ob er einfach ein Feigling war, wusste Cressida nicht. Was sie wusste, war, dass er sie zurückgelassen hatte.
Eine Frau allein in einer belagerten Stadt. Ohne Vater, ohne Brüder, ohne Ehemann. Das war gefährlich. Sie hatte einen gewissen Schutz durch ihren Status – sie war immerhin die Tochter eines Priesters, auch wenn dieser Priester jetzt ein Verräter war. Aber Status war ein dünner Schild in Zeiten wie diesen.
Sie stand auf, trat ans Fenster und öffnete die Läden. Der Granatapfelbaum im Hof stand in vollem Laub, die Früchte noch klein und grün. Sie würde sie nie reif werden sehen, das wusste sie mit einer Sicherheit, die keiner Prophetie bedurfte. Entweder würde die Stadt fallen, oder sie würde... was? Heiraten? Fliehen? Sterben?
„Guten Morgen, Herrin." Ihre Dienerin, eine alte Frau namens Alexiare, kam mit einem Krug Wasser herein. „Ihr habt lange geschlafen."
„Ich hatte keine Eile aufzustehen", sagte Cressida. „Was sollte ich auch tun? Weben? Beten? Auf das Ende warten?"
Alexiare seufzte. Sie war alt genug, um solche Stimmungen nicht mehr persönlich zu nehmen. „Lord Pandaros ist unten. Er bittet um eine Audienz."
Cressida zog eine Augenbraue hoch. Pandaros. Den hatte sie seit Wochen nicht gesehen. Er war ein Freund ihres Vaters gewesen – oder zumindest ein Bekannter. Was wollte er?
„Sag ihm, ich komme gleich."
Sie wusch sich hastig, zog ein einfaches dunkelblaues Kleid an, nichts Auffälliges. Cressida hatte gelernt, nicht zu auffällig zu sein. Schönheit war ein zweischneidiges Schwert – es öffnete Türen, aber es zog auch unerwünschte Aufmerksamkeit an. Sie wusste, dass Männer sie ansahen. Sie hatte gelernt, diese Blicke zu lesen, zu kategorisieren, sich zu schützen.
Pandaros wartete im Empfangsraum, er stand am Fenster und betrachtete den Granatapfelbaum. Als sie eintrat, drehte er sich um und verbeugte sich.
„Cressida. Wie schön, dich zu sehen. Du siehst gut aus."
„Du lügst mit der Leichtigkeit eines Höflings", sagte sie, aber sie lächelte. Pandaros war harmlos – ungefährlich auf eine Art, die selten war in dieser Stadt voller angespannter Krieger. „Was führt dich zu mir?"
„Kann ein alter Mann nicht einfach eine schöne junge Frau besuchen?"
„Nein", sagte Cressida schlicht. „Nicht in Troja. Nicht jetzt. Also, was willst du wirklich?"
Pandaros lachte. „Du bist zu klug für dein eigenes Wohl, weißt du das? Gut. Ich respektiere Direktheit." Er setzte sich auf eine der Bänke, deutete ihr an, sich ebenfalls zu setzen. „Ich komme im Namen meines Neffen."
„Du hast mehrere Neffen."
„Troilus", sagte Pandaros, und beobachtete sie genau.
Cressida blinzelte nicht, ließ sich nichts anmerken. Aber ihr Herz machte einen kleinen, verräterischen Sprung. Troilus. Den jungen Prinzen. Sie hatte ihn natürlich gesehen – man konnte ihn kaum übersehen, wenn man in Troja lebte. Er war schön auf eine fast schmerzhafte Art, mit seiner Jugend und seinem Feuer. Und er hatte sie angestarrt, bei mehr als einer Gelegenheit, mit einer Intensität, die beinahe unangenehm war.
„Was ist mit ihm?" Ihre Stimme war neutral.
„Er ist verliebt in dich." Pandaros sagte es einfach, ohne Umschweife. „Bis über beide Ohren. Kann nicht schlafen, kann nicht essen. Steht auf den Mauern und starrt auf dein Haus. Es wäre rührend, wenn es nicht so peinlich wäre."
Cressida sagte nichts. Sie dachte nach, berechnete. Ein Prinz von Troja, verliebt in sie. Das konnte nützlich sein. Oder gefährlich. Oder beides.
„Warum erzählst du mir das?" fragte sie schließlich.
„Weil er zu stolz ist, um es selbst zu tun. Und weil ich glaube, dass ihr beide... dass ihr etwas gemeinsam haben könntet." Pandaros lehnte sich zurück. „Hör zu. Ich weiß, in welcher Position du bist. Dein Vater hat dich im Stich gelassen. Die Leute reden. Du brauchst Schutz, einen Verbündeten. Troilus ist ein guter Junge – ja, ein Junge noch, ich weiß. Aber er ist ehrlich, er ist tapfer, und er ist wahnsinnig in dich vernarrt. Du könntest es schlechter treffen."
„Du sprichst, als würdest du einen Handel vorschlagen."
„Ist es nicht das, was alle Beziehungen sind? Handel?" Pandaros' Augen glitzerten. „Aber nein, ich spreche nicht von einer Geschäftsvereinbarung. Ich spreche von... einer Möglichkeit. Triff ihn. Sprich mit ihm. Sieh selbst, was du denkst. Wenn du nicht interessiert bist, dann ist nichts verloren. Wenn doch... nun, dann sehen wir weiter."
Cressida stand auf, ging zum Fenster. Draußen spielten Kinder in der Gasse, ihre Schreie schrill und fröhlich. Wie konnten sie so unbeschwert sein, in einer Stadt, die jeden Tag dem Untergang ein Stück näher rutschte?
„Ich bin nicht naiv", sagte sie leise. „Ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ein Prinz verliebt sich nicht einfach in die Tochter eines Verräters. Er begehrt, ja. Aber Liebe? Das ist ein großes Wort."
„Vielleicht. Aber sein Begehren ist echt. Und wer weiß? Vielleicht kann Begehren zu etwas mehr werden. Es ist jedenfalls passiert."
Cressida drehte sich um. „Und was erwartest du dafür? Was ist dein Anteil an diesem... Handel?"
Pandaros lachte. „Ach, du durchschaust mich. Ich erwarte nichts. Oder, wenn ich ehrlich bin: Ich erwarte Unterhaltung. Eine gute Geschichte. Vielleicht den Dank eines Neffen, wenn alles gut geht. Und..." er wurde ernster, „vielleicht die Genugtuung zu wissen, dass ich einem einsamen Mädchen geholfen habe, das es verdient hat, glücklich zu sein."
„Glücklich." Cressida kostete das Wort, als wäre es etwas Exotisches, etwas, das sie lange nicht geschmeckt hatte. „Das ist ein seltsames Konzept in Kriegszeiten."
„Umso wichtiger, es zu suchen, wo man es finden kann."
Sie betrachtete ihn lange. Pandaros hatte etwas Schlaues an sich, etwas Berechnetes. Aber er hatte auch recht. Sie brauchte einen Verbündeten. Und Troilus... Troilus war nicht der Schlechteste, den sie wählen konnte. Er war jung, ja. Vielleicht formbar. Vielleicht aufrichtig in einer Welt voller Lügen.
„Ein Treffen", sagte sie schließlich. „Hier, in meinem Haus. Mit dir anwesend, als Anstandsdame, sozusagen. Nichts Offizielles, nichts Verbindliches. Nur... ein Gespräch."
Pandaros strahlte. „Das ist alles, worum ich bitte. Du wirst sehen, er ist ein guter Junge. Etwas übereifrig vielleicht, aber das kommt von Jugend und Leidenschaft."
„Wann?" fragte Cressida.
„Heute Abend? Nach dem Abendessen? Die Straßen sind dann ruhig, niemand wird es bemerken."
Sie nickte. „Heute Abend dann."
Als Pandaros gegangen war, stand Cressida noch lange am Fenster. Sie dachte an den jungen Prinzen mit seinen intensiven Augen, der sie angestarrt hatte, als könnte er durch bloßes Anschauen ihr Innerstes erfassen. Sie dachte an die Gefahr und an die Möglichkeit. Sie dachte daran, dass sie allein war und dass Alleinsein in dieser Welt ein langsames Sterben bedeutete.
Und sie dachte, dass vielleicht, nur vielleicht, in dieser einen Sache das Begehren eines jungen Mannes und ihre eigene Notwendigkeit sich zu etwas fügen könnten, das beiden diente.
Sie war nicht naiv genug, um an Liebe zu glauben. Aber an Überleben – daran glaubte sie. Und wenn ein verliebter Prinz ihr Werkzeug zum Überleben sein konnte, dann würde sie dieses Werkzeug nutzen.
Auch wenn sie dabei so tun musste, als wäre sie selbst verliebt.
Das war das Spiel. Und Cressida hatte gelernt zu spielen.
Kapitel 2: Die Griechen und ihr Groll
Das griechische Lager am Strand vor Troja stank. Es stank nach neun Jahren unbegrabener Hoffnungen, nach Schweiß und Fäkalien, nach verrottendem Holz und dem salzigen Gestank des Meeres, das gleichgültig gegen das Ufer schlug, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Tausende von Männern lebten hier in einem provisorischen Zustand, der längst nicht mehr provisorisch war, sondern zur einzigen Realität geworden war, die sie kannten.
Die schwarzen Schiffe, mit denen sie gekommen waren – stolz und kampfbereit, getragen von Träumen von schnellem Ruhm und reicher Beute – lagen nun halb versandet da, ihre Rümpfe von Muscheln überkrustet, ihre Segel zerfetzt oder längst zu anderen Zwecken verwendet. Manche dienten als Dächer für die Unterkünfte, die sich zwischen den Schiffen ausbreiteten wie ein Geschwür. Eine Stadt aus Zelten und Hütten, aus Wut und Langeweile.
Agamemnon, Oberbefehlshaber der vereinten griechischen Heere, König von Mykene, Herr über Herren, saß in seinem Zelt und starrte auf eine Karte von Troja, die auf einem Tisch ausgebreitet lag. Die Karte war nutzlos – er kannte jede Linie, jeden Winkel dieser verfluchten Stadt. Er hatte sie so oft angestarrt, dass er sie im Schlaf hätte zeichnen können.
„Neun Jahre", sagte er zu niemand Bestimmten. Sein Bruder Menelaos saß in einer Ecke, ein Becher Wein in der Hand, und sah genauso müde aus, wie Agamemnon sich fühlte. „Neun verdammte Jahre für eine Frau."
„Sie ist meine Frau", sagte Menelaos, aber ohne Überzeugung. Er hatte diese Worte so oft gesagt, dass sie ihre Bedeutung verloren hatten. Helena. Die schöne Helena, die mit Paris nach Troja geflohen war – oder entführt worden war, je nachdem, wen man fragte. Der Grund für diesen endlosen, sinnlosen Krieg.
„Sie ist ein Vorwand", knurrte Agamemnon. „Das war sie von Anfang an. Wir sind hier für Ruhm, für Beute, für Macht. Troja ist reich, seine Mauern bergen Schätze. Das ist es, worum es wirklich geht."
„Und trotzdem", sagte eine dritte Stimme, „kommen wir nicht durch diese Mauern."
Odysseus stand im Eingang des Zeltes, die Arme verschränkt. Er war kleiner als die meisten anderen Anführer, gedrungen und muskulös, mit einem Gesicht, das zu klug wirkte, um vertrauenswürdig zu sein. Odysseus von Ithaka, der Listenreiche, der Mann mit tausend Plänen.
„Komm rein oder bleib draußen, aber lurk nicht im Eingang herum wie ein Dieb", sagte Agamemnon gereizt.
Odysseus trat ein. „Ich komme von den Kriegsräten der anderen Anführer. Die Stimmung ist... schlecht."
„Die Stimmung ist seit Monaten schlecht", sagte Agamemnon.
„Sie wird schlechter. Die Männer reden von nach Hause gehen. Sie sagen, die Götter sind gegen uns. Sie sagen, Troja wird nie fallen."
„Die Männer sind Idioten."
„Die Männer sind müde", korrigierte Odysseus. „Und sie haben recht, müde zu sein. Wir gewinnen keine Schlachten mehr. Wir verlieren keine Schlachten mehr. Wir... existieren. Das ist keine Art, einen Krieg zu führen."
Agamemnon schlug mit der Faust auf den Tisch. Die Karte sprang. „Und warum gewinnen wir keine Schlachten? Weil unser bester Kämpfer in seinem Zelt sitzt und schmollt wie ein beleidigte Kind!"
Alle wussten, von wem er sprach. Achill. Der Name hing in der Luft wie ein bitterer Rauch.
„Er weigert sich immer noch?" fragte Menelaos, obwohl er die Antwort kannte.
„Er weigert sich", bestätigte Odysseus. „Seit du ihm seine Kriegsbeute weggenommen hast – das Mädchen, Briseis – kämpft er nicht mehr. Er und seine Myrmidonen bleiben in ihrem Lager. Sie trainieren, sie essen, sie tun alles außer kämpfen."
„Ich bin der Oberbefehlshaber", sagte Agamemnon, aber selbst er hörte, wie hohl das klang. „Ich hatte das Recht, das Mädchen zu nehmen. Er hatte kein Recht, mir zu widersprechen."
„Recht hin oder her", sagte Odysseus pragmatisch, „ohne Achill sind wir zahnlos. Die Trojaner wissen das. Hektor lacht über uns."
„Dann geh zu Achill", fauchte Agamemnon. „Du mit deinen schlauen Worten. Überrede ihn. Beschwichtige ihn. Tu, was auch immer nötig ist."
„Ich habe es versucht. Wir haben es alle versucht." Odysseus' Stimme war ruhig. „Er hört nicht zu. Sein Stolz ist verletzt, und Achills Stolz ist... beträchtlich."
In diesem Moment betrat Nestor das Zelt. Der alte König von Pylos bewegte sich langsam, gestützt auf einen Stock, aber seine Augen waren scharf. Er war der Älteste unter den Anführern, hatte schon gegen Generationen gekämpft, die nun tot und vergessen waren.
„Ich habe euer Geschrei bis zu meinem Zelt gehört", sagte er mit erstaunlich kräftiger Stimme für sein Alter. „Streit ihr euch schon wieder über Achill?"
„Was sollten wir sonst tun?" fragte Agamemnon bitter. „Alles dreht sich um Achill. Ob er kämpft oder nicht kämpft. Ob sein verdammter Stolz verletzt ist oder nicht."
Nestor setzte sich umständlich auf einen Stuhl. „Als ich jung war – und das ist sehr lange her – da lernte ich eine wichtige Lektion. Manche Männer kann man nicht befehligen. Man kann sie nur... lenken."
„Lenken?" Agamemnon schnaubte. „Wie lenkt man einen Sturm?"
„Indem man ihm etwas gibt, gegen das er wüten kann." Nestor faltete die Hände über seinem Stock. „Achills Problem ist nicht nur Briseis. Sein Problem ist, dass er sich gelangweilt hat. Er ist ein Mann, der für den Kampf geboren wurde, für den Ruhm. Ohne das... verkümmert er. Er wird bitter."
„Er ist bereits bitter", bemerkte Menelaos.
„Dann müssen wir ihm etwas geben, das seinen Appetit wieder weckt." Nestor sah zu Odysseus. „Du bist der Klügste von uns. Was schlägst du vor?"
Odysseus dachte nach, seine Finger trommelten gegen seine Arme. „Achills Schwäche ist sein Stolz. Aber es ist auch seine Stärke. Er glaubt, er sei der größte Krieger, der je gelebt hat."
„Das ist er wohl auch", murmelte Menelaos.
„Vielleicht. Aber was, wenn wir einen anderen erheben? Was, wenn wir jemand anderen als unseren Champion präsentieren? Ajax zum Beispiel."
„Ajax?" Agamemnon zog die Augenbrauen hoch. „Der ist stark wie ein Ochse und etwa genauso klug."
„Genau. Aber er ist auch loyal, und er ist beeindruckend im Kampf. Die Trojaner respektieren ihn. Wenn wir Ajax als unseren Champion aufbauen, Ajax die Ehre geben, die Achill glaubt, dass sie ihm zusteht... vielleicht wird das Achills Eifersucht wecken."
„Du willst ihn eifersüchtig machen wie ein kleines Kind?" Agamemnon klang skeptisch.
„Ich will ihn daran erinnern, wer er ist. Ein Krieger. Ein Held. Jemand, der es nicht ertragen kann, in zweiter Reihe zu stehen." Odysseus lächelte dünn. „Achill wird es nicht ertragen können, Ajax im Rampenlicht zu sehen. Es wird ihn auffressen. Und vielleicht... vielleicht bringt ihn das zurück auf das Schlachtfeld."
Nestor nickte langsam. „Clever. Riskant, aber clever. Wenn es funktioniert, haben wir unseren besten Kämpfer zurück. Wenn nicht..."
„Wenn nicht, dann sind wir auch nicht schlechter dran als jetzt", vollendete Odysseus.
Agamemnon dachte nach. Er mochte Manipulation nicht – er zog direkte Gewalt vor. Aber er war auch Realist genug, um zu erkennen, dass direkte Gewalt hier nicht funktionierte.
„Gut", sagte er schließlich. „Mach es. Baue Ajax auf. Gib ihm Ehren. Lass ihn glänzen. Und wir werden sehen, ob Achill darauf reagiert."
„Es gibt noch etwas", sagte Odysseus. „Die Trojaner haben eine Herausforderung geschickt. Hektor will einen Zweikampf. Einer ihrer Champions gegen einen unserer Champions."
„Natürlich will er das", sagte Agamemnon. „Hektor sucht persönlichen Ruhm. Typisch für diese Trojaner – alles Schauspiel und Ehre, während wir hier im Dreck verrecken."
„Wir sollten annehmen", sagte Nestor. „Ein Zweikampf hebt die Moral. Und es ist eine Gelegenheit, Ajax zu präsentieren."
„Ajax gegen Hektor?" Menelaos klang besorgt. „Hektor ist... Hektor ist gefährlich."
„Ajax wird nicht verlieren", sagte Odysseus mit einer Sicherheit, die er nicht fühlte. „Und selbst wenn – ein ehrenhafter Tod im Zweikampf ist besser als dieses langsame Verrotten."
Agamemnon nickte. „Einverstanden. Sag den Trojanern, wir akzeptieren ihre Herausforderung. Unser Champion wird... wer auch immer durch Los bestimmt wird." Er sah zu Odysseus. „Sorge dafür, dass das Los auf Ajax fällt."
Odysseus lächelte. „Natürlich."
Achills Lager lag am Rand des griechischen Camps, fast schon abgetrennt vom Rest. Seine Myrmidonen – die Krieger, die er aus seiner Heimat Phthia mitgebracht hatte – waren loyal nur ihm. Sie trugen ihre eigenen Farben, folgten ihren eigenen Regeln. Sie waren eine Armee in der Armee, und Achill war ihr ungekrönter König.
Das Zelt des Achill war größer als das der anderen Anführer, luxuriöser. Teppiche aus dem Osten lagen auf dem Boden, erbeutet in früheren Feldzügen. Waffen hingen an den Wänden – nicht nur seine eigenen, sondern auch die besiegter Gegner, Trophäen seiner Siege.
Achill selbst saß auf einem niedrigen Sofa, eine Leier in der Hand. Er spielte nicht besonders gut, aber er spielte – eine melancholische Melodie, die die Leere in seinem Herzen widerspiegelte. Er war schön auf eine Art, die fast weiblich wirkte – goldene Locken, feine Züge, ein Körper, der trotz seiner tödlichen Kraft eine gewisse Anmut hatte. Aber seine Augen waren kalt. Das war das Erste, was Menschen an Achill bemerkten – diese eisigen, tödlichen Augen.
Patroklos saß neben ihm, beobachtete ihn. Patroklos war älter, ruhiger, weniger auffällig. Wo Achill das Feuer war, war Patroklos das Wasser – nicht weniger notwendig, aber weniger offensichtlich. Sie waren seit ihrer Kindheit zusammen gewesen, hatten zusammen gelernt, zusammen gekämpft. Manche sagten, sie seien Liebende. Manche sagten, sie seien Brüder. Manche sagten, sie seien zwei Hälften derselben Seele. Vielleicht war alles davon wahr.
„Du wirst deine Finger wund spielen", sagte Patroklos leise.
„Dann spiele ich mit wunden Fingern", antwortete Achill, ohne aufzusehen. „Was soll ich sonst tun? Kämpfen? Für Agamemnon?"
„Nicht für Agamemnon. Für die Sache. Für Griechenland."
„Griechenland." Achill legte die Leier beiseite. „Was ist Griechenland? Ein Haufen streitender Könige, die sich nur einig sind in ihrer Gier. Agamemnon will Macht. Menelaos will seine Frau zurück, oder zumindest will er so tun, als würde er sie wollen. Odysseus will... was auch immer Odysseus will, man weiß es nie genau. Und ich? Was will ich?"
„Ruhm", sagte Patroklos einfach. „Du hast es immer gewollt. Unsterblichen Ruhm."
„Ruhm." Achill kostete das Wort. „Meine Mutter – die Göttin Thetis – hat mir eine Prophezeiung gegeben. Zwei Schicksale liegen vor mir. Entweder bleibe ich hier, kämpfe vor Troja und sterbe jung, aber mein Name wird für immer erinnert werden. Oder ich gehe nach Hause, lebe ein langes, ruhiges Leben und werde vergessen, sobald meine Enkel sterben."
„Ich kenne die Prophezeiung", sagte Patroklos geduldig. Sie hatten diese Unterhaltung schon hundertmal geführt.
„Und ich habe meine Wahl getroffen. Ich bin hier. Ich habe mich für den Ruhm entschieden." Achill stand auf, begann im Zelt auf und ab zu gehen wie ein eingesperrtes Tier. „Aber was ist Ruhm ohne Kampf? Was ist Ruhm, wenn ich hier sitze und verrottete, während andere die Lorbeeren ernten?"
„Dann kämpfe."
„Nicht für Agamemnon. Nie wieder für ihn." Achills Stimme war hart. „Er hat mich beleidigt. Hat mir meine rechtmäßige Beute weggenommen, hat mich vor allen anderen gedemütigt. Glaubt er, er kann mich so behandeln und ich komme kriechend zurück?"
„Er ist der Oberbefehlshaber."
„Er ist ein Narr. Ein machthungriger Narr, der nicht versteht, dass Macht ohne Respekt nichts wert ist."
Patroklos seufzte. „Und was ist dein Stolz wert, wenn wir hier sitzen und langsam irrelevant werden? Die Myrmidonen werden unruhig, Achill. Sie sind Krieger. Sie wollen kämpfen."
„Dann sollen sie kämpfen. Ich halte niemanden zurück."
„Du weißt, dass sie nicht ohne dich kämpfen werden. Sie sind dir loyal, nicht Agamemnon."
Achill blieb stehen, sah aus dem Zelt hinaus auf das Meer. Die Wellen rollten heran, endlos und gleichgültig. Irgendwo da draußen lag Phthia, seine Heimat. Er hätte nach Hause gehen können. Hätte diese ganze verfluchte Sache hinter sich lassen können.
Aber er wusste, er würde es nicht tun. Nicht weil er Griechenland liebte oder weil er Agamemnon respektierte. Sondern weil Patroklos recht hatte – er wollte Ruhm. Brauchte ihn. Es war wie eine Sucht, die in seinen Adern brannte.
„Sie werden kommen", sagte Achill leise. „Agamemnon, oder einer seiner Lakaien. Sie werden kommen und betteln, dass ich zurückkomme. Und ich werde nein sagen. Und dann werden sie mehr bieten. Und ich werde wieder nein sagen. Bis..."
„Bis was?"
„Bis er auf den Knien zu mir kriecht und zugibt, dass er falsch lag. Dass ich der Größte bin. Dass er ohne mich nichts ist."
Patroklos sagte nichts. Er kannte Achill gut genug, um zu wissen, dass manche Dinge gesagt werden mussten, auch wenn sie unrealistisch waren.
In diesem Moment hörten sie eine Stimme von draußen – eine kratzige, höhnische Stimme, die jedem das Blut in den Adern gefrieren ließ.
„Oh, seht mal! Der große Achill, versteckt in seinem Zelt wie eine verschreckte Jungfrau! Wie furchterregend! Wie heldenhaft!"
Thersites. Der hässlichste, gemeinste, zynischste Mann im gesamten griechischen Heer. Niemand wusste genau, warum er hier war – er war kein Krieger, kein Adliger, hatte keine erkennbare Funktion außer, jeden zu beleidigen, der in Hörweite kam. Aber er war hier, hatte neun Jahre überlebt durch schiere Bosheit und die Tatsache, dass er zu unbedeutend war, um getötet zu werden.
Achill trat aus dem Zelt. Thersites stand da – klein, bucklig, mit einem Gesicht, das aussah wie eine schlechte Karikatur eines Menschen. Seine Augen waren klein und gemein, aber sie glitzerten mit einer Art von Intelligenz, die gefährlicher war als jedes Schwert.
„Was willst du?" fragte Achill kalt.
„Ich? Nichts. Ich bin nur hier, um das Schauspiel zu genießen. Den großen Achill, der schmollt. Den unbesiegbaren Krieger, der nicht kämpft. Es ist besser als jedes Theater!"
„Verschwinde, bevor ich dir die Zunge rausreiße."
„Oh, Gewalt! Wie originell! Ist das alles, was ihr Muskelprotze könnt? Drohen und schlagen?" Thersites grinste, zeigte verfaulte Zähne. „Ich sage nur die Wahrheit. Ihr führt einen Krieg für die Fotze einer Frau. Agamemnon und Menelaos, die Bruder-Könige, streiten sich um Helena wie Hunde um einen Knochen. Und du, Achill, du sitzt hier und spielst Leier wie ein empfindsamer Dichter, weil dein Stolz verletzt ist. Es ist lächerlich! Alles ist lächerlich!"
Patroklos trat vor, seine Hand am Schwertgriff. „Geh, Thersites. Heute ist nicht der Tag, um Achill zu provozieren."
„Jeden Tag ist der richtige Tag, um euch alle zu provozieren!" Thersites spuckte auf den Boden. „Ihr denkt, ihr seid Helden. Göttergleich. Aber ihr seid nur Menschen – dumme, stolze, eitle Menschen, die für nichts sterben werden. Troja wird nicht fallen. Die Götter lachen über euch. Und ich lache mit ihnen!"
Achill machte einen Schritt auf ihn zu, und einen Moment lang sah es aus, als würde er Thersites tatsächlich töten. Aber dann hielt er inne. Etwas in den Worten des Buckligen hatte ihn getroffen – nicht weil sie falsch waren, sondern weil sie zu wahr waren.
„Geh", sagte Achill leise, aber es war die Art von Stille, die gefährlicher war als jedes Schreien.
Thersites sah ihn an, und für einen Moment blitzte etwas in seinen Augen auf – Respekt? Angst? Verständnis? Dann humpelte er davon, murmelte weiter Beleidigungen vor sich hin.
Patroklos legte eine Hand auf Achills Schulter. „Ignoriere ihn. Er ist verrückt."
„Vielleicht", sagte Achill. „Oder vielleicht ist er der Einzige, der die Wahrheit sieht. Vielleicht ist das alles hier wirklich lächerlich."
„Dann geh nach Hause."
„Nein." Achill schüttelte den Kopf. „Noch nicht. Noch nicht."
Er ging zurück ins Zelt, und Patroklos folgte ihm. Draußen setzte die Dämmerung ein, und das griechische Lager versank in die vertraute Routine von Abendessen und Wachen, von Geschichten und Lügen, von weiteren Tagen des Wartens auf ein Ende, das nie zu kommen schien.
Und Achill saß in seinem Zelt und starrte an die Decke und dachte an Ruhm und an Prophezeiungen und an die langsame, quälende Frage: Was war er ohne den Krieg? Was war er ohne den Kampf?
Nichts, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf. Ohne Krieg bist du nichts.
Und das war das Schlimmste daran.
Kapitel 3: List und Hierarchie
Der Morgen brach kalt über das griechische Lager herein, und mit ihm kam Odysseus' Plan ins Rollen. Er hatte die Nacht damit verbracht, mit den anderen Anführern zu sprechen – hier ein Wort, dort ein Vorschlag. Odysseus war ein Meister der subtilen Manipulation. Er befahl nie direkt; er ließ die Menschen glauben, seine Ideen seien ihre eigenen.
Ajax der Große, Sohn des Telamon, war in seinem Zelt und frühstückte, als Odysseus eintrat. Ajax war ein Berg von einem Mann – breitschultrig, mit Armen dick wie Baumstämme und einem Gesicht, das von unzähligen Kämpfen gezeichnet war. Neben Achill galt er als der stärkste Krieger der Griechen, aber wo Achill Feuer und Eleganz war, war Ajax rohe Kraft und Beharrlichkeit.