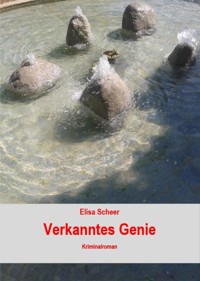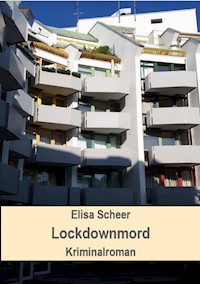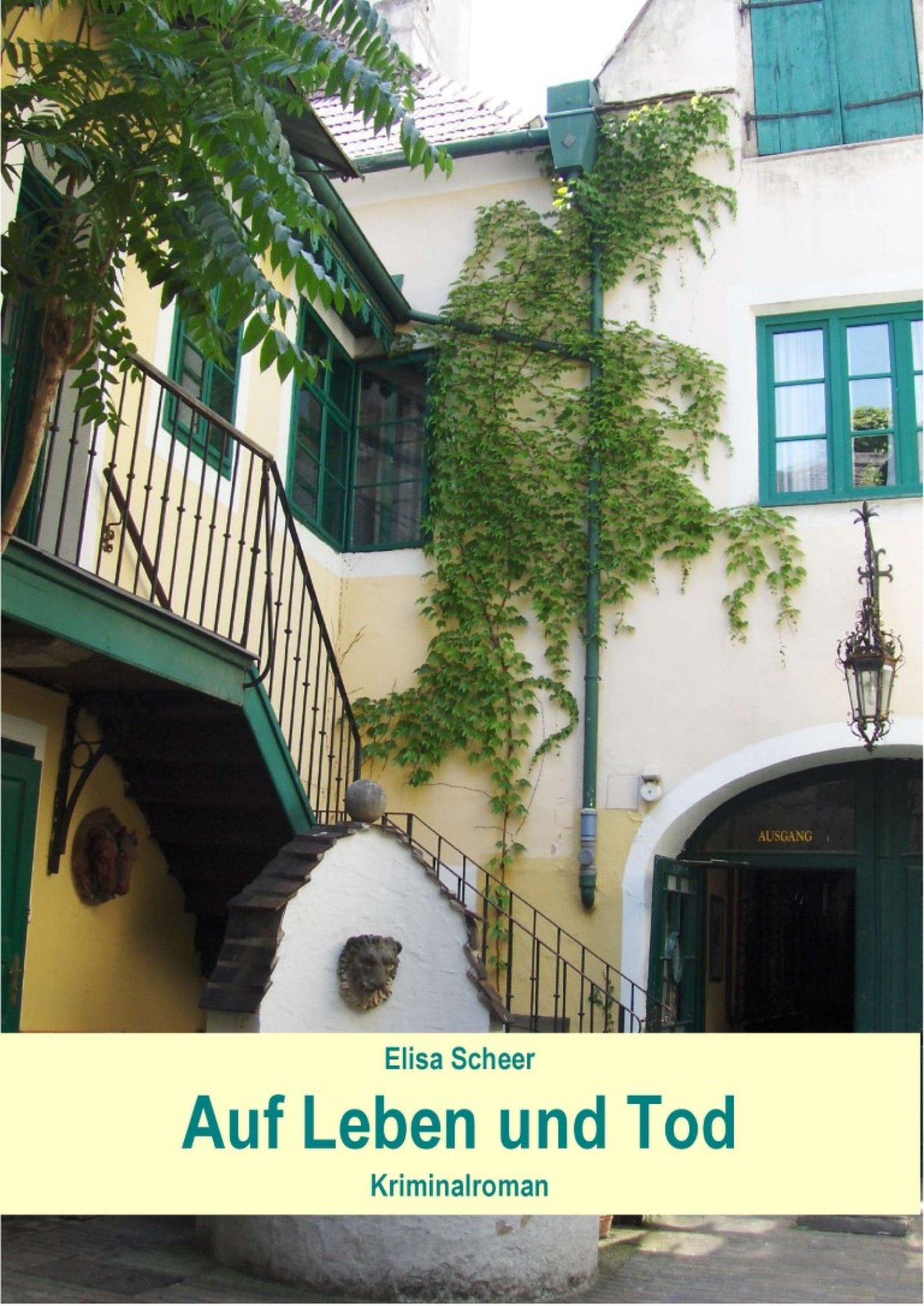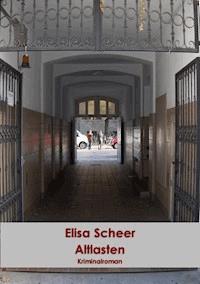Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Eigentlich will Hélène bald heiraten, allerdings hat sie keine Lust auf das aufwendige Hochzeitsfest, das ihre künftigen Schwiegereltern planen - und ihr Werner wird auch immer mehr zum Pascha. Rätselhafte Unterschlagungen und Fehlbuchungen in der Firma, in der sie die Finanzplanung macht, lenken sie von ihrem häuslichen Ärger ab - und dann trifft sie im Firmenaufzug den bildschönen Stefan und verliebt sich sofort rettungslos. Aber was will Stefan bei Elastochic? Jobs abbauen? Die Unterschlagungen aufklären? Und wie soll sie Werner erklären, dass sie ihn betrogen hat? Ach was - wie soll sie Werner erklären, dass sie ihn gar nicht mehr heiraten will? Die Jagd nach dem Betrüger bringt auch Hélènes Job (und ihr Selbstverständnis) in Gefahr, und als auch noch ein Mord geschieht, erkennen Hélène und Stefan, dass sie in Lebensgefahr schweben. Eine atemlose Jagd bringt schließlich die Auflösung...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alles frei erfunden!
1
Puh, war es hier voll! Ich verstand gar nicht mehr, warum ich ausgerechnet am Karsamstag in die Stadt gewollt hatte. Sämtliche Idioten der Stadt – und hierzulande gab es ungewöhnlich viele Idioten, so kam es mir manchmal vor – schoben sich durch die Kaufhäuser und über den Markt, drängten sich um die Stände, an denen Osterschmuck und sonstiger Tinnef verkauft wurde, standen mir pausenlos im Weg oder drängten von hinten.
Ich arbeitete mich durch das Gewühl, kaufte die Ostereier, auf die Werner so großen Wert legte (vor allem bei Nougat und Knickebein schüttelte ich mich innerlich), fand auch fertige bemalte Eier, die man an den Osterstrauch hängen konnte, nahm im Vorübergehen das Duschgel mit, das mir schon fast ausgegangen war, wischte mir den Schweiß von der Stirn und überlegte, was ich Werner zu Ostern schenken sollte, versteckt in einem dieser großen Pappmaché-Eier mit der Bemalung im Stil der Fünfziger Jahre. Ein Aftershave? Eine Krawatte? Einfallslos. Ein richtig schönes T-Shirt? Aber dann musste ich ja noch einmal in den dritten Stock... Boxershorts mit Osterhäschen drauf? Warum nicht, so etwas fand er sicher lustig. Eine Opern-CD? La Bohème hatte er noch nicht, glaubte ich, als ich im Geiste das CD-Regal durchging. Gut, CDs gab es im Erdgeschoss, das war weniger anstrengend.
Ich wühlte mich in die Medienabteilung durch, vorbei an der endlosen Schlange vor der Oster-Sonderflächen-Kasse, und blätterte hastig die eher bescheidene CD-Auswahl durch. Aktuelle Hits gab es reichlich, aber La Bohème? Da! Sogar zwei verschiedene Interpretationen. Was war besser, Boston Symphony Orchestra oder Wiener Philharmoniker? Ich dachte an Werner und seine Faszination für die USA und nahm die Bostoner Variante. Geschenkpapier auch noch? Nein, das Papp-Ei, das mich stark an die Häschenschule aus meiner eigenen Kindheit erinnerte, reichte ja wohl. Etwas Ostergras noch. Mist, noch mal in die Schlange!
Als ich mit dem albernen Osterkram (verdammte Geldschneiderei des Einzelhandels) fertig war und mich aus dem Kaufhaus kämpfen konnte, war es schon fast elf. Da konnte ich ja nur froh sein, dass ich alle Lebensmittel schon gestern auf dem Heimweg von der Arbeit besorgt hatte! Wie immer, wenn solche Lästigkeiten anstanden, war Werner natürlich verhindert – gestern ein dringendes und hochwichtiges Meeting (kein Chef, der bei Verstand war, berief am Freitagnachmittag ein Meeting ein, das dann sein eigenes Wochenende verkürzte!), heute musste er unbedingt seinen Wagen zur Inspektion bringen und mit dem Mechaniker über das Klappergeräusch sprechen, das er in letzter Zeit beim Rechtsabbiegen gehört hatte. Typisch! Gegenüber dem Kaufhaus lag das Pumps. Brautschuhe musste ich mir irgendwann auch noch kaufen, fiel mir ein. Es war zwar Blödsinn, Schuhe zu kaufen, bevor ich wusste, wie das Kleid aussehen würde, aber ich konnte ja mal einen Blick riskieren... Seufzend verstaute ich meine Einkäufe etwas geschickter, nahm an einem der Marktstände noch ein Päckchen Färbetabletten mit und betrat das Pumps, einen riesigen Schuppen, in dem die Schuhe ringsherum auf Birkenholzregalen standen – immer nur der linke Schuh, den rechten musste man sich bringen lassen. In der Mitte stand ein großes rundes Sofa aus knalllila Plüsch, für die Anproben, und wie üblich ließ sich keine Verkäuferin sehen. Ich strich langsam an den Regalen entlang, bis ich Größe vierzig gefunden hatte. Toll war die Auswahl nicht, fand ich.
Zehn Zentimeter hohe, hauchdünne Absätze, mit bunten Glitzersteinen besetzt. So geschmackvoll wie die Trauringe in Vier Hochzeiten und ein Todesfall! Der gesamte Schuh war aus schwarzem Lackleder gefertigt, aus der billigen Qualität, die sofort Risse kriegte. Ich drehte ihn interessehalber um und keuchte auf – zweihundertneunundzwanzig Euro? Das waren ja fast vierhundertsechzig Mark? Ohne Umrechnen kam ich mit dem neuen Geld immer noch nicht zurecht, eigentlich ein Armutszeugnis für jemanden, der den ganzen Tag mit Geld zu tun hatte.
Das Prachtstück daneben war rot, ein herrliches, hundsordinäres Rot. Wildleder, Absätze, mit denen man keinen Schritt tun konnte, ohne sich einen doppelten Bänderriss zu holen. Ich spielte kurz mit dem Gedanken, solche Schuhe unter weißer bodenlanger Seide hervorblitzen zu lassen und die ganze verdammte Familie in den Kirchenbänken in Ohnmacht fallen zu lassen. Vielleicht sollte die bodenlange weiße Seide auch noch bis zur Hüfte geschlitzt sein, darunter rote Strumpfbänder... Nein, das wäre zu grausam.
Fliederfarbene Seide, mit elfenbeinfarbener Spitze besetzt. Für Unterwäsche ganz nett, aber als Schuh?
Schwarzes Wildleder, halbhoher Absatz, silberne Einfassungen. Gar nicht hässlich – aber über zweihundert Euro? So schön waren sie auch wieder nicht. Gab´s hier nichts in weiß? Ja, Sandälchen, hauchdünne Riemen auf gewaltigen Absätzen, die Riemchen mit Strasssternchen besetzt. Wenn ich nicht spätestens auf dem Weg zum Altar auf die Schnauze fliegen wollte, konnte ich diese Konstruktion auch vergessen. Außerdem war ich barfuß über 1.75 groß – mit solchen Schuhen würde ich den armen Werner noch überragen, kam ja überhaupt nicht in Frage!
Sonst hatten sie in Weiß überhaupt nichts, dafür eine Menge in Pink, Knalltürkis und Kobaltblau. Und jeder Schuh hatte irgendeine entstellende Verzierung – falsche Juwelen, Messingornamente, affige Stickereien, Löcher an den blödesten Stellen. Ich knallte den letzten Schuh ins Regal zurück und wandte mich schon zur Tür, als mein Blick auf die Blondine auf dem lila Sofa fiel, die von Schuhen umgeben dasaß und gerade zu versuchen schien, sich zwischen grauem Wildleder mit silbernen Sternchen und blauem Leder mit eingesticktem Edelweiß zu entscheiden. Scylla und Charybdis, dachte ich mir, da hob die Blondine den Kopf und quietschte. „Hélène!“
„Sonja?“, fragte ich ungläubig. „Was für ein Zufall!“
„Welche soll ich nehmen?“
„Das fragst du aber nicht im Ernst, oder?“
„Doch... die blauen passen zum Dirndl, die grauen genau zu meiner Lederjacke. Ach, ich nehm´ beide, was soll´s.“
Sie pfiff auf zwei Fingern, worauf eine Verkäuferin angetrabt kam und die beiden Schuhe ehrfürchtig in die jeweiligen Schachteln zum rechten Gegenstück legte. Fassungslos sah ich zu, wie Sonja lässig eine goldene Kreditkarte auf den gläsernen Tresen knallte und mal eben rund fünfhundert Euro für zwei Paar völlig überflüssige Schuhe abdrückte.
Danach wandte sie sich mir zu. „Hast du ein bisschen Zeit?“
Ich nickte. „Mit meinen Einkäufen bin ich durch, und hier hat mir eh nichts gefallen. Wollen wir ins Café Royal gehen?“
„Gute Idee. Ich hab den ganzen Nachmittag Zeit.“
„Ich nicht ganz, der blöde Osterkram schreit nach mir. Aber auf einen Kaffee hab ich jetzt Lust. Und brauchen tu ich ihn auch.“
Im Café Royal war es voll wie immer, aber auf der Terrasse gab es noch einen Platz in der Sonne, die für die Jahreszeit allzu intensiv herunterbrannte. Wir installierten uns mit unseren Taschen und Tüten und bestellten, Sonja einen Cappuccino, ich einen Espresso, ich hasste Milchschaum. „Und, was treibst du so?“, fragte ich dann. „Wenn ich mir ansehe, was du für Schuhe ausgibst, scheinst du ja nicht schlecht zu verdienen, oder?“
Sonja zuckte die Achseln. „Geht so. Schuhen konnte ich doch noch nie widerstehen. Ich arbeite bei einem Wirtschaftsprüfer, ist ganz nett. Und du?“
„Elastochic.“
Sonja prustete. „Was stellt ihr denn her? Stützstrumpfhosen? Ist das ein volkseigener Betrieb? Saublöder Name!“
„Ja, weiß ich. Aber wir produzieren Plastikgeschirr, trendige Ringbücher und allen Kram, den man aus Kunststoff machen kann. Im Moment vor allem aus diesem halbtransparenten Zeug in weiß und knallblau, kennst du bestimmt.“
„Ja, kann sein. Und was machst du da?“
„Ich arbeite in der Finanzabteilung, Buchhaltung, Finanzplanung, Marketing. Ist ganz interessant.“
„Immerhin, dann haben wir wenigstens beide was Brauchbares gefunden. Ich hab vor ein paar Wochen Sybille und Heike getroffen, kannst du dich an die beiden noch erinnern? Die suchen seit Jahren nach etwas Anständigem und müssen immer noch jobben. Und Michi, der die ganz fette Karriere machen wollte – stundenweise in einem Mittelstandsbetrieb Rechnungen nachprüfen.“
„Bitter. Warst du mit ihm nicht mal zusammen?“
„Stimmt. Und das wären wir auch noch, wenn er es verkraftet hätte, dass ich einen Job habe und er genau genommen nicht. Aber es gab nur noch Zoff, und ich lass mich doch nicht feuern, nur damit er sich überlegen fühlt!“
„Natürlich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Männer damit nie zurechtkommen. Aber das Problem hatte ich noch nicht, Werner verdient immer noch ein bisschen mehr als ich. Allerdings schrumpft der Unterschied langsam
dahin, so oft kommen bei Finanzbeamten die Gehaltserhöhungen nicht.“
„Werner ist Finanzbeamter geworden?“
„Ja, ist doch praktisch, ich kann ihn immer fragen, wenn ich ein steuerrechtliches Problem habe. Er ist ziemlich gut in seinem Job.“
„Aha“, machte Sonja, und mir fiel ein, dass sie Werner noch nie gemocht hatte. Auf einem Fest vor über fünf Jahren hatte sie – ziemlich betrunken – den ganzen Abend versucht, mir „etwas Besseres“ zu suchen, aber natürlich nichts gefunden. Da Werner damals gehört hatte, wie sie ihre Absicht etwas unartikuliert verkündet hatte, war er seitdem auch nicht mehr so recht von ihr begeistert. Mein Vorschlag, das Ganze mit Humor zu nehmen und abzuwarten, was sie so anschleppen würde, hatte seinen Zorn auch nicht besänftigt.
„Dass du immer noch mit dem zusammen bist?“ Sonja hatte sich offenbar auch nicht verändert. „Warum denn nicht? Wir passen prima zusammen! Im Juni wollen wir sogar heiraten, jetzt haben wir das Zusammenleben lange genug geprobt. Nur, weil du ihn nicht magst... Ich fand manche von deinen Freunden auch eher seltsam, diesen Maler zum Beispiel, wie hieß er doch gleich?“
„Arthur?“
„Ja, kann sein. Der, der dich immerzu nackt gemalt hat, und dann konnte man auf dem Bild überhaupt nicht erkennen, wozu er ein Modell gebraucht hatte.“
„Ich war eben seine Muse. Außerdem bin ich den doch längst los. Aber dieser Werner, der hat so einen Blick drauf – ich weiß nicht.“
„Was denn für einen Blick?“, fragte ich gereizt und bestellte mir noch einen Espresso. „Du hast ihm seit Jahren nicht mehr in die Augen gesehen!“
„So einen Meine-Frau-hat-es-nicht-nötig-zu-arbeiten-Blick. Ist er nicht der, der bei euch entscheidet, was gemacht wird?“
„Nein“, knurrte ich und weigerte mich, über die Frage näher nachzudenken. Gar nicht wahr!
„Na, wie du meinst. Und heiraten, ja? Richtig mit allen Schikanen?“
„Ja“, bestätigte ich, „die Familien lassen sich das nicht nehmen.“
„Familien? Sag bloß! Yannick besteht darauf, dass er dich in weißem Tüll zum Altar geleiten darf? Der muss sich aber gewaltig verändert haben.“ Sie trank einen großen Schluck und sah mich schlau an, ohne sich den Milchschnurrbart abzuwischen. Und ich hatte auch keine Lust, sie darauf hinzuweisen, nicht, wenn sie mich so in die Zange nahm!
„Yannick ist das egal“, gab ich zu, „Werners Eltern hätten gerne eine richtige Hochzeit, na, und Werner selbst auch. Er hat ja viel Sinn für traditionelle Werte. Was dagegen?“ Sonja versicherte hastig, dass sie nichts dagegen hatte, aber ich traute ihr nicht – sie wollte stänkern, eindeutig!
„Wo wollt ihr denn heiraten?“
„Wie üblich eben. Erst Rathaus, dann Stadtkirche. Aber wenn es dich beruhigt, wir haben schon eine abgespeckte Version entworfen, ohne Junggesellinnenabschied, ohne Polterabend und mit einer bescheidenen Gästeliste.“
„Warum ohne Junggesellinnenabschied?“
„Weil ich nicht völlig verkatert vor dem Standesbeamten stehen will. Und ein Vermögen wollen wir auch nicht gerade ausgeben, ich ärgere mich schon genügend über das Brautkleid. Einen Haufen Geld für ein Kleid ausgeben, das man nie wieder anziehen kann, das nagt schon an mir“, gestand ich ehrlicher als bisher.
„Hast du schon ein Kleid?“
„Nein. Noch nicht mal Schuhe! Was glaubst du, warum ich bei Pumps war? Aber High Heels kommen gar nicht in Frage, ich will ja keine komische Figur abgeben!“
„Mattweiße Ballerinas aus Seidenrips“, murmelte Sonja, die Fachfrau. „Geh zu Dorfner, der hat so was.“
„Der ist ja noch teurer!“ Der Verschlag empörte meine geizige Seele bis ins Innerste. Nein, geizig war übertrieben, sparsam war ich, preisbewusst, eben eine Finanzfachfrau. Ich würde keine Aktien kaufen, die eine schlechte Performance erwarten ließen, warum sollte ich Schuhe kaufen, die nach einem Tag im Schrank landeten?
„Am Tag nach der Hochzeit bringst du sie hin und lässt sie färben, grau oder so. Die machen das tadellos und du hast ein paar prima Schuhe fürs Business. Du läufst doch immer noch so edel gestylt herum, oder?“
Das konnte ich nicht bestreiten. Die Idee war nicht übel. Und Seidenballeri-nas... in denen konnte ich wenigstens laufen.
„Du siehst toll aus“, lobte Sonja mich plötzlich, als hätte sie das Gefühl, nun genug Ärger gemacht zu haben, „ein bisschen wie die junge Fanny Ardant, vor allem mit der Frisur.“
Ich fuhr mir unwillkürlich durch die kinnlangen dunkelbraunen Locken und war geschmeichelt. „Findest du echt?“
„Ja, echt. Und du hast so was Edles, vielleicht, weil du so groß und schlank bist. Schicke Jeans!“
Jetzt übertrieb sie aber, die Jeans waren ein stinknormales stonewashed-Teil aus dem Horizont und das T-Shirt mit der kleinen Stickerei sah zwar nobel aus, aber nur, weil man die Stickerei nicht richtig erkennen konnte, sie bedeutete überhaupt nichts. No name-Turnschuhe, keine Strümpfe, Sonnenbrille von Tchibo im Ausschnitt.
„Danke“, antwortete ich trocken, „überschlag dich nicht. Du siehst auch gut aus.“
Sonja freute sich, und ich hatte nicht wirklich gelogen. Das glatte blonde Haar glänzte in der Sonne, ihre kleine, runde Figur war so knackig wie eh und je, und der schwarze Anzug mit dem mintfarbenen T-Shirt darunter stand ihr. An den beiden Pickeln am Kinn musste sie vielleicht noch etwas arbeiten, und so, wie sie jetzt verstohlen daran herumfingerte, war ihr das auch bewusst.
„Nicht knibbeln!“, sagte ich unwillkürlich in dem Ton, den meine Mutter früher benutzt hatte, und Sonja schaute sofort schuldbewusst und setzte sich auf ihre Hand. „Wollt ihr eigentlich Kinder?“, fragte sie nun. Kam das von dem streng-mütterlichen Ton, den ich eben angeschlagen hatte? Ich zuckte die Achseln. „Ich bin nicht übermäßig scharf drauf, und Werner wohl auch noch nicht. Mal sehen, wann wir das beruflich unterbringen können.“
„Immer noch obercool unterwegs, was? Big Business?“
„Besser als Windelnwaschen“, murmelte ich und sah auf die Uhr. Schon Viertel nach eins? Jetzt wurde die Zeit langsam knapp, ich gab Sonja einen Zehner und verabschiedete mich mit dem üblichen „Wir telefonieren!“ Vielleicht würde ich sie wirklich mal anrufen. Als ich mit meinen Tüten und Täschchen in der Rubensstraße ankam, war es fast zwei, die blöde U-Bahn war mal wieder im Tunnel zwischen Bahnhof und Tizianstraße stecken geblieben.
Werner saß im Wohnzimmer und zappte sich durch die Programme, bis er die Vorschau auf die heutigen Fußballspiele gefunden hatte. Auch gut – wenn er mich noch nicht vermisst hatte, hieß das, dass er noch keinen allzu großen Hunger hatte. Ich schaltete den Herd unter dem Gulasch ein, das ich heute Morgen vorbereitet hatte, und setzte Nudelwasser auf, dann packte ich meine Einkäufe aus. So ein Mist, die Schokoladeneier fühlten sich verdächtig weich an, ich hätte wohl doch nicht in der prallen Sonne sitzen sollen! Also stopfte ich diese Tüte komplett in den Kühlschrank, legte Ostergras, Ostergeschenk, Ostereierfarbe und sonstigen Mist beiseite und konzentrierte mich auf Gulasch mit Nudeln und Gurkensalat. Werner sah auf, als ich den Tisch in der Essecke deckte, und drehte den Ton geringfügig leiser.
„Das Klappern war der Auspufftopf. Kostet leider einen Hunderter, einen neuen einzubauen, sagt der Meister. Soll ich mit deinem nicht auch mal zur Inspektion fahren?“
„Danke“, antwortete ich und stellte Salz und Pfeffer auf den Tisch, „ich war doch grade erst, dem fehlt gar nichts. Er ist ja auch erst ein Jahr alt.“
„Du warst selbst bei der Inspektion?“
„Mach ich doch immer“, sagte ich abgelenkt – hatte ich tatsächlich nur eine Gabel mitgebracht oder war mir eben die andere runtergefallen? Nein, unter dem Tisch lag sie nicht, eher draußen in der Küche. „Ich nehme dir das gerne ab.“
„Danke, aber mir macht das Spaß. Wenn du willst, kannst du mir beim nächsten Mal das Tischdecken abnehmen.“
Werner brummte. „Ich weiß doch nie, wo was hingehört und wo du das ganze Zeug aufbewahrst.“
„So viele Möglichkeiten gibt´s da auch nicht“, erwiderte ich freundlich, „du findest den Kram schon. Essen ist gleich fertig!“
Ich goss die Nudeln ab und kippte sie in die Schüssel, füllte das heiße Gulasch in die andere und trug alles zum Esstisch. Als ich auch noch den Salat geholt hatte, saß Werner schon zufrieden schnuppernd am Tisch; die Fußballvorschau lief nun wenigstens ohne Ton. Na, wenn ihm das Spaß machte... Er aß mit gutem Appetit und kratzte zu guter Letzt die Schüsseln noch aus, damit ja nichts umkam. „Hast du Forsythienzweige geholt?“, fragte ich schließlich.
„Was?“ Die Gabel stoppte auf halbem Weg.
„Für den Osterstrauß“, erklärte ich freundlich, „du wolltest doch einen haben.“
„Ach so, ja. Nein. Ich war nach der Werkstatt noch im Medienmarkt. Tolle Spiele hatten die da, ich hab ein bisschen rumgedaddelt. Na, und Blumenläden gibt´s in der Gegend ja nicht.“
Das stimmte leider. „Dann gehe ich noch mal schnell, der Blumenladen muss noch offen haben, glaube ich“, verkündete ich und schob meinen Stuhl zurück. Forsythien waren aus, als ich im La Fleur stand, aber es gab noch Kirsch- und Haselzweige, auch nett. Ich ließ mir zehn Stück zusammenstellen und dachte im Geiste über die passende Vase nach, dann trabte ich mit dem papierumhüllten Strauß wieder nach Hause.
In der Küche entschied ich mich schließlich für die weiße Kugelvase, schnitt die Zweige zurecht, stellte sie ins Wasser und arrangierte sie gleichmäßig. Die Küche machte einen recht ordentlichen Eindruck – Werner hatte doch wohl nicht abgedeckt und die Spülmaschine eingeräumt? Das war ja noch nie dagewesen!
Nein, hatte er nicht. Das hätte mich auch ziemlich erstaunt. Der Esstisch sah so aus, wie wir ihn verlassen hatten, Werner war verschwunden. Die Vase landete auf dem Sideboard zwischen den beiden Fenstern, wo sie recht nett aussah. Ich fand ja dieses Schmückmanie, in die das ganze Land zu passenden Zeitpunkten verfiel, eher albern, aber Werner war mit Osterstrauß aufgewachsen, warum sollte er jetzt keinen mehr haben? Schnell räumte ich den Tisch ab und die Spülmaschine ein; während sie rumpelnd vor sich hin arbeitete, verteilte ich die bemalten Eier aus Holz und Kunststoff gefällig an den Zweigen und klemmte schließlich noch eins der sinnlosen bestickten Deckchen von Werners Großmutter unter die Vase, damit das polierte Holz keinen Rand bekam. Nett, ja – wenn man auf solchen Kram stand.
In der Küche füllte ich das große Pappei mit Ostergras und der La Bohème-CD, dann kochte ich zehn frische Eier hart und stellte die Näpfchen mit den Färbetabletten auf – rot, lila, blau, grün, gelb. Der große Rattankorb, den wir sonst nie benutzten, kriegte eine große Osterserviette und eine sorgfältig auseinander gezupfte Handvoll Ostergras, dann fischte ich die harten Eier aus dem Kochwasser und legte je zwei in eins der Farbnäpfchen, wo ich sie dann die vorgeschriebenen zehn Minuten lang hin und her drehte. Stumpfsinnig... Aber harte Eier aß ich selbst ganz gerne, und das Frühstück morgen sollte doch einigermaßen festlich sein, mit Pinza, Schinken, Krabbensalat und eben Ostereiern. Wenigstens war Werner so weit erwachsen, dass ich die Schokoladeneier nicht mehr verstecken musste.
Die fertigen, abgetrockneten und mit Öl dünn eingeriebenen Eier glänzten schon in ihrem Nest, als ich in einem zweiten Korb ein Nest aus Schokoeiern und Häschen arrangiert hatte. So, fertig! Ich leerte die Farbbrühen aus, spülte die Näpfe ab, räumte die Spülmaschine aus und wischte die Küche oben und unten schnell auf. Das war´s!
Zufrieden zog ich mich mit einem neuen Buch, Neue Methoden des Controllings, in mein winziges Arbeitszimmer zurück und las. Aus dem Wohnzimmer ertönte mittlerweile wieder Pfeifen, Jubeln und die aufgeregte Stimme eines Moderators, Werner war also angenehm beschäftigt, so dass ich die Neuen Methoden in Ruhe studieren konnte. Vielleicht ließen sich auf diese Weise einige Arbeitsschritte einsparen? Schließlich öffnete sich meine Tür.
„Hast du nicht auch Lust auf einen Kaffee?“
Mich packte ein Teufelchen. „Au ja, gute Idee! Für mich bitte schwarz.“
Werner sah mich ratlos an. „Was? Ich dachte - na gut.“
Kaffee kochen konnte er, das wusste ich. Ich lauschte auf das Geklapper in der Küche, hörte, wie etwas klirrend zu Boden fiel, zuckte zusammen, bemühte mich, nicht helfend einzugreifen, und schlenderte erst fünf Minuten später in die Küche.
Die Kaffeemaschine blubberte und ließ verdächtig helles Gebräu durchlaufen, auf dem Boden lagen die Scherben einer Tasse und einige Häufchen Kaffeepulver.
Ich reichte Werner, der mir kläglich entgegensah, einen feuchten Lappen und deutete stumm auf das Kaffeepulver. Ungeschickt bückte er sich und wischte herum, bis das Pulver unter den Unterschränken verschwunden war. Klasse! Ich hob währenddessen die Scherben auf und schmetterte sie in den Mülleimer. „Kann man das nicht mehr kleben?“, fragte Werner und warf den braun verschmierten Lappen auf die saubere Arbeitsfläche.
„Nein. Außerdem ist das lächerlich, wer soll denn aus einer geklebten Tasse trinken?“
„Dann ist das Service ja nicht mehr komplett!“
„Ich weiß“, fauchte ich, „aber ich hab die Tasse ja nicht runtergeschmissen, oder? Ich hab die Absicht schon verstanden.“
„Welche Absicht? Glaubst du, ich habe die Tasse mit Absicht kaputt gemacht? Leni, wie kommst du mir vor?“
„Ach nein? Soll das alles – kaputte Tasse, schmutziger Lumpen, schmutziger Boden – nicht heißen Das passiert eben, wenn du mich zwingst, die Küche zu betreten?“
„Leni, ich versteh dich nicht. Ich hab den Kaffee doch aufgewischt!“
„Hast du nicht, du hast ihn unter die Unterschränke gefegt, wo er jetzt so lange vor sich hingammeln wird, bis ich mich erbarme und ihn da wieder rauskratze.“
„Du kannst das eben besser, Leni!“
Sehr einfach! Und er sollte nicht immer Leni sagen, das klang so nach Bauerntrampel. Ich hieß Hélène und legte auch Wert darauf, aber das hatte Werner schon seit sechs Jahren ignoriert. Jetzt war daran auch nichts mehr zu ändern. „Was soll ich denn tun?“ Gott, wie er jetzt dreinschaute! Irgendwie war er ja doch süß, wenn er sich auch im Haushalt immer absichtlich dumm stellte.
„Spül den Lappen gründlich aus, ja, so, bis kein Kaffee mehr rauskommt. Und dann fährst du mit einem flachen Lappenzipfel unter den Schrank, bis du den Kaffee eingefangen hast. Und beim nächsten Mal nimmst du pro Tasse bitte einen ganzen Löffel Kaffeepulver, ja?“
Er wischte und schaute demütig zu mir auf. So war es Recht, aber ich wusste leider genau, dass diese unterwürfige Pose nicht anhalten würde – bei der nächsten Gelegenheit würde er sich wieder mit Hingabe als Tölpel präsentieren. Es ging wirklich alles doppelt so schnell, wenn ich es selbst machte, und mein erzieherischer Eifer erlahmte immer wieder nach einem Versuch. Schließlich stand er auf, spülte den Lappen, nachdem ich ihn wieder darauf hingewiesen hatte, aus und trank einen Schluck von seinem Kaffee, bevor er die Tasse angewidert ins Spülbecken leerte und sie irgendwo abstellte. Ich gab es auf, allerdings kapitulierte ich nicht so weit, dass ich anständigen Kaffee gekocht hätte.
2
Beim Osterfrühstück beobachtete ich Werner, der sich schon das dritte gefärbte Ei aufschlug und es dann sorgfältig in Scheiben schnitt, um es auf einem Stück Nussbaguette mit Kräuterkäse zu verteilen. Im Prinzip fand ich das auch lecker, aber doch nicht drei Portionen! So war leicht zu verstehen, warum Werner viermal in der Woche zum Sport ging – bei solchen Portionen wäre er sonst bald doppelt so breit.
Noch sah er aber gut aus, etwas größer als ich, kräftig, dunkelblond, braunäugig – und zur Feier des Tages ziemlich unrasiert. Er zwinkerte mir freundlich zu und biss in sein Käsebrot. Ich feixte zurück und häufte Krabbenmayonnaise auf eine halbe Mohnsemmel. Er war schon ein lieber Kerl. Nicht unbedingt alltagstauglich, aber daran hatte ich mich in den letzten Jahren gewöhnt, er gehörte eben zu denen, die nie wussten, wann etwas in die Reinigung gebracht, geputzt, geschält oder gewaschen werden musste. Als er das letzte Mal etwas in der Maschine gewaschen hatte, mussten wir danach den Kundendienst kommen lassen, der das Flusensieb und einen Keilriemen austauschte. Sechs Jeans und ein Paar Turnschuhe hatte er hineingestopft! Ich hielt ihm einen Vortrag, den er offensichtlich nur halb verstand, und beschloss, in Zukunft lieber selbst zu waschen.
Immerhin besorgte er die Getränke, das war ja auch schon was, und legte sich bei Bedarf mit dem Hausmeister an.
Wir wohnten in einem schönen Haus, einem perfekt renovierten Bau aus den Fünfzigern, mit elegant geschwungenen Treppen und einem Vorgarten, der immer reizvoll bepflanzt wurde. Unser Ende der Rubensstraße sah sehr viel stilvoller und ruhiger aus als der Teil, der dem Bahnhofsviertel zugewandt war. Dort gab es dafür die guten Geschäfte, bei uns lag nur – an der Ecke zur Holbeinstraße – ein sehr teures französisches Restaurant.
Fünf Zimmer, zwei Bäder, Küche, Kammer und nach hinten raus ein asymmetrisch geschwungener großer Balkon – was wollte man mehr? Die Miete war verdammt hoch, aber zu zweit trugen wir das locker. Und hier konnten wir noch lange bleiben, das Haus war zu schade, um es abzureißen, der Eigentümer, eine große Versicherung, geriet so bald sicher auch nicht in akute Geldnot, und Gewerbe waren in diesem Haus nicht erlaubt, also konnte er uns auch nicht rauswerfen und dafür an Büros vermieten. Fünf Zimmer würden sogar noch reichen, wenn wir wider alles Erwarten doch eines Tages ein Kind kriegen würden. Und unsere Einrichtung, die übliche Mischung aus IKEA (die etwas besseren Stücke), geerbtem Kram und günstig geschossenen Designerstücken, wie dem knallblauen Riesensofa vor dem Fernseher, gefiel mir gut. Wenn ich Werner im Juni heiratete, würde ich vielleicht mein ganzes Leben hier verbringen, bis es für uns beide Zeit wurde, in Betreutes Wohnen überzusiedeln. Auch dieser Gedanke gefiel mir. Da wir beide ziemlich klotzig verdienten, hätten wir später sicher auch genug Geld für einen angemessenen Lebensabend.
Ich lächelte ihn versonnen an. Zuverlässig, lieb, ein guter, rücksichtsvoller Liebhaber... Ich mochte, wie er duftete, wie er sich anzog, wie er blinzelte, wie er gerne „die Sache in die Hand nahm“. Gut, manchmal wollte er etwas im Alleingang regeln und brachte mich damit auf die Palme, manchmal war er eindeutig emotionaler als ich, die zu einer gewissen Kaltschnäuzigkeit neigte, und manchmal war er tagelang muffig, wenn wir uns gestritten hatten. Aber damit konnte ich leben. Doch, Werner war der Richtige für mich. Sicher war es mit der großen Leidenschaft nicht mehr so weit her – nie gewesen, wenn ich mal richtig nachdachte -, aber nach sechs Jahren? Und eine funktionierende Ehe konnte man doch sowieso nicht auf Leidenschaft aufbauen, da gab es Wichtigeres, fand ich: Verständnis, gleiche Interessen und – was und? So etwas wie Freundschaft? Vielleicht...
„Warum lächelst du?“, fragte Werner. Ich fuhr zusammen. „Nur so. Weil wir gut zusammenpassen, finde ich.“
„Stimmt. Eigentlich haben wir es richtig gut, was? Ostersonntag, nur ganz kurz die nervende Familie, eine schön geschmückte Wohnung, heute Abend dieser Superfilm – saugemütlich.“
„Welcher Superfilm?“
„Ich hab mir doch Pulp Fiction ausgeliehen, schon vergessen? Den ziehen wir uns heute Abend rein. Ich muss ihn morgen früh wieder zurückbringen, Richy will ihn auch noch gucken. Und heute müssen wir ja noch einen in Familie machen.“ Der Blick war direkt etwas vorwurfsvoll, als sei das heute nicht seine Familie. Und Pulp Fiction kannte ich schon. Der blödeste Film seit Jahren, meiner bescheidenen Meinung nach. Werners erwartungsvolles Strahlen stimmte mich allerdings wieder friedlich.
„Gut, Pulp Fiction. Um zehn käme allerdings auch Manche mögen´s heiß, den hab ich schon lange nicht mehr gesehen.“
„O Gott, Kerle im Weiberfummel. Nein, den will ich nicht sehen. Pulp Fiction wird dir gefallen, bestimmt, Leni.“
„Sag nicht immer Leni zu mir“, murrte ich. Im Moment zeigte er nicht gerade die Seiten, die ich an ihm liebte!
„So heißt du doch! Wie würdest du denn Helene abkürzen?“
„Gar nicht“, murmelte ich, „außerdem heiße ich Hélène.“
„Da krieg ich ja einen Knoten in der Zunge. Komm, Lenimaus, nun sei wieder gut, ja?“
Was blieb mir anderes übrig, außer schnell irgendwo einen zweiten Fernseher zu kaufen? Ich lächelte resigniert. „Wenn du fertig bist, räume ich schnell auf, und dann fahren wir zu deinen Eltern, gut?“
„Gut.“ Werner erhob sich und wollte sich davonmachen, aber ich stoppte ihn und bat ihn, mir beim Abräumen zu helfen. Er trug jedes Teil einzeln in die Küche und stellte es weiträumig verteilt ab; ich seufzte innerlich und sammelte alles wieder ein, um die Reste zu verpacken und das Geschirr in die Spülmaschine zu schichten. In der Zeit, in der er drei Teller und eine Tasse transportiert hatte, war ich mit dem ganzen Rest fertig geworden!
Nein, häusliche Talente gehörten eindeutig nicht zu seinen Pluspunkten, aber das hatte ich ja schließlich immer schon gewusst. Dafür machte er mir bezüglich der Wohnung keine Vorschriften, abgesehen von Festtagsdekorationen, fand alles lecker, was ich so kochte, verglich mich nie mit seiner Mutter, warf seine Socken meistens in den Wäschekorb und war in puncto Steuerrecht wirklich ausgefuchst. Außerdem mochte ich seinen Körper, seine festen Umarmungen, seine liebevollen Küsse, seine... naja, das war´s. Und das reichte ja wohl auch!
Sobald sich die Maschine wieder abgeschaltet hatte, fuhren wir zu seinen Eltern nach Henting-Ost. Sie bewohnten dort ein kleines Siedlungshäuschen, in dem Werner und seine Schwester Wilma aufgewachsen waren.
Werner fuhr, obwohl es mein Wagen war, da seiner ja immer noch klapperte. Er war ein guter Fahrer, aber ein nervöser Beifahrer, also überließ ich ihm meist das Steuer und entspannte mich auf dem Beifahrersitz, mir war es zu lästig, den Fahrer zu beobachten und dauernd „Pass auf!“ zu plärren.
Das Gekreisch aus dem Haus war schon zu hören, bevor Werner den Wagen auch nur korrekt eingeparkt hatte. Äh, also hatte Wilma nicht nur ihren langweiligen Mann, sondern auch die drei Kinder mitgebracht!
Werner verzog schon das Gesicht, und ich konnte es ihm nachfühlen, die drei waren bemerkenswert schlecht erzogen, fand ich. Schon die Begrüßung an der Tür wurde unterbrochen, weil die drei kleinen Monster um uns herumsprangen und krähten: „Was habt ihr uns mitgebracht?“
„Gar nichts“, fertigte ich sie ab, „wir wussten doch gar nicht, dass ihr auch kommt. Habt ihr nicht heute Morgen schon Ostereier gesucht?“
„Ja!“, plärrte Jonas, „Und im Zoo! Aber wir wollen hier auch was kriegen!“
„Pech gehabt, man kriegt nicht immer, was man will.“
„Du bist doof“, entschied Lara, und der Kleinste, Benedikt, trat mir, um das zu unterstreichen, ans Schienbein. Werners Mutter verdrehte die Augen zum Himmel, sagte aber nichts, sondern küsste mich nur kurz auf die Wange. Werner war von den drei kleinen Nervensägen unbehelligt geblieben, vielleicht, weil er sie seit Jahren einfach ignorierte. Von ihrer Mutter waren sie es wohl gewohnt, dann man Frauen pausenlos nerven durfte und Männern lieber aus dem Weg ging – ihr eigener Vater jedenfalls konnte, wenn sie zu furchtbar waren, direkt streng werden.
Wilma saß im Wohnzimmer auf einem der geblümten Sofas und blätterte in einem Fotoalbum, das sie offenbar selbst mitgebracht hatte. Als wir hereinkamen, sah sie kurz auf, wurde aber schnell angelenkt.
„Mama, Mama, die sind so doof, die haben uns gar nichts mitgebracht!“
„Ist ja gemein. Aber ihr habt heute doch schon so viele Ostereier gekriegt.“
„Trotzdem!“, heulte Jonas los, und Wilma warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu. Ich reichte Werners Mutter schnell den Frühlingsstrauß, den ich gestern noch schnell besorgt hatte, und das löste neues Protestgeheul aus. „Die Oma kriegt was, und wir nicht.“
„Ich hab´s euch eben schon gesagt“, erwiderte ich scharf, „dass ihr auch kommt, wusste ich nicht. Die Oma hat die ganze Arbeit mit dem Essen und dem Kaffee, also kriegt sie was geschenkt.“
„Sprich nicht so gereizt mit meinen Kindern!“, schnauzte Wilma mich an.
„Dann sollen sie mich nicht mir ihrer Gier reizen“, antwortete ich auch nicht freundlicher und verzog mich zu meiner künftigen Schwiegermutter in die Küche. „Hast du nicht auch ab und zu Lust, die Engelchen kräftig übers Knie zu legen?“, fragte ich halblaut und half ihr, den Lammbraten aufzuschneiden und grüne Bohnen in eine Schüssel zu füllen. „Weiß Gott. Aber Wilma steht ja auf völlige Gewaltfreiheit. Und dazu gehört offenbar auch, dass man den Kindern nichts verbieten darf. Verzogene Fratzen.“
Ich brummte zustimmend. „Wo sind die Männer eigentlich?“
„In der Garage, Otto hat einen neuen Schlagbohrer, und den muss er Werner und Helmut natürlich vorführen. Du kannst die drei gleich mal holen, ja?“
Ich ging durch die Hintertür und über den Vorplatz in die Garage, wo die drei die Köpfe zusammensteckten. Rhythmisches Aufheulen verriet mir, dass der Bohrer in jedem Modus präsentiert werden musste. Wie drei Teenies, die ein Mofa bestaunten! „Geiles Teil“, fand Helmut, der trotz seiner Strenger-Vater-Attitüde gelegentlich Kindergarten- und Grundschuljargon übernahm. „Kann man damit auch in Beton dübeln?“, fragte Werner begierig und drehte sich fast schon ärgerlich um, als ich mich räusperte. „Das Essen ist fertig.“
„Ja, gleich“, murmelte mein Schwiegervater. „Schaut mal, und hier kann man umschalten, dann hat er die doppelte Drehzahl...“
Ich verließ die Garage achselzuckend wieder. Meine Schwiegermutter saß schon am Tisch; ich setzte mich dazu und beobachtete, wie Wilma ihre Brut so verteilte, dass sie sich nicht während des Essens prügeln konnten. Lara landete neben mir, und ich war wieder einmal froh, dass ich gut waschbare Kleidung angezogen hatte, denn mit veralteten Höflichkeitsformen wie etwa Tischmanieren waren die Kleinen nicht belastet worden. Die braune Hose hatte etwa die Farbe der Lammbratensauce, und schlimmer konnte es eigentlich nicht kommen. Es sei denn, es gab Heidelbeereis.
Die Kinder verlangten lautstark nach Essen und klopften mit den Besteckrücken auf den Tisch, um ihren Hunger zu unterstreichen. Das brachte auch die langmütige Oma in einen Konflikt: Sollte man den Kindern nachgeben oder den nicht minder schlecht erzogenen Männern, die anscheinend immer noch in der Garage ihren Bohrer aufheulen ließen? Wilma befreite sie aus dem Dilemma, indem sie den Kindern auftat – wenig Reis, ganz wenig Gemüse, viel Lammbraten (gemeinerweise den Anschnitt auch, auf den ich mich schon gefreut hatte) und viel Sauce.
Jonas plärrte sofort wieder los. „Das ist zuviel Soße! Mach das weg, Mama!“
„Das geht nicht. Lass es halt übrig. Guten Appetit!“
Klasse, wir hatten ja noch gar nichts! Wilma nahm sich selbst ziemlich reichlich, Werners Mutter von allem nur ein bisschen, ich bediente mich üppig bei den Bohnen (die waren hier sensationell gut) und sparsam beim Reis und fischte mir dann schnell den anderen Anschnitt von der Platte, dazu ein Löffelchen Sauce.
Trockenes Essen, den Wein schenkte hier der Hausherr ein, und der ließ sich ja nicht blicken! Werners Mutter schaute bedrückt drein; der restliche Lammbraten kühlte langsam ab und begann, glasig auszusehen. Ich hatte meinen Teller schon fast geleert, obwohl ich betont langsam gegessen hatte, als die Männer endlich kamen.
Werners Vater beklagte sich, dass der Braten nicht mehr heiß war, aber seine Kritik wurde von Laras schrillem Geschrei übertönt – ihr war Sauce in die Bohnen gelaufen. Angesichts dieser Katastrophe ließ sie ihr Besteck mit Schwung auf den Teller fallen, so dass die Sauce aufspritzte und meine helle Bluse sprenkelte.
„Nächstes Mal ziehe ich ein Ganzkörperkondom an“, schimpfte ich. „Pass doch ein bisschen auf, Lara!“
Lara heulte natürlich erst recht los, und Jonas wollte sofort wissen, was ein Kondom war. Ich gab die Frage an seinen Vater weiter, der ihn barsch anwies, die Klappe zu halten und aufzuessen.
„Wenn ich den Mund zumache, kann ich doch nicht essen“, maulte Jonas und fischte angeekelt die wenigen weißen Reiskörner vom Saucenrand. Helmut sah aus, als dächte er über die Vorzüge der Prügelstrafe nach, und ich konnte ihn gut verstehen. Wilma warf mörderische Blicke in die Runde, vor allem auf mich.
Werner, auf Laras anderer Seite, aß stetig und schweigend, nur einmal wechselte er mit seinem Vater eine Bemerkung, die sich auf den Schlagbohrer bezog. Familie! Wäre es weniger furchtbar, wenn die Kinder unter Aufsicht in der Küche irgendein Kinderessen – Spaghetti, Hähnchen, Pommes oder so – serviert bekämen und uns hier verschonten? Welches Kind mochte schon Lammbraten mit grünen Bohnen und Wildreis?
Benedikt jedenfalls nicht. „Was´n das schwarze Zeug?“
„Wildreis“, erklärte Wilma ihm geduldig, „so was wie ein Gras.“
„Gras?“, fragte Lara entsetzt. „Ich ess doch kein Gras! Ich bin doch kein Hase!“
„Mama, Mama, können wir nicht einen richtigen Hasen haben? In einem Käfig?“
Haha, Wilma - Selbsterhaltungstrieb oder Mutterliebe? Selbsterhaltungstrieb. Irgendwo war schließlich auch Wilmas Schmerzgrenze erreicht! „Nein“, erklärte sie knapp und wechselte entschlossen das Thema. Nicht unbedingt glücklich, denn es ging darum, was der Osterhase gebracht hatte. Das erinnerte Jonas an den Hasen und Lara an gewisse Leute, die nichts mitgebracht hatten. Ich wich, so gut es ging, den Saucenspritzern von links aus, aß den letzten Rest Lammbraten und sah unauffällig auf die Uhr. Erst zwanzig nach eins, drei Stunden mussten wir sicher hier noch herumhängen. Wurden diese Gören denn nie müde?
„Habt ihr schon einen Termin?“, fragte der künftige Schwiegervater mich mit-
ten in diese Überlegungen hinein.
„Äh – was für einen Termin?“, fragte ich töricht zurück.
„Na, für die Hochzeit?“
„Ach so, ja – Werner? Haben wir schon einen Termin?“
Werner nickte kauend. „Den achtzehnten und neunzehnten Juni.“
„Zwei Tage?“, fragte ich entsetzt. „Schaffen wir das nicht an einem?“
„Aber Helene, du möchtest doch sicher vor der kirchlichen Trauung zum Friseur, damit der Schleier gut sitzt, oder?“ Die schwiegermütterliche Besorgnis war rührend, aber da musste ich doch sofort eingreifen.
„Ich hab nicht vor, einen Schleier zu tragen, und meine Frisur ist tadellos. Ich gehe ein paar Tage vor der standesamtlichen Trauung noch mal ins Hair, das reicht dann schon.“
„Willst du lieber einen Hut tragen?“
„Gar nichts. Ich mag Kopfbedeckungen nicht. Also von mir aus können wir auch morgens ins Rathaus und mittags in die Kirche, dann haben wir es hinter uns.“
„Man könnte meinen, du freust dich gar nicht auf die Hochzeit“, maulte Wilma.
Ich warf ihr einen gereizten Blick zu. „Warum auch? Ich freue mich darauf, verheiratet zu sein, aber das ganze Brimborium, die Kosten, der organisatorische Aufwand. Und dann steht man bloß mit einem Kleid da, dass man nicht weiterverkaufen und auch nie mehr anziehen kann.“
„Man kann es doch färben“, wandte Wilma ein.
„Hast du das gemacht?“
„Ja, in hellblau. Sieht gut aus.“
„Und wie oft hast du es seitdem getragen?“
„Einmal“, gab sie zu, „erst war ich immerzu schwanger und dann hatten wir nie Gelegenheit, auf Bälle zu gehen.“
„Eben. Ein umgefärbtes Ballkleid kann ich auch nicht brauchen. Wieso kann ich das Kostüm von der standesamtlichen Trauung nicht auch in der Kirche tragen?“
„Schatz, das gehört sich nicht. Ein graues Kostüm! Alle werden denken, etwas stimmt nicht.“
„Grau? Wieso grau?“ Entsetztes Keuchen bei den Schwiegereltern.
„Weil graue Wildseide ein Schweinegeld kostet und ich die Farbe noch gut bei wichtigeren Meetings tragen kann. Ich hab´s mit Elfenbein probiert, aber es sieht eben wie ein Brautkostüm aus, da grinsen doch alle, Guck, die trägt ihre Hochzeitsklamotten auf. Das kann ich mir nicht leisten.“
„Nimmst du deine Arbeit nicht etwas zu wichtig?“, fragte Wilma pikiert. „Du beurteilst alles danach, ob du es ins Büro anziehen kannst!“
„Wonach denn sonst?“, fragte ich ehrlich erstaunt.
„Du bist kaltschnäuzig!“, warf sie mir vor.
„Weiß ich“, grinste ich, „aber ich bin nun mal ein unromantischer Mensch.“
„Lohnt es sich denn noch, wenn du dich so in deine Arbeit reinkniest?“, fragte Werners Vater. Ich sah ihn verblüfft an, und er versuchte, seine Frage zu erläutern. „Ich meine, ihr kriegt doch sicher bald Kinder, und dann hörst du doch ohnehin auf zu arbeiten.“
„Das hat ja wohl noch Zeit, und scharf bin ich auf Kinder nicht.“
„Vielleicht in zwei, drei Jahren“, fügte Werner hinzu und ich blinzelte überrascht. Das hatten wir so präzise nicht ausgemacht! Na, vielleicht wollte er mir nur ein bisschen helfen.
Ich beendete die Debatte, indem ich Werners Mutter beim Abräumen zur Hand ging. So entkam ich wenigstens den voll gestopften, aber deshalb leider kein bisschen müden Kindern, die sofort wieder begannen, im Wohnzimmer herumzutoben, bis Wilma eine Fernsehsendung entdeckte, mit der man sie ruhig stellen konnte. Wir plauderten halblaut über neutrale Themen, das Wetter, Urlaubspläne, Sonderangebote, nur nicht über diese furchtbare Hochzeit, während wir einträchtig die Spülmaschine einräumten und die Arbeitsplatten abwischten. Was würden sie erst sagen, wenn sie hörten, dass ich vorhatte, meinen Namen zu behalten? Das wusste ja noch nicht einmal Werner!
Untermalt vom Gekreisch eines japanischen Comics, brüteten Werner und sein Vater über einer langen Liste und stritten sich halblaut. Ich setzte mich neugierig dazu und guckte. Lauter Namen, Tante dies und Onkel das. Dann dämmerte mir die furchtbare Wahrheit. „Himmel noch mal, sollen die etwa alle zur Hochzeit kommen?“
„Ja, natürlich. Eine Hochzeit ist doch ein Familienfest!“, antwortete Werner erstaunt. Ich nahm ihm den Zettel weg und las ihn mir gründlich durch.
WernerLeni
Eltern Yannick (Trauzeuge?)
Wilma & Helmut
Jonas, Lara, Benedikt
Tante Emma & Onkel Karl
Susanne, Sybille, Sandra
Onkel Joachim mit Freundin
Dr. Winkelmann & Frau
Helga & Heinz
Nathalie, Tristan, Joy
Reinhard (Trauzeuge) & Katja
Kevin, Dennis, Janine
Michael & Tina
Paul, Anna, Teresa
Tante Toni & Tante Anni
Onkel Josef und Tante Zenzi
Sebastian & Carolin
Ehepaar Untermeier
Ehepaar Vinzberger
Ehepaar Ähler
„Die meisten kenne ich überhaupt nicht.“, stellte ich ärgerlich fest. „Darf ich eigentlich auch jemanden einladen?“
„Was ist das denn für eine Frage? Dein Bruder kommt, und sonst hast du doch keine Familie, oder?“
„Stimmt. Allerdings hat mein Bruder auch eine Frau und zwei Kinder, und die
hast du nicht auf die Liste geschrieben. Was ist mit Freundinnen?“
„Wenn du das unbedingt möchtest, natürlich. An wen hast du denn gedacht?“
„Sonja“, sagte ich schnell, nicht weil sie meine beste Freundin gewesen wäre, sondern weil ich sie gestern erst getroffen hatte und weil ich wusste, dass Werner sie nicht leiden konnte, was ja auf Gegenseitigkeit beruhte.
„Muss das sein? Diese Zimtzicke. Ich wusste gar nicht, dass du zu der noch Kontakt hast.“
„Doch. Und Veronique und die Kinder möchte ich auch bei der Hochzeit haben.“
„Sprechen die überhaupt deutsch?“, fragte Wilma grämlich.
„Ein bisschen. Na und? Die meisten können doch notfalls auch Englisch oder Französisch, oder?“
„Das sollte eigentlich ein schöner Tag werden, nicht einer, an dem man sich mit Leuten rumärgern muss, die man gar nicht kennt“, maulte Wilma. Ich riss Werner die Liste weg und strich meinen Bruder energisch durch. „Ohne seine Familie kommt er ohnehin nicht, dann können wir´s doch gleich lassen. Schließlich kann es mir ja egal sein, Hauptsache, für Wilma wird es ein schöner Tag.“
„Bist du jetzt sauer?“, fragte Werner erstaunt.
„Natürlich nicht! Warum sollte ich sauer sein, wenn nur Leute von deiner Seite kommen dürfen? Was das alles kostet! Und wer sind diese Ehepaare? Nie gehört!“
„Unsere Nachbarn“, erklärte Werners Vater, „das gehört sich so.“
„Und was ist mit unseren Nachbarn?“, fragte ich Werner, der die Achseln zuckte. „Die kennen wir doch kaum.“
„Ich schon. Na gut, ich sage allen, dass ich auf die Gästeliste keinen Einfluss hatte. Und mit Yannick und Véro kann ich ja mal alleine essen gehen, nicht? Gott, bin ich froh, wenn diese zwei Horrortage vorbei sind!“ Wilma schnaufte. „Du bist herzlos!“
„Wenn schon! Sag doch mal ehrlich! Ich verkleide mich aufs Albernste, gebe ein Schweinegeld für ein Fest aus, auf dem ich fast niemanden kenne, muss einen auf gerührt machen und in der Kirche so tun, als legte ich auf den Segen irgendwelchen Wert. Ist doch furchtbar. Ach Werner, warum können wir nicht einfach in der Mittagspause aufs Standesamt gehen?“
„Die anderen erwarten doch von uns eine richtige Hochzeit, das können wir nicht machen.“
„Wo wollt ihr denn feiern?“, fragte Helmut. „Bei so vielen Leuten wird das echt nicht billig.“
„Keine Ahnung“, murrte ich. Gut, ich hatte ein paar tausend Euro für dieses lächerliche Fest beiseite gelegt, aber darüber hinaus würde ich keinen müden Euro opfern, alleine zahlte ich das nicht, egal, wie oft Wilma auf dem Brauchtum herumritt.
„Wie ich Leni kenne, bei MacDonald´s“, stänkerte Wilma. Die Kinder kreischten sofort begeistert auf und waren stinksauer, als sie endlich verstanden hatten, dass wir absolut nicht vorhatten, auf der Stelle mit ihnen dorthin zu fahren.
„Hast du eigentlich eine Mitgift?“, fragte Wilma schließlich.
Ich blinzelte verblüfft. „Eine was? Wilma, was liest du eigentlich so? Ach, bevor ich es vergesse – Werner, wir brauchen noch einen Notartermin vor der Hochzeit.“
„Wozu?“ Jetzt sah er ratlos drein. „Für den Ehevertrag, was dachtest du denn?“
„Muss das sein?“ Vater Reitz verzog das Gesicht.
„Ja, das muss sein!“ Scheißegal, wie die Hochzeit verlief, aber ohne Ehevertrag würde sie überhaupt nicht stattfinden, das war mal klar! „Du denkst ja jetzt schon an die Scheidung, wenn du so was willst“, kritisierte Wilma. Das war mir zu blöde, um überhaupt darauf zu antworten. „Welche Form sollen wir nehmen?“, fragte Werner halblaut.
„Gütertrennung“, tuschelte ich zurück, „das ist doch am einfachsten, oder?“
Er nickte langsam. „Gut. Und wegen der Kinder lassen wir uns vom Notar beraten.“
Welche Kinder? Na gut, das hatte ich ja schließlich selbst in der Hand. Glücklicherweise schien niemand das mit der Gütertrennung gehört zu haben. Andererseits hatte die Familie Reitz nicht so wenig Geld, also waren sie vielleicht ganz froh, wenn ich da nicht rankam. Dass ich auch nicht arm war, wussten sie vielleicht nicht. Besser so!
Wilma und ihr Vater guckten immer noch kritisch drein, aber alles wollte ich mir von denen nun auch nicht vorschreiben lassen; lieber half ich Werners Mutter, den Kaffee vorzubereiten und zählte danach die Minuten, bis wir endlich wieder gehen konnten.
Auf dem Heimweg wirkte Werner ein bisschen verkniffen. Lag das mir oder an seiner Familie? Eigentlich war ja nur Wilma so eine Pest, der Rest ging. Gut, sein Vater war auch nicht ganz mein Geschmack, aber die Mutter war lieb, Helmut war ganz vernünftig. Die Kinder allerdings sollte man auf einer einsamen Insel aussetzen – oder sie von jemandem erziehen lassen, der etwas davon verstand. „Du freust dich wirklich nicht auf die Hochzeit, oder?“
„Nein. Nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mich darauf, mit dir verheiratet zu sein, aber dieses Fest – nee.“
„Warum eigentlich? Ich dachte, alle Frauen fiebern auf diesen Tag hin?“
„Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach zu unromantisch, ich meine, zwischen uns beiden ändert sich doch ohnehin dadurch nichts, oder?“
„Wenig“, stimmte er zu und bog auf den Hof hinter dem Haus ab. „Wenigstens, so lange wir keine Kinder haben.“
„Bist du sicher, das du überhaupt welche willst?“
„Ja. Du nicht?“
„Nein. Jedenfalls nicht so bald. Das wird ja ein furchtbarer Stress, mit dem Job und so.“
„Ja, ein paar Jahre wirst du schon aussetzen müssen.“ Er stellte die Zündung ab und löste seinen Gurt. „Ein paar Jahre? Dann bin ich doch total weg vom Fenster, ich kann bestenfalls als Sachbearbeiterin wieder anfangen!“
„Das ist der Lauf des Lebens. Was schlägst du denn vor?“
„Entweder, dass wir beide auf Teilzeit gehen, oder ein Au pair-Mädchen. Als Nur-Hausfrau sehe ich mich nicht, dazu macht mir meine Arbeit viel zu viel Spaß.“ Werner brummte, sagte aber nichts. Erst, als wir wieder im Wohnzimmer saßen, fing er erneut an: „Und warum warst du heute so böse auf Wilma?“
„Weil das doch eigentlich unsere Hochzeit ist und sich alles nur darum dreht, ob es Wilma gefällt. Ich darf niemanden einladen, denn Wilma will sich nicht mit Leuten rumärgern, die sie nicht kennt, wahrscheinlich müssen ihre grässlichen Bälger auch noch Blumen streuen und stellen mir in der Kirche ein Bein. Wozu müssen wir die Nachbarn deiner Eltern einladen? Sind die wichtiger als mein einziger Bruder?“
„Du hast ihn doch von der Liste gestrichen!“
„Weil er ohnehin nicht ohne Vero und ohne die Kinder kommen wird, und Wilma duldet doch keine Ausländer auf ihrer – deiner Hochzeit.“
„Wer soll dann deinen Trauzeugen machen?“
Ich zuckte die Achseln. „Gib mir mal die Liste!“
Ich strich sie glatt und tippte dann mit geschlossenen Augen darauf. „Paul.“
„Spinnst du?“
„Wieso? Ich kenne den doch nicht. Ist er nicht zurechnungsfähig oder was?“
„Paul ist vier Jahre alt, der Jüngste von meinem Kumpel Michi. Ist dir eigentlich egal, wer dein Trauzeuge ist?“
„Gesetzlich ist es egal, das ist doch eh nicht mehr vorgeschrieben. Und auf der Liste kenne ich niemanden. Halt, nein – Wilma wird es nicht, sonst ist es mir egal.“
Werner schnaufte und nahm mir die Liste weg. „Es bleibt bei Yannick. Und Veronique, Steffi und Jacques kommen auch, basta.“
„Danke“, murmelte ich. Er schob mir die Liste wieder hin. „Schreib deine Freunde drauf! Verdammt, das ist unsere Hochzeit, du hast Recht. Wilma soll ihre Klappe halten. Ich hätte sie damals doch aus dem Baumhaus schubsen sollen.“ Ich überlegte, den Stift in der Hand. Sonja? Petra, noch aus der Schule? Nein, seit Jahren nicht gesehen... Jemanden aus dem Büro? Tanja, meine Assistentin? Nein, lieber nicht. Cordula, meine Kollegin, mochte ich eigentlich nicht besonders. Sie war ziemlich oft krank, und ich nahm es ihr schon etwas übel, dass ich dann ihre Arbeit mitmachen musste.
Niemanden aus dem Büro... Und vom Studium? Beate und Theo? Vielleicht, aber die hatte ich seit Jahren nicht mehr gesehen und auf ihrer Hochzeit war ich auch nicht gewesen. Ich legte den Stift wieder weg. „Können wir nicht lieber die andere Seite etwas zusammenstreichen? Müssen die alle kommen? Wer sind die überhaupt?“
Werner seufzte wieder. „Tante Emma ist Mamas Schwester, sie ist wirklich nett. Mit Mann und Kindern, die Kinder haben sicher nicht alle Zeit, aber die sind ganz okay, soweit ich mich erinnern kann. Onkel Joachim ist Mamas Bruder und ein Vollidiot, aber wir können nicht Emma einladen und ihn nicht. Seine Freundin kenne ich nicht, aber sicher ist sie knapp halb so alt wie er, der alte Bock. Dr. Winkelmann ist unser Hausarzt. Helga ist Wilmas beste Freundin – komm, die streichen wir, wie kommt Wilma dazu, die einzuladen. Außerdem sind Helgas Kinder genauso anstrengend wie die von Wilma. Reinhard und Michi sind meine besten Freunde, ihre Frauen sind in Ordnung, die Kinder kenne ich nicht so gut, alle so zwischen vier und neun, denke ich. Hm... Toni und Anni sind Papas Schwestern, zwei langweilige Krähen, aber ziemlich harmlos, Onkel Josef ist Papas Bruder und furchtbar fromm. Der würde tot umfallen, wenn wir nicht in der Kirche heiraten, das gäbe jahrelangen Ärger. Und die Nachbarn – die streichen wir auch. Besser?“
Ich nickte erleichtert. Mit dem Rest konnte ich leben. Siebenundzwanzig Erwachsene und neun Kinder, viel mehr Frauen als Männer, egal. Sechsunddreißig Leute, pro Nase fünfzig Euro Kosten – das ging gerade noch.
„Auto, Blumen, Klamotten“, murmelte Werner vor sich hin und ich seufzte. „Muss ich in weißem Tüll heiraten?“
„Ach, Leni, jetzt sei doch nicht ganz so lustlos. Das ist auch meine Hochzeit, und ich möchte mich schon gerne an mehr erinnern als an eine muffige Braut.“
„Entschuldige, ich nehme mich jetzt zusammen. Hast du Hunger?“
„Nein.“ Er griff nach der Fernbedienung und lehnte sich im Sofa zurück.
3
Das Blöde an diesen Feiertagen war wirklich, dass man die Familien abklappern musste. Gut, Yannick war nicht so arg wie Werners Verwandtschaft, eigentlich war er wirklich ein netter Kerl, aber ich hatte gar keine Lust, schon wieder irgendwohin zu fahren. Viel lieber hätte ich mir einen netten Film angeguckt, wäre mit Werner lange spazieren gegangen (das liebten wir beide sehr) und hätte später vielleicht diesen Roman angefangen, den ich mir letzte Woche aus der Bücherei geholt hatte.
Stattdessen gurkten wir, mit zwei pädagogisch wertvollen Osternestern in der Tasche, nach Selling, wo Yannick und Véro ein winziges, unordentliches Reihenhaus bewohnten.
Stéphanie und Jacques freuten sich über ihre Osternester und rannten mit ihrer Beute kreischend davon, Véro umarmte mich und Yannick klopfte Werner freundlich auf die Schulter. In einer Atmosphäre von Kindergekreisch und blubberndem Kaffeewasser saßen wir gemütlich um den großen Holztisch; schließlich rief ich den beiden Kindern etwas zu, und das Kreischen verstummte. „Was hast du gesagt?“, fragte Werner, der kein Französisch konnte.
„Dass der Osterhase alles wieder abholt, wenn sie sich weiter zanken“, erklärte ich und musste lachen. „Wahrscheinlich essen sie jetzt alles fieberhaft auf, damit der böse Osterhase nur noch das Papier vorfindet.“
Véro lachte auch und holte den Kaffee, Yannick brachte eine Platte Kuchen. Ich unterhielt mich kurz mit Véro über die Kinder, merkte aber, dass Werner unruhig wurde, wenn er dem Gespräch nicht richtig folgen konnte.
Yannick und Véro arbeiteten beide in einer großen Import-Export-Firma, die vor allem hier und in Frankreich aktiv war, so dass sie ihre Zweisprachigkeit sehr nutzbringend einsetzen konnten. Véro allerdings war in der Auvergne aufgewachsen und sprach ein etwas holpriges Deutsch mit starkem Akzent; Yannick und ich hatten den Vorteil einer deutschen Mutter und eines französischen Vaters gehabt und sprachen wirklich beide Sprachen gleich gut. Mit Yannick benutzte ich in Werners Gegenwart Deutsch, mit Véro aber lieber Französisch, dann tat sie sich leichter. Die Kinder sprachen hauptsächlich deutsch, verstanden Französisch aber gut, wie man ja an meiner Osterhasenwarnung gemerkt hatte. Manchmal sprachen sie miteinander französisch, im Kindergarten, um die anderen Kinder zu ärgern. Dafür war Véro schon von der Kindergärtnerin getadelt worden – die beiden grenzten sich manchmal von der Gruppe ab... Das hatte Véro nicht weiter tragisch gefunden und war unter hohem Einsatz von Psychovokabular noch heftiger getadelt worden, bis sie gehen musste, weil sie sich das Lachen nicht mehr länger verbeißen konnte.
Ich beobachtete das Gespräch zwischen Yannick und Werner und hatte das unbestimmte Gefühl, dass die beiden sich nicht mochten. Schon daran, wie sie mich nannten, wurde deutlich, wie unterschiedlich sie waren: Hélène oder Leni? Sie respektierten die Unterschiede auch nicht, Yannick hielt Werner für einen fürchterlichen Spießer und Sesselfurzer (aber das lag an seiner allgemeinen Beamtenphobie), und Werner fand Yannick leichtfertig und unreif. Gut, Yannick war erst achtundzwanzig, aber ein braver Ehemann und Familienvater und ein ausgezeichneter Kaufmann, immerhin war er stellvertretender Geschäftsführer bei FranceImex. Dass er mir mehrfach von Werner abgeraten hatte, wusste dieser schließlich nicht.
Als ich Yannick fragte, ob er Trauzeuge sein wollte, lachte er. „Ihr macht tatsächlich Ernst? Gerne natürlich. Wann?“ Er notierte sich das Datum und lachte noch mehr, als er hörte, dass wir auch den himmlischen Segen ins Auge gefasst hatten. „Wann warst du das letzte Mal in der Kirche? Firmung?“
„So ungefähr“, gab ich mit schiefem Lächeln zu.
„Das kannst du dem Pater Rupert aber nicht erzählen“, warnte Werner.
„Das weiß ich auch“, brummte ich. „ich heirate doch nicht kirchlich, weil ich so scharf drauf bin, sondern wegen deines Onkels Josef. Und dass du so fromm wärst, ist mir auch ganz neu. In den sechs Jahren, die wir jetzt zusammen sind, warst du kein einziges Mal in der Kirche!“
„Doch, vor zwei Jahren an Weihnachten. Und bei Benedikts Taufe, du warst doch dabei.“
„Ja, gut, aber nicht aus religiösem Bedürfnis heraus, oder?“
Werner nahm sich lieber noch ein Stück Kuchen. Stéphanie bestand darauf, auf meinem Schoß zu sitzen und mir alle ihre Ostereier zu zeigen. Ich bewunderte die aufgeweichte Sammlung und half ihr beim Zählen, bis sie schließlich wieder von meinen Knien rutschte, um Jacques damit zu ärgern, dass sie die exakte Zahl ihrer Ostereier kannte. Ich grinste hinterher. Irgendwie waren die beiden netter als Wilmas Brut, vielleicht, weil Véro ziemlich streng werden konnte, wenn ihr das Geschrei und Gezanke zu viel wurde. Sollten wir jemals Kinder haben, nahm ich mir vor, würde ich sie streng, aber gerecht erziehen, damit sie nicht solche Nervensägen wurden wie Wilmas Kinder.
Werner unterhielt sich mit Yannick über die Wirtschaftslage (reines Männerthema, auch wenn die anwesenden Frauen das Gleiche studiert hatten), Véro und ich diskutierten über die Frage, warum Männer immer kniffen, wenn es darum ging, dass sie mal über Teilzeit nachdenken sollten. Yannick hatte in dieser Hinsicht auch versagt, aber mittlerweile war Véro bei FranceImex schon wieder fast mit Vollzeit eingestiegen, Stéph war im vorletzten Jahr des Kindergartens, Jacques im letzten.
„Pass bloß auf“, unkte ich, „in der Grundschule haben sie viel früher aus. Hast du eine Tagesmutter für die beiden?“
„Ja, gleich drei Häuser weiter. Da sind sie jetzt schon manchmal.“
Ich war neidisch. Ob ich auch so leicht eine anständige Kinderbetreuung finden würde? Na, vorläufig würde ich die Pille einfach weiter nehmen, vielleicht vergaß Werner diese Nachwuchsidee ja wieder.
Wir unterhielten uns noch eine Zeitlang etwas gezwungen zu viert, gelegentlich von den Kindern unterbrochen, dann wollte Werner aufbrechen. Vielleicht waren ihm die Kindheitserinnerungen von Yannick und mir zu viel geworden? Das hatte er noch nie leiden können, wenn wir auf die Weißt-du-noch-Schiene gerieten. Wir hatten aber eine zauberhafte Kindheit gehabt und uns meistens auch gut vertragen, also wärmten wir das eben gelegentlich gerne auf.
4
Eigentlich war ich ganz froh, dass diese dämlichen Feiertage vorbei waren, stellte ich im Stillen fest, als ich am Dienstagmorgen meine Tasche auf meinen tadellos aufgeräumten Schreibtisch fallen ließ. Endlich wieder Alltag, Arbeit, Haushalt, keine Familie und hoffentlich kein Wort von dieser bescheuerten Hochzeit!
Natürlich hatte Werner Recht, wenn er fand, dass ich ihm die Vorfreude auf die Hochzeit nicht durch meine betont lustlose Einstellung vermiesen sollte, aber dieses ganze Geschiss ging mir derartig auf die Nerven, dass ich einfach nicht anders konnte. Gut, die Gästeliste hatten wir zusammengestrichen, ich musste noch ein geeignetes Mehrzweckkleid und ein nicht zu furchtbares Restaurant finden und dieses unsägliche Brautgespräch absolvieren, ohne dass der Pfarrer merkte, wie wenig ich hinter einer kirchlichen Trauung stand - aber dann hätte ich das Gröbste ja wohl überstanden. Manchmal fragte ich mich zwar, ob ich in eine Familie einheiraten wollte, in sich der so etwas wie Wilma ungeniert breitmachte, aber dann fiel mein Blick wieder auf Werner, den lieben, guten Werner, mit dem ich seit Jahren so problemlos zusammenlebte, und ich war mir wieder sicher.
Schluss damit, Tanja schleppte gerade einen Haufen Mappen an. „Hier, das sind die Abrechnungen aus der Produktion, und das ist wegen dieser Kreditumschichtung, Schmidt sagt, das sollen Sie sich mal ansehen, und angeblich stimmt bei diesen Kalkulationen für die neue Produktpalette irgendwas nicht.“ Krachend lud sie den Stapel auf meinen Tisch. Ich verkniff es mir gerade noch, mir die Hände vor lauter Vorfreude zu reiben, und schlug als erstes die Kreditmappe auf, das war termingebunden und ziemlich eilig, weil wir morgen mit der Bank verhandeln mussten.
Ich brütete etwa eine Stunde über den Unterlagen, rechnete und kalkulierte, schlug einiges in den alten Kreditverträgen nach und hatte den strittigen Punkt schließlich gefunden. Statt Tanja meine Ergebnisse zu diktieren, schickte ich sie lieber Kaffee kochen und tippte meine Anmerkungen schnell selbst.
Sobald sie mit einem verheißungsvoll dampfenden Becher zurückkam - so stark, dass der Löffel drin stehen blieb - bat ich sie, die Mappe zu Schmidt, meinem Kollegen, zurückzubringen.
Wir waren in dieser Abteilung zu dritt, Felix Schmidt, Cordula Wernheimer und ich; über uns stand der Chef der Abteilung Finanzen und Marketing; die Stelle war allerdings im Moment unbesetzt, weil Frank Ingener, der bisherige Chef, im Januar zum Bungeejumping nach Australien geflogen war. Nein, das Seil war nicht gerissen, böse Zungen meinten aber, das wäre doch wenigstens spektakulär gewesen. Er hatte sich eine ganz profane Thrombose auf dem endlosen Flug zugezogen und war noch auf dem Flughafen von Sydney tot umgefallen. Seitdem war der Posten unbesetzt; die Geschäftsleitung suchte entweder immer noch oder hoffte, die Position einsparen zu können. Alle Firmen sparten zurzeit wie verrückt, da machten wir keine Ausnahme, obwohl das Geschäft blühte.
Im Stillen war ich der Meinung, das der Job eines Finanz- und Marketingchefs wirklich überflüssig war; Felix und ich schafften die Arbeit locker, auch Cordula konnte man eigentlich feuern, aber dazu hätte sie erstmal da sein müssen. Heute war sie schon wieder krank, Kreislaufprobleme! Was der Frau fehlte, was auch bloß ein Tritt in den Hintern.
Unter uns dreien standen noch die jeweiligen Assistentinnen, Inge bei Felix, Tanja bei mir, Irmgard (deutlich älter und besonnener) bei Cordula.
Ich nahm mir die nächste Mappe vor, die Kalkulationen für die neue Produktpalette. Happige Summen kamen da zusammen, und die geschätzten Ladenpreise erschienen mir leicht überzogen. Ich rechnete alles nach und kalkulierte dann lieber neu, nachdem ich einige Vorschläge für Einsparungen an den Rand gekritzelt hatte.
Die Produktionsabrechnungen waren wöchentliche Routine, aber heute sahen sie befremdlich aus, ohne dass ich sofort den Finger auf das Problem legen konnte. Wer hatte das denn abgezeichnet? Siemers? Nein, Promberger persönlich, dann mussten sie doch eigentlich korrekt sein…
Trotzdem fieselte ich Posten für Posten und Buchung für Buchung durch und fand tatsächlich eine – allerdings nicht allzu große – Fehlbuchung. Ich besserte sie in Rot aus und schickte die Abrechnung in die Produktion zurück, dann widmete ich mich dem Standardkram, der sich im Lauf der letzten zwei Stunden in meinem Eingangskorb angesammelt hatte, und warf einen Blick in den Terminplaner, den Tanja, so jung sie noch war, penibel führte: 15.00 Besprechung Dr. Oberl. Da hatte ich ja noch Zeit; ich warf die abgezeichneten Akten in den Ausgangskorb und ging Anja Dichtl in der Personalabteilung besuchen. Sie stand zwar in der Hierarchie eine Stufe über mir, aber wir verstanden uns gut und ich wollte sie fragen, was wir wegen Cordula unternehmen konnten.