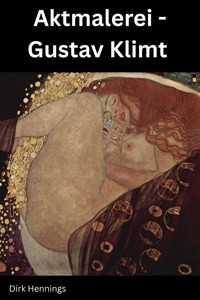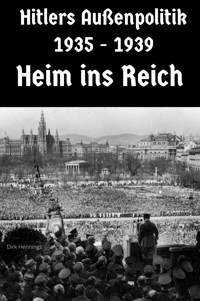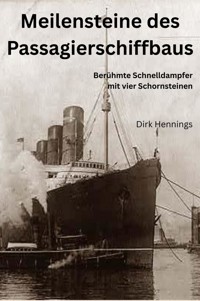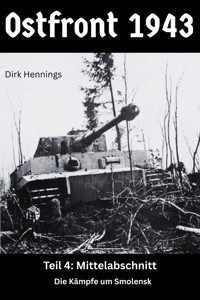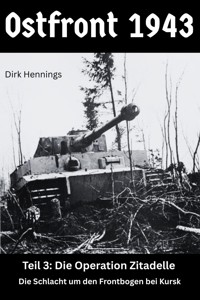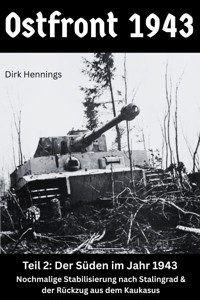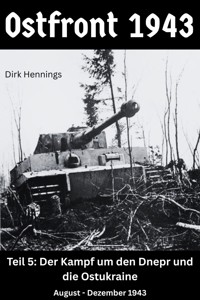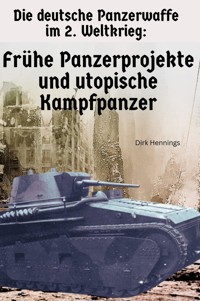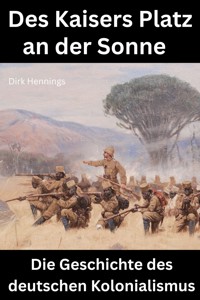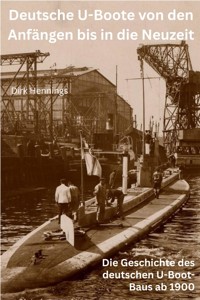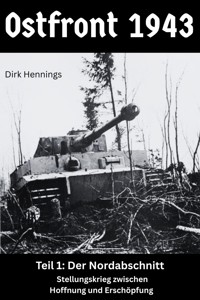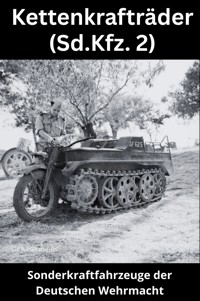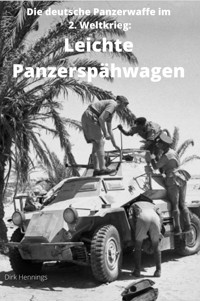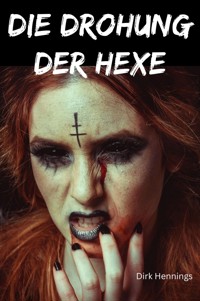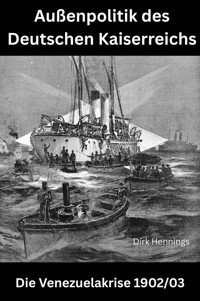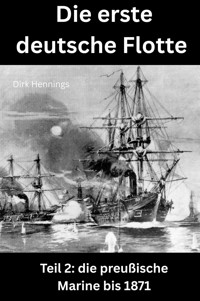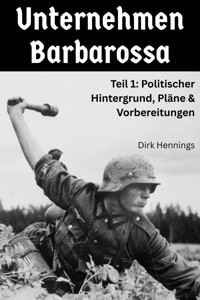
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
UNTERNEHMEN BARBAROSSA Teil 1: Politischer Hintergrund, Pläne & Vorbereitungen Dieses Buch beschäftigt sich mit der Vorgeschichte des Deutsch-Sowjetischen Krieges. Dabei wird jedoch nicht nur der militärische Aspekt der Kriegspläne betrachtet. Insbesondere werden die ideologischen, politischen und kriegswirtschaftlichen Motive Hitlers und des NS – Regimes beleuchtet. Der sogenannte Generalplan Ost wird vorgestellt, um einen Eindruck über die wirtschaftspolitischen und Siedlungspolitischen Kriegsziele nach dem Endsieg zu bekommen. Ein weiterer Aspekt ist die wirtschaftliche und rüstungsmäßige Vorbereitung auf den Ostfeldzug. Historisches Bild- und Kartenmaterial ergänzt dieses Werk. Umfang 139 Seiten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unternehmen Barbarossa
Teil 1: Politisch – Ideologischer Hintergrund, Pläne & Vorbereitungen
IMPRESSUM:
Dirk Hennings
c/o IP-Management #4887
Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg
Einleitung
Unternehmen Barbarossa (ursprünglich Fall Barbarossa) war der Deckname für den Angriffskrieg der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Der vom NS-Regime geplante und vorbereitete militärische Überfall am 22. Juni 1941 eröffnete den Deutsch-Sowjetischen Krieg. Die Operation Barbarossa war mit 3 Millionen Soldaten, die die Grenze der Sowjetunion überschritten, der größte und zerstörerischste militärische Feldzug der Geschichte.
Bereits im Jahr 1925 hatte Adolf Hitler die Vernichtung des Bolschewismus zu einem ideologisch-politischen Hauptziel des Nationalsozialismus erklärt. Er hatte den Angriff auf die Sowjetunion nach dem Sieg über Frankreich im Juni 1940 ins Auge gefasst und sein Ziel dem Oberkommando der Wehrmacht (OKW) am 31. Juli 1940 eröffnet. Mit der Weisung Nr. 21 erteilte Hitler dem OKW am 18. Dezember 1940 den Befehl zur Vorbereitung der Militäroperation unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa.
Die darauf folgende Planung löste frühere Planstudien der Wehrmachtführung ab, die unter anderen Decknamen wie „Otto“ und „Fritz“ für den Krieg gegen die Sowjetunion vorgesehen hatten. Sie zielte auf einen rassistischen Vernichtungskrieg zur Zerstörung des „jüdischen Bolschewismus“: Der gesamte europäische Teil der Sowjetunion sollte erobert, ihre politischen und militärischen Führungskräfte ermordet und große Teile der Zivilbevölkerung dezimiert und entrechtet werden. Mit dem Hungerplan, zu dem die Belagerung Leningrads gehörte, wurde der Hungertod vieler Millionen von Kriegsgefangenen und Zivilisten einkalkuliert. Nach dem „Generalplan Ost“ sollten großangelegte Vertreibungen folgen, um die eroberten Gebiete anschließend zu germanisieren. Außerdem wurden Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD ausgebildet, die hinter der Front Massenmorde an Juden, Slawen und kommunistischen Funktionären begehen sollten. Zu all dem erteilte das NS-Regime seit März 1941 völkerrechtswidrige Befehle, die von der Wehrmachtführung ihrerseits übernommen und weitergegeben wurden (Kommissarbefehl).
Die Umsetzung des Unternehmens scheiterte bereits im Dezember 1941 mit der deutschen Niederlage in der Schlacht um Moskau. Dennoch setzten das NS-Regime und die Wehrmacht den Krieg und den zeitgleich vorangetriebenen Holocaust gegen Teile der Zivilbevölkerung bis zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 fort.
Nachstehend die Kopie der Weisung Nr. 21 Fall Barbarossa
Im Nachtrag dann die Reinschrift
WEISUNG Nr. 21: Fall Barbarossa
Die Deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrußland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa).
Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben mit der Einschränkung, daß die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen.
Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so starke Kräfte zur Unterstützung des Heeres freizumachen, daß mit einem raschen Ablauf der Erdoperationen gerechnet werden kann und die Schädigung des ostdeutschen Raumes durch feindliche Luftangriffe so gering wie möglich bleibt. Diese Schwerpunktbildung im Osten findet ihre Grenze in der Forderung, daß der gesamte von uns beherrschte Kampf- und Rüstungsraum gegen feindliche Luftangriffe hinreichend geschützt bleiben muß und die Angriffshandlungen gegen England, insbesondere seine Zufuhr, nicht zum Erliegen kommen dürfen.
Der Schwerpunkt des Einsatzes der Kriegsmarine bleibt auch während eines Ostfeldzuges eindeutig gegen England gerichtet.
Den Aufmarsch gegen Sowjetrußland werde ich gegebenenfalls acht Wochen vor dem beabsichtigten Operationsbeginn befehlen.
Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind – soweit noch nicht geschehen – schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum 15. 5. 41 abzuschließen.
Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu legen, daß die Absicht eines Angriffes nicht erkennbar wird.
Die Vorbereitungen der Oberkommandos sind auf folgender Grundlage zu treffen:
I. Allgemeine Absicht:
Die im westlichen Rußland stehende Masse des russischen Heeres soll in kühnen Operationen unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen vernichtet, der Abzug kampfkräftiger Teile in die Weite des russischen Raumes verhindert werden.
In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die russische Luftwaffe reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann. Das Endziel der Operation ist die Abschirmung gegen das asiatische Rußland aus der allgemeinen Linie Wolga–Archangelsk. So kann erforderlichenfalls das letzte Rußland verbleibende Industriegebiet am Ural durch die Luftwaffe ausgeschaltet werden.
Im Zuge dieser Operationen wird die russische Ostseeflotte schnell ihre Stützpunkte verlieren und damit nicht mehr kampffähig sein.
Wirksames Eingreifen der russischen Luftwaffe ist schon bei Beginn der Operation durch kraftvolle Schläge zu verhindern.
II. Voraussichtliche Verbündete und deren Aufgaben:
1. Auf den Flügeln unserer Operation ist mit der aktiven Teilnahme Rumäniens und Finnlands am Kriege gegen Sowjetrußland zu rechnen.
In welcher Form die Streitkräfte beider Länder bei ihrem Eingreifen deutschem Befehl unterstellt werden, wird das Oberkommando der Wehrmacht zeitgerecht vereinbaren und festlegen.
2. Rumäniens Aufgabe wird es sein, den Angriff des deutschen Südflügels, wenigstens in seinen Anfängen, mit ausgesuchten Kräften zu unterstützen, den Gegner dort, wo deutsche Kräfte nicht angesetzt sind, zu fesseln und im übrigen Hilfsdienste im rückwärtigen Gebiet zu leisten.
3. Finnland wird den Aufmarsch der aus Norwegen kommenden abgesetzten deutschen Nordgruppe (Teile der Gruppe XXI) zu decken und mit ihr gemeinsam zu operieren haben. Daneben wird Finnland die Ausschaltung von Hangö zufallen.
4. Mit der Möglichkeit, daß schwedische Bahnen und Straßen für den Aufmarsch der deutschen Nordgruppe spätestens von Operationsbeginn an zur Verfügung stehen, kann gerechnet werden.
[ . . . ]
IV. Alle von de n Herren Oberbefehlshabern auf Grund dieser Weisung zu treffenden Anordnungen müssen eindeutig dahin abgestimmt sein, daß es sich um Vorsichtsmaßnahmen handelt für den Fall, daß Rußland seine bisherige Haltung gegen uns ändern sollte. Die Zahl der frühzeitig zu den Vorarbeiten heranzuziehenden Offiziere ist so klein wie möglich zu halten; weitere Mitarbeiter sind so spät wie möglich und nur in dem für die Tätigkeit jedes Einzelnen erforderlichen Umfang einzuweisen. Sonst besteht die Gefahr, daß durch ein Bekanntwerden unserer Vorbereitungen, deren Durchführung zeitlich noch gar nicht festliegt, schwerste politische und militärische Nachteile entstehen.
Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, RW 4 / v. 522; abgedruckt in: „Führerweisung“ (18. Dezember 1940). In Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, 1918-1945. Bonn: Gebrüder Hermes KG, 1964. Serie D (1937-1945). Band XI, 2: Die Kriegsjahre. Vierter Band, Zweite Halbband, 13. November 1940 bis 31. Januar 1941. Dokumentnummer 532, S. 750-53.
Bezeichnung
Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) und die Oberkommandos der Wehrmachtteile Heer, Oberkommando des Heeres (OKH), und Marine, Oberkommando der Marine (OKM), hatten seit Juni/Juli 1940 je eigene Planstudien für einen begrenzten Krieg gegen die Sowjetunion erstellen lassen und ihnen Decknamen wie „Problem S“, „Fritz“ und Titel wie „Operationsstudie Ost“ (Abteilung Landesverteidigung im Wehrmachtführungsamt, OKW), „Operationsplan Ost“ (OKH) oder „Betrachtungen über Rußland“ (OKM) gegeben. Diese Studien wurden bis zum 5. Dezember 1940 vereint und Hitler dann vorgetragen. Ab dann trug die Gesamtplanung den Decknamen „Otto“.
Schon der Anschluss Österreichs 1938 sollte unter dem Decknamen „Sonderfall Otto“ militärisch vorbereitet werden. General Ludwig Beck hatte den Plan für den „Sonderfall Otto“ nicht weisungsgemäß ausgearbeitet, so dass dieser nicht ausgeführt werden konnte. Hitler erließ daher am 11. März 1938 eine kurzfristig formulierte Weisung, den Anschluss Österreichs unter dem Decknamen „Unternehmen Otto“ am Folgetag durchzuführen. Dabei konnten weisungsgemäße militärische Eingriffe weitgehend unterbleiben, so dass der Befehl nicht allen Wehrmachtsstellen bekannt wurde. Der Name spielt wohl auf den römisch-deutschen Kaiser Otto I. an, dessen „Verdienste um das Deutschtum“, „Slawen-“ und „Kolonialpolitik“ sowie „Eindeutschung“ eroberter osteuropäischer Gebiete verbreitete Geschichtsbücher der Weimarer Republik als vorbildlich hervorhoben. An dieses Geschichtsbild anknüpfend, verstanden die Nationalsozialisten ihre Eroberungspolitik als Wiederaufnahme angeblicher Pläne der Ottonen zur Unterwerfung der Slawen und zur Expansion nach Osteuropa. Dazu diente ihnen die „Ostforschung“, die von dem Historiker Albert Brackmann dominiert wurde. Die pseudowissenschaftliche Benutzung von historischen Bezügen auf mittelalterliche Herrscher für einen „hemmungslosen Imperialismus“ hatte Brackmanns Kollege Hermann Aubin am 25. Januar 1939 brieflich kritisiert:
„Geben Sie acht, wie bald Otto I. und Friedrich I. obenauf sein werden, weil sie das Beispiel gegeben haben, wie man eine ‚deutsche Ordnung‘ aufzurichten hat.“
Doch Brackmann erstellte nach dem Überfall auf Polen im Auftrag Heinrich Himmlers im Oktober 1939 eine Broschüre über „Krisis und Aufbau in Osteuropa“ mit eben solchen Bezügen. Die Wehrmacht kaufte davon am 7. Mai 1940 7000 Exemplare.
Am 25. Juli 1940 tauchte mit dem Otto-Programm der Deckname „Otto“ in einem Befehl des OKW erneut auf, diesmal für ein „bevorzugtes Wehrmachtsprogramm“ zum Ausbau von Schienen und Straßen im besetzten Teil Polens, das schnelle Truppen- und Panzertransporte an die Ostgrenze ermöglichen sollte. Darin sehen Historiker erste Vorbereitungen eines Krieges gegen die Sowjetunion.
Das Otto-Programm
Der Name war eine Reminiszenz an die Ostausdehnung des Reiches zur Zeit des Sachsenkaisers Otto I. Bereits am 17. Oktober 1939 hatte Hitler das besetzte Polen als „vorgeschobenes Glacis“ und „deutsches militärisches Aufmarschgebiet für die Zukunft“ bezeichnet und angeordnet „Vorsorge zu treffen, daß das Gebiet [...] für einen Aufmarsch ausgenutzt werden kann“ und dazu Bahnen, Straßen und Nachrichtenverbindungen in Ordnung zu bringen. Für den Aufmarsch gegen die Sowjetunion mussten diese Arbeiten jedoch erheblich intensiviert werden. Die Streckenleistungen und Ausladeleistungen mussten verdoppelt werden. Dazu war neben erheblichen Erweiterungen der Neubau von 20 Lokomotivbahnhöfen und zahlreichen Militärrampen, Kreuzungsbahnhöfen, Blockstellen, Signalanlagen, Fernsprecheinrichtungen und Ausbesserungswerken nötig.
Am 4. und 11. Juli 1940 wurde dies bereits von Generalstabschef Franz Halder mit dem Transportchef Rudolf Gercke erörtert. Am 25. Juli wurde das Otto-Programm entworfen und am 9. August den zuständigen Reichsbehörden und dem Generalgouverneur Hans Frank in dem Befehl „Aufbau Ost“ zugeleitet. Frank erklärte daraufhin „es müsse alles andere zurückgestellt werden“ und er werde nötigenfalls „mit eiserner Strenge durchgreifen“ um den Befehl des Führers zu erfüllen. Es sollte zuerst bis zum 31. Dezember 1940, später bis 15. April 1941 erfüllt werden.
70.000 Mann aus Eisenbahntruppen, Bauformationen des Heeres, der Organisation Todt und polnischen Baufirmen wurden mobilisiert. Mit einem Volumen von 270 Millionen Reichsmark war es mit Abstand das größte Bauprogramm der Reichsbahn. Die Wehrmacht erklärte 60 % der Baukosten zu übernehmen. Um Misstrauen der sowjetischen Seite zu zerstreuen, dienten die Bauarbeiten offiziell dem Wirtschaftsverkehr.
Trotz erheblicher Schwierigkeiten konnte das Programm fristgemäß erfüllt werden.
Grundsteinlegung Bauarbeiten in Krakau, v. l. n. r. Heinrich Himmler, Hans Frank, Kurt Daluege
Von Bundesarchiv, Bild 121-0271 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5338067
Doch nach diesem Exkurs wieder zurück zur Geschichte des Unternehmens Barbarossa. Zur Ausarbeitung eines entsprechenden Kriegsplans hatte Franz Halder, seit September 1938 Chef des Generalstabs des Heeres, seinen Stab am 19. Juni oder 3. Juli 1940 beauftragt. Dieser Plan wurde nach dem 31. Juli erweitert, mit anderen Plänen zusammengeführt und im Dezember den Kriegsvorbereitungen des OKW und OKH zugrunde gelegt.
Der seinerzeitige Oberstleutnant i. G. Bernhard von Loßberg erklärte 1956, Alfred Jodl (OKW) habe den bisherigen Decknamen „Fritz“ für den von ihm verfassten Plan „später“ durch „Barbarossa“ ersetzt. Hitler verfügte am 18. Dezember 1940 mit „Weisung Nr. 21“, den Krieg gegen die Sowjetunion unter dem neuen Decknamen „Fall Barbarossa“ vorzubereiten. Er spielte damit, wie von Aubin 1939 erwartet, auf Friedrich I. an, der diesen Beinamen trug und neben den ersten beiden Ottonen der anerkannteste mittelalterliche Kaiser war. Hitler hatte ihn bei seiner Einweihung des „Hauses der Deutschen Kunst“ im Juli 1937 als den gerühmt, „der als erster den germanischen Kulturgedanken ausgesprochen und als Bestandteil seiner imperialen Mission nach außen getragen habe“.
Erstmals am 18. Januar 1941 bezeichneten manche Wehrmachtsstellen den geplanten Angriff intern auch als „Unternehmen Barbarossa“.
Hitlers „Ostprogramm“
Hitler hatte einen Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion schon 1925 in seiner Programmschrift Mein Kampf zum Hauptziel seiner Außenpolitik erklärt. Er begründete diesen mit dem unvermeidbaren weltgeschichtlichen Kampf der „arischen Rasse“ gegen das „Weltjudentum“, dessen extremste Herrschaftsform der „Bolschewismus“ sei. Dort zeige sich „der Jude“ als „Völkertyrann“, so dass man nur beide zugleich bekämpfen könne.
Folglich komme ein Bündnis mit der Sowjetunion nicht in Frage; man könne „nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben“. Ferner sei die bloße Rückeroberung von durch den Ersten Weltkrieg verlorenen deutschen Gebieten „politischer Unsinn“. Es müsse vielmehr darum gehen, dem deutschen Volk für alle Zeit „den ihm gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu sichern“, der ihm wirtschaftliche Unabhängigkeit im kontinentalen Großraum Europa garantiere. Dieser Boden sei vor allem in Russland und dessen von ihm unterworfenen Randstaaten zu suchen. Der Nationalsozialismus verkünde daher auch gegenüber den „Annexionisten“ des Kaiserreichs als neues Ziel: „Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten.“ Hitler legitimierte diese Perspektive mit zwei Annahmen: einer rassischen, daher auch politischen und militärischen Unterlegenheit der angeblich von den Juden beherrschten Slawen, so dass die Sowjetherrschaft „reif zum Zusammenbruch“ sei, und einer Bereitschaft Großbritanniens, Deutschlands vorherige Eroberung Frankreichs zu akzeptieren und es dann im Kampf gegen die Sowjetunion zu unterstützen. Er kritisierte die Eliten des Kaiserreichs dafür, dass sie weder mit Großbritannien noch Russland ein klares Bündnis gesucht, sondern Deutschland in einen nicht gewinnbaren Zweifrontenkrieg verwickelt hätten. Daraus folgerte er, die Sowjetunion sei erst nach einem Bündnis mit Großbritannien, das die vorherige Eroberung Frankreichs und so deutsche „Rückenfreiheit“ decken sollte, zu erobern.
1928 bekräftigte Hitler in seinem „Zweiten Buch (*)“: da Deutschland seinen Lebensraum dauerhaft nur im Osten finden könne, habe ein Bündnis mit der Sowjetunion keinen Sinn. Das destruktiv veranlagte Judentum werde den Sowjetstaat zerstören und es den Deutschen erleichtern, die Hemmung gegenüber dem einzig möglichen „Ziel der deutschen Außenpolitik“ abzulegen: „Lebensraum im Osten“ zu erobern, der „für die nächsten 100 Jahre“ ausreiche. Dazu müsse Deutschland „große militärische Machtmittel“ erlangen und alle seine staatlichen Kräfte auf diese Eroberung konzentrieren.
(*)Hitlers Zweites Buch ist ein zu Lebzeiten unveröffentlichtes Manuskript Adolf Hitlers, das 1928 entstand. Es handelt sich um einen Entwurf für eine Fortsetzung von Mein Kampf, in dem Hitler sich zum Teil mit neuen Themen befasste. Nur zwei Exemplare des ursprünglich rund 200 Seiten umfassenden Manuskripts wurden angefertigt. Das Zweite Buch wurde 1928 nicht veröffentlicht, weil der Verkauf von Mein Kampf schleppend verlief und der Franz-Eher-Verlag den Autor wissen ließ, dass eine weitere Buchveröffentlichung zu diesem Zeitpunkt den Verkauf eher noch behindern würde. Als der Verkauf von Mein Kampf infolge der Reichstagswahl 1930 wieder anstieg, befand Hitler, dass das Zweite Buch zu viele seiner außenpolitischen Absichten verrate.
In dieser Formel verband Hitler untrennbar rassistische, expansionistische und imperialistische Vorstellungen. Das Ziel, die europäischen Teile der Sowjetunion zu erobern, sollte die gesamte deutsche Rüstungs- und Außenpolitik bestimmen und eine spätere Weltherrschaft der deutschen Arier ermöglichen.