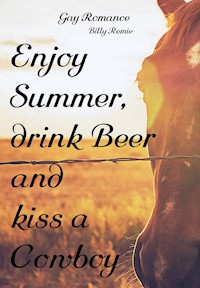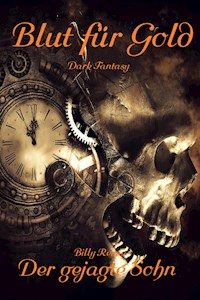Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Legenden aus Nohva 4
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Jahre in Verbannung, zwanzig Jahre im Verborgenen gelebt, doch seine Feinde nahmen ihm schließlich alles. Seine Zuflucht. Seine Gefährten. Selbst seine Erinnerungen. Weder konnte er sich an die erinnern, die er verloren hatte, noch an seinen eigenen Namen. Er wacht ohne Gedächtnis im Kerker des Königs auf und wartet mit einem vermeintlichen Dieb auf seine Hinrichtung. Doch noch war nicht gänzlich alle Hoffnung verloren. Tief in seinem Geist schlummert die Macht einer uralten Magie, die ihm unerwartet zur Freiheit verhilft. Doch es war auch jene Magie, der er es zu verdanken hat, dass er schließlich mit seinem Mitgefangenen und einem Soldaten, der sie aufhalten soll, in der lebensfeindlichen Wildnis strandet. Ohne Vorräte, ohne Rüstung, ohne Waffen. Nun galt es, irgendwie zu überleben, doch sie konnten dem Soldaten des Königs nicht vertrauen. Und noch immer blieb er ohne Erinnerung, während seine früheren Gefährten ihn bereits für tot halten. Die größte Prüfung seines Lebens steht dem Blutdrachen bevor, und er hat keine Ahnung, wie grausam das Schicksal ihm diesmal mitspielt. *Gay Fantasy Romance
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1270
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Zähmung des Feuers
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Epilog
Danksagung
Impressum neobooks
Prolog
Ein Windstoß traf auf das blutbeschmierte Gesicht des Großkönigs. Sein blondes Haar wurde von der reißenden Herbstluft zerzaust, die den Gestank von Blut, verbranntem Fleisch und Tod vom Schlachtfeld wehte, und einen geradezu absurd idyllischen Duft verbreitete, der nicht zu dem Leichenberg passen wollte, auf den Großkönig Melecay Wiglaf von Carapuhr einen Fuß stellte und mit erhobenem Schwert seinen Männern ein Siegesbrüllen schenkte, das von den etwa noch hundert stehenden königlichen Soldaten ebenso hingebungsvoll erwidert wurde.
Wie Hunde knurrten und bellten sie ihrem König entgegen, den sie gleichzeitig respektierten und fürchteten wie nichts Anderes in ihrem kurzen Soldatenleben.
Am Himmel kreisten die dunklen Schwingen mittelgroßer Drachen, so viele, dass sie den Himmel verdunkelten als sei es Nacht. Sie kreischten unisono mit ihrem Gebieter.
Desiderius spuckte blutigen Speichel auf den Boden und wischte sich mit der freien Hand über die aufgeplatzte Lippe. Zum Ende des kleinen Tumults hin hatte er einen Knauf ins Gesicht bekommen, ein Zahn saß nun locker – er hoffte, er würde ihn nicht verlieren und somit gezwungen sein, bis in alle Ewigkeit mit geschlossenen Lippen zu lächeln. Nicht, dass sein Lächeln bisher als schön oder erwähnenswert hätte betrachtet werden können.
Während Melecay sich feiern ließ, stieg Desiderius über sein letztes Opfer, einem rebellierenden Alten, der mit einigen Gleichgesinnten einen Aufstand gegen den Großkönig von Carapuhr angezettelt hatte, weil sie mit Melecay als ihren Herrscher nicht einverstanden waren.
Da Melecay Wiglaf von Carapuhr noch nie dafür bekannt gewesen war, irgendetwas mit Diplomatie zu regeln, hätte es diese Handvoll rebellierender Bürger nicht überraschen sollen, dass Melecay ohne zu zögern ihren Bund aus etwa fünfzig Männern zerschlagen würde.
Die armen Teufel hatten es nicht kommen sehen, noch in der Nacht war ihr Lager überrannt worden.
Nun ging die Sonne über den Tannen Carapuhrs auf, am Horizont war der Himmel in Rot getaucht, genau wie der matschige Hügel, auf dem sie in Blut und Leichen standen.
Desiderius ging langsam auf den Großkönig zu, von der Drachenflügelklinge in seiner Hand tropfte noch frisches, hellrotes Blut. »Melecay …« Es klang tadelnd, aber auch belustigt.
Mit einem breiten Lachen, das in einem vom fremden Blut bedeckten Gesicht prangte, drehte sich Melecay zu Desiderius um und breitete die Arme aus, als wolle er ihn umarmen. Er lachte teils irre, teils kindlich.
»Wir haben gewonnen, würde ich sagen«, verkündete der Großkönig.
Mit einem amüsierten Schmunzeln lehnte Desiderius sich auf sein Schwert. »Wie könnte es auch anders sein, Großkönig?«
Bei dem Klang seines Titels wurde das Funkeln in Melecays blauen Augen noch etwas stärker. »Ich versage nie. Wir sind unbesiegbar, du und ich.«
Das Schmunzeln auf Desiderius‘ Gesicht wurde zu einem müden Lächeln, das jedoch ein großes Maß an Nachsicht für den jungen König ausstrahlte.
Melecay war noch nicht lange Großkönig, und er musste noch lernen, dass er nicht jeden Aufstand mit einem Kampf beenden konnte. Nicht einmal zum Schutze seiner Bevölkerung, vielmehr ging es dabei um Finanzierung. Jede noch so kleine Schlacht kostete viel Silber. Es war zu teuer, jeden Feind mit Gewalt niederzumachen. Doch das war nicht Desiderius‘ Problem. Noch nicht jedenfalls. Im Moment sorgte er sich mehr darum, ob Carapuhr sein Versprechen gegenüber Nohva halten konnte, wenn Melecay nicht umsichtiger mit seinen Ausgaben umging.
Der Großkönig Carapuhrs hatte ein Bündnis mit Nohvas Prinzen, und wenn Desiderius mit seinen Befürchtungen richtiglag, würden sie es letztlich auch in Anspruch nehmen müssen. Auch wenn Wexmell sich noch zierte und zögerte, letztlich würden sie Melecays Armee früher oder später in Nohva als Unterstützung nötig haben. Eine andere Armee stand ihnen derzeit nämlich nicht zur Verfügung.
Melecay drehte seinen Männern den Rücken zu, die schon fleißig dabei waren, ihren Feinden alles Wertvolle abzunehmen – seien es edle Schwerter oder glänzende Ringe –, und kam für ein vertrautes Gespräch auf Desiderius zu.
»Sie werden es zukünftig zweimal überdenken, ob sie etwas an meiner Wahl auszusetzen haben«, sagte der Großkönig mit grimmiger Miene. Er bückte sich und wischte seine Klinge am Harnisch eines Sterbenden ab, aus dessen geöffneter Kehle und offenen Lippen Blut gluckerte wie aus einem zerschlagenem Weinfass.
Melecay steckte das Schwert in die Scheide und rieb sich das dreckige Gesicht mit den ebenso beschmutzten Händen.
Es gab viele Aufstände seit Melecay König war, und es gab gewiss einige Gründe, ihn zu fürchten, vor allem wegen seines Jähzorns und seiner Bereitschaft, Leben zu opfern. Jedoch waren es vermehrt Männer, die nur aus einem Grund an ihrem König zweifelten. Sie waren verärgert, weil Melecay sich keine reinrassige Frau zur Gemahlin genommen hatte, sondern einen spitzohrigen Mann.
Prinzgemahl Dainty stammte aus Elkanasai und war ehemaliger Assassine des Kaiserreichs. Das jungenhafte Spitzohr war wohl mit Abstand Großkönig Melecays größte Passion, und deshalb würde der Großkönig dessen Ruf auch stets mit Blutvergießen schützen.
Wenn eine Rebellion angezettelt wurde, weil der Großkönig Männer liebte, war es keine Frage wert, ob Desiderius Melecay zur Seite stand. Er würde für seinesgleichen immer kämpfen.
Deshalb war er heute hier.
Nun ja, deshalb und weil er – auch wenn er es Wexmell nicht gestehen konnte – das Kämpfen vermisste.
Melecay legte Desiderius einen Arm und die Schultern und stemmte die andere Hand mit einem zufriedenen Seufzen in die Seite. Er war einen guten Kopf größer als Desiderius, so wie alle Landsleute Carapuhrs, und die Hand, die nun um Desiderius‘ Schulter lag, glich einer Bärenpranke. Trotzdem wirkte Melecay keineswegs übertrieben, er war schlank und wendig, mit einer geringen Ähnlichkeit zu einem Berserker, jedoch noch immer ein flinker Krieger, kein Rammbock.
»Lass uns feiern, Derius!« Melecay drückte seine Schulter und lächelte ihm voller Siegesfreude zu. »Ich freue mich darauf, Wexmell wieder zu sehen.«
Desiderius lächelte zurück. »Und er wird sich freuen, dich zu sehen.«
In der Nacht und am Morgen kämpften sie noch Seite an Seite und hatten Leben geopfert, ebenso wie sie zusahen, wie Verbündete weinend und nach ihren Müttern schreiend starben, und schon am Abend saßen sie zusammen, speisten und tranken gutgelaunt, ohne Reue wegen ihrer Taten zu empfinden, weil sie im Namen ihrer Freiheit gekämpft und getötet hatten.
Das war die Lebensweise der Leute in Carapuhr. Eine Art zu leben, die Desiderius und seine Gefährten seit mehr als zwei Jahrzehnten genossen. Doch so sehr sie dieses Leben in Carapuhr auch mochten, Desiderius verspürte schon seit langem nichts Anderes als schmerzliches Heimweh.
Oh ja, er wollte kämpfen. Aber für seine Heimat. Für Wexmells Heimat. Für die Heimat seiner Freunde. Für Heimatland und Volk. Sein Volk. Die Luzianer, von denen nicht mehr viele übrig waren.
Desiderius saß auf seinem Stuhl an der langen Tafel seines Hauses. Melecay und einige seiner engsten Vertrauten, darunter sein Bruder Melvin, saßen ihm gegenüber. Die Feier war ausgelassen, je später es wurde, je größer wurde der Schaden, den die Carapuhrianer im Inneren des bescheidenen Anwesens anrichteten. Satt hingen sie in ihren Stühlen oder lehnte auf dem Tisch, der Dank des Großkönigs großzügig mit Speis und Trank eingedeckt war. Das Innere des Raumes schien zu klein für die Anwesenden, es war kaum möglich, aufzustehen und sich einen Weg zur Tür zu bahnen, um den zuvor getrunkenen Wein gelegentlich wieder loszuwerden.
Es war dennoch gemütlicher als in einer Herberge oder dem vom Drachengestank verpesteten Speisesaal der königlichen Burg. Welch Glück für sie alle, dass das Lager des Aufstandes weit von Melecays Sitz entfernt gelegen war, sonst hätten sie ihr Essen mit den Drachen des Königs teilen müssen. Es hieß mittlerweile, Großkönig Melecay liebte seine Drachen mehr als er seine eigene Männlichkeit liebte. Desiderius – der an einem Stück spitzen Holz nagte, das er benutzt hatte, um die Fleischreste aus den Zähnen zu entfernen – grinste in sich hinein, da er wusste, dass diese Behauptung unmöglich der Wahrheit entsprechen konnte. Er kannte den Großkönig bereits so gut, dass er mit Gewissheit sagen konnte, dass Melecay lieber seine Drachen als sein Gemächt geopfert hätte.
Während der Großkönig – den Titel hatte er sich natürlich großkotzig selbst verliehen – eine maßlos übertriebene Variante ihres Kampfes am Morgen zum Besten gab, und dabei so viel Wein verschüttete, das ihm Luro, der am Ende der Tafel neben Allahad saß, bösartige Blicke zuwarf, weil er am Morgen wieder mit putzen dran war, beobachtete Desiderius seine Ziehtochter Karrah, die ihm gegenüber neben Melvin saß und die Augen verdrehte.
Die wunderschöne Hexe, deren langes Haar in violett schimmernden Wellen auf ihre zierlichen Schultern fiel, machte nie einen Hehl aus ihrer Abneigung gegenüber Melecay. Umso erstaunlicher war, dass sie nicht wieder zurück nach Nohva kommen würde. Desiderius würde seine Ziehtochter, die er wie sein eigen Fleisch und Blut liebte, nicht mit in die Heimat nehmen können. Denn Karrah hatte sich mit Melvin vermählt und erwartete bereits ein Kind von dem Jungen. Sie würde in Carapuhr bleiben. Egal, wie sehr Desiderius dagegen war.
Traurigkeit überkam ihn, obwohl der Zeitpunkt seiner Abreise noch nicht bestimmt war. Einerseits war er froh, dass er sie nicht in den Krieg mitnehmen musste, andererseits verlor er sein einziges Kind.
Wexmells Arm lag auf Desiderius‘ Stuhllehne. Der Kronprinz Nohvas lehnte sich zu Desiderius, als habe er dessen Gedanken erraten, und schmiegte sich an dessen Seite.
»Die Hauptsache ist doch, dass sie glücklich ist«, flüsterte Wexmell.
Desiderius brummte, es klang fast nach einer Zustimmung. Jedoch hatte er Melvin von dem Moment an gehasst, als er erfahren hatte, dass er bei Karrah lag. Zum Glück für Melecays Bruder, dessen verbrannte Seite seines Gesichts zu Desiderius zeigte, während er Melecays Erzählungen lauschte, konnte Wexmell Desiderius davon abhalten, ihm den Kopf abzuschlagen. Desiderius durfte niemals daran denken, was dieser Kerl mit seinem kleinen Mädchen machte, wenn sie beieinanderlagen, sonst würde er ihn mit bloßen Händen in Stücke reißen.
Doch so war das gar nicht. Wenn überhaupt verhielt es sich wohl eher genau anders herum, denn Karrah war älter als Melvin. Genau betrachtet – und wenn man sich daran erinnerte, wonach Hexen strebten – hatte vermutlich Karrah den Jungen verführt, um an das Erbgut seiner Lenden zu gelangen. Sie würde Melvin einen Thronerben schenken, der vielleicht Magie und sogar Drachen beherrschen konnte. Einen Thronerben, der ihr Sohn war und den sie aufgrund dessen beeinflussen konnte.
Doch als Vater sah Desiderius nur einen Mann, der seine Tochter entweihte.
Wexmell lachte dunkel in sich hinein, ein wundervoll kehliger Laut, der tief in Desiderius‘ Inneren vibrierte und sein Herz streichelte. »Du bist so unwiderstehlich, wenn du schmollst.«
Desiderius schielte ihn genervt an, doch davon ließ sich der Prinz nicht beeindrucken. Schmunzelnd beugte er sich vor und stupste Desiderius‘ Wange mit seiner vorwitzig nach oben zeigenden Nasenspitze an, was Desiderius zu einem dämlichen Grinsen veranlasste.
Sie waren schon solange Gefährten, und noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Er könnte sich gar nicht vorstellen, auch nur noch einen Tag ohne seinen Prinzen zu leben. Weshalb es für ihn völlig unverständlich war, dass sich viele Männer über lange Beziehungen beschwerten. Wexmells und seine Liebe wurde durch die Jahre ihrer Gemeinschaft nicht geschmälert, sie wuchs mit jedem Tag. Der Gedanke ließ ihn beruhigt lächeln. Was auch immer auf sie zukommen mochte, er wusste, sie würden es durchstehen, solange sie nur zusammen waren. Und nicht einmal die Götter wären fähig, sie zu trennen!
Doch als Desiderius‘ Augen Melecays Gestalt streiften, verdüsterte sich sein Blick.
»Ich werde mit ihm reden, Wex«, beschloss er ernst und sah Wexmell in die Augen. Es lag eine Entschuldigung in seinem Blick, als er fortfuhr: »Wir können nicht noch länger warten.«
In Wexmells Augen trat tiefes Bedauern, doch er nickte zustimmend. »Ich weiß. Dein Heimweh zerfrisst dich. Auch wenn ich wünschte, wir könnten für hierbleiben und in Frieden leben, wir müssen zurück, bevor ich dich verliere.«
»Du weißt, das ist absurd.« Desiderius drehte sich zu Wexmell um und umfasste dessen sanfte Gesichtszüge mit beiden Händen, sein Griff war zärtlich, ebenso seine Daumen, die über die hohen Wangenknochen strichen. »Du bist alles, was ich brauche. Und wenn du nicht wärst, hätte ich keine Ziele.« Schließlich wollte er auch für Wexmell zurück.
Wexmell lächelte traurig. »Versprich mir nur eines, wenn es losgeht.«
»Alles!«
Wexmell sah für einen Augenblick zu Boden, ehe seine eisblauen Augen wieder Desiderius fixierten. »Sollten wir wiedererwarten Erfolg haben, dann verlass mich nicht, egal, was passiert.«
Desiderius musste über ihn schmunzeln. »Wex … nach mehr als zwanzig Jahren könnte ich doch gar nicht mehr ohne dich leben. Wie kommst du nur darauf?«
»Du hast immer durchblicken lassen, dass du dir zu stolz bist, um der Geliebte des Königs zu sein.«
Desiderius zuckte mit seinen massigen Schultern. »Stolz ist etwas, das man im Laufe der Zeit verlieren kann.«
Wexmell lachte ob des Scherzes auf.
»Lass uns nicht darüber sprechen, was passiert, sollten wir Erfolg haben, Wex«, sagte Desiderius ernst, »lass uns darüber sprechen, wie wir Erfolg haben können. Immerhin haben wir eine Pflicht gegenüber jenen, die unsere Hilfe brauchen. Das liegt doch nur in deinem Interesse, oder etwa nicht?«
Wexmell runzelte traurig die Stirn. »Ja. Aber nach all der Zeit hier, da frage ich mich allmählich, warum es ausgerechnet unsere Pflicht ist.«
Desiderius ließ die Hände fallen und nahm dafür Wexmells Finger in seine. »Keine Ahnung. Zufall?«
Wexmell machte diese Antwort nicht glücklich.
»Es ist doch so«, erklärte Desiderius, »irgendjemand muss versuchen, etwas zu verändern. Wenn wir alle nur an uns denken und nichts unternehmen, egal was, dann wird die Welt sich nie verbessern. Ich für meinen Teil möchte meine Heimat und mein Volk in Freiheit sehen. Und dafür möchte ich kämpfen. Es ist das, wofür ich lebe. Ob andere meine Beweggründe gut finden oder nicht ist mir gleich. Denn ich könnte nicht mit mir leben, wenn ich einfach gar nichts tue, nur weil wir hier einen Platz zum Leben und Lieben gefunden haben. Ich möchte, dass auch Nohva diese Freiheit schmeckt.«
Wexmell lächelte, doch es erreichte seine Augen nur halb.
»Wex, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist – also bei deiner Liebe zu mir – das, was auch immer geschehen mag, ich nicht von deiner Seite weiche. Ob du nun König bist – oder nicht.« Er lächelte und fuhr mit einem Daumen über Wexmells Lippen, eher er ihm leise zu hauchte: »Du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir. Bis in alle Ewigkeit.«
Wexmell begann losgelöst zu lächeln und umschlang Desiderius‘ Nacken mit beiden Armen. Sie küssten sich innig und voller Liebe.
Desiderius würde eines sehr vermissen, die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich in Carapuhr lieben durften.
»Ich begleite euch ein Stück des Weges«, beschloss Desiderius.
»Zu freundlich!«, lallte Melecay und schlug ihm beim Verlassen des Hauses auf die Schulter.
Desiderius schüttelte grinsend den Kopf. »Einer muss ja dafür sorgen, dass du nicht vom Pferd fällst!«
»Wir könnten ihm ein Seil um den Fuß binden und hinter den Pferden herziehen«, schlug Karrah vor und folgte mit Melvin dem Großkönig, der sich von einer Leibwache auf sein silbergraues Pferd helfen ließ.
Bevor Desiderius folgen konnte, legte ihm Wexmell von hinten eine Hand auf die Schulter.
Noch einmal drehte Desiderius sich zu seinem Geliebten um und konnte sich kaum überwinden, dem funkelnden Ausdruck in dessen eisblauen Augen zu wiederstehen, den Wexmell immer bekam, wenn er zu viel Bier und Wein getrunken hatte.
»Beeil dich«, bat Wexmell und schmunzelte mokant, »dein Bett erwartet dich.«
»Wärme es für mich vor, unbekleidet und willig, und ich kehre schnell zurück um in deine Arme zu sinken«, versprach Desiderius und küsste ihn noch einmal. Dann warf er sich seinen dicken Wollumhang um die Schultern und trat hinaus ins Freie, wo Wanderer schon auf ihn wartete.
Am Ende eines langen Waldweges verabschiedeten sie sich. Sie stiegen von den Pferden und drückten sich die Handgelenke.
»Pass mir gut auf sie auf«, warnte Desiderius, als er sich von Melvin verabschiedete.
Wie immer nickte der jüngere Mann ein kleinwenig eingeschüchtert.
Als er sich von Karrah verabschiedete, nahm er sie in den Arm und fragte leise in ihr Ohr: »Hast du was von Zazar gehört?«
Doch Karrah schüttelte den Kopf.
Desiderius versuchte, seine Trauer über seinen seit Monaten verschollenen Bruder zu verbergen und löste sich von seiner Ziehtochter.
Er legte ihr eine Hand auf den aufgedunsenen Bauch, der sich deutlich unter ihrem schwarzen Kleid abzeichnete. »Wenn er raus will, möchte ich dabei sein.«
Sie lächelte nur, sagte aber nichts dazu.
Plötzlich fiel ihr etwas ein. »Oh, warte!« Sie durchsuchte ihre dunkelroten Gewänder. »Hier, nimm das an dich.«
Zögerlich nahm Desiderius das kleine Buch in die Hand, das sie ihm reichte, und drehte es herum. Seine Augenbrauen schnellten nach oben. »Melecays Tagebuch?«
Sie nahm es ihm wieder ab, um es ihm unter die Kleidung zu schieben, wo es genau über dem Herzen stecken blieb. Karrah klopfte darauf und sah traurig zu ihm auf. »Trag es an deinem Herzen, vielleicht schützt es dich vor einem Pfeil.«
»Wie kommst du da ran?«, fragte er verwirrt.
Sie zwinkerte frech. »Ich habe es gestohlen. Er wird es nicht vermissen.«
»Du musst es ja wissen«, schmunzelte er. Immerhin konnte sie gelegentlich mehr sehen, als alle anderen.
»Wieso ausgerechnet dieses Buch?«
In Karrahs Blick lag etwas tief Trauriges, als sie zu ihm aufsah. »Du wirst es brauchen, Vater.«
Stutzig geworden runzelte er die Stirn.
»Ich weiß nicht viel«, gestand sie nervös, noch immer lag ihre Hand auf dem Buch und über seinem Herzen. »Ich habe von dir geträumt. Du standst auf einem Berg im Abendrot und hattest das Buch in der Hand. Dreck und Blut hafteten dir an, wie nach einem schweren Kampf. Dein Gesicht war eine Maske des Grauens. Ich weiß nicht, was es bedeutet.«
Es behagte ihm nicht, dass sie von ihm geträumt hatte. Karrahs Träume bedeuten nie eine harmlose Wendung. Er nickte und vertraute auf sie.
Noch einmal umarmten sie sich, und er sagte ihr, dass er sie liebte. Dann ließ er sie los und hatte das bedauernde Gefühl, sie für eine lange Zeit nicht mehr wiederzusehen.
Schließlich trat er zu Melecay. Sie führten ihre Pferde noch ein kleines Stück den Weg entlang.
Nach kurzem Schweigen brachte Desiderius den Mut auf, den anderen Mann um etwas zu bitten. »Melecay, ich brauche ein Schiff.«
Melecay nickte. »Ich habe mich schon gefragt, wann es endlich soweit ist.«
»Wexmell möchte nicht, dass ihr uns begleitet, aber …«
»Ich werde eine Armee bereitstellen, falls ihr Hilfe benötigt, doch ich dränge trotzdem darauf, euch begleiten zu dürfen.«
»Ich muss Wexmell leider zustimmen«, gestand Desiderius und blieb stehen. »Nohva ist nicht Carapuhr. Und wenn wir mit einer Barbarenarmee einfallen, könnten die Völker Angst bekommen. Das wollen wir jedoch vermeiden. Wexmell will so wenig Blut vergießen, wie möglich. Und – tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber – du bist nicht gerade für deine Zurückhaltung bekannt. Ebenso wenig wie deine Männer.«
»Mit Diplomatie wird Wexmell König Rahff nicht dazu bringen, abzutreten«, warf Melecay belustigt ein.
»Mittlerweile ist viel Zeit vergangen, und Gerüchten zu Folge hat Rahff wegen der Tyrannei seiner Kirche viele Anhänger verloren. Wir wollen versuchen, ihn damit in die Enge zu treiben, indem wir den Großteil unserer Völker auf Wexmells Seite ziehen. Das gelingt uns besser, wenn wir ohne eine beängstigte Zahl Fremder anreisen.«
Melecay betrachtete ihn für einen Moment, dabei war ihm deutlich anzusehen, dass er nicht an ihren Plan glaubte.
»Außerdem möchte ich nicht warten, bis ihr genug Schiffe für eine Flotte gebaut habt. Wenn Rahff stirbt, bevor wir zurückkehren, könnte man uns Feigheit vorwerfen. Und den Weg über Elkanasai will ich nicht gehen. Wie ich dir bereits mehrfach sagte, werde ich erst mit dir über einen Einmarsch ins Kaiserreich sprechen, wenn wir Nohva zurückerobert haben.«
Wie jedes Mal enttäuschte das Melecay. Er sah in den Wald hinein, der den Weg einzäunte, und sagte murmelnd: »Das Kaiserreich ist ein großes Imperium und ein mächtiger Gegner, den ich noch immer fürchte. Ich brauche einen Mann auf dem Thron des Kaisers, dem ich vertraue. Und davon gibt es nur noch wenige.«
»Wir finden eine Lösung. Aber nicht jetzt.«
Melecay nickte einverstanden, er wusste, wie sehr das Herz eines Mannes an seiner Heimat hängen konnte. »Also gut. Solange meine Heimat nicht bedroht wird, kann ich geduldig sein. Aber was, wenn ich dir sage, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ohne Schiffe nach Nohva zu gelangen? Und ohne über Elkanasai zu reisen?« Er grinste verschwörerisch. »Dürfte ich euch dann begleiten? Und sei es nur ich und ein kleiner Trupp, um meine Verbundenheit zu euch zu demonstrieren? «
Desiderius wurde stutzig. Die kalte Herbstluft wehte durch sein Haar, als er neugierig darauf wartete, dass Melecay erklärte, was ihm vorschwebte.
»Es gibt ein Portal unterhalb Carapuhrs, in alten Bergruinen«, platzte Melecay heraus.
Desiderius verstand kein Wort und schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht …?«
»Wir fanden Hinweise darauf in alten Schriften. Laut einigen Überlieferungen gibt es Portale, die die Kontinente unserer Welt miteinander verbinden. Sie werden von deinem Volk Götterportale genannt. Laut einer Legende, soll der Eroberer Carapuhrs sie entdeckt und genutzt haben, um Truppen gegen die Spitzohren schneller in das Land zu schleusen. Er kam nie über das Meer, wie viele glaubten. Er nutzte die Portale. Er war ein gerissener Lügner.«
»Wie kann das möglich sein?«
Melecay zuckte mit den Schultern. »Die Schriften sprachen von alten Zauberern und Hexen, die diese Portale genutzt haben, um schneller reisen zu können. Eine uralte Magie, deren Verständnis im Laufe der Zeit verloren ging. Seit mehreren Jahrtausenden stehen sie still. Doch es soll Schlüssel geben. Wir sind dabei, herauszufinden, ob wir das Portal mit Hexenkraft öffnen können.«
»Ihr habt danach gesucht und wirklich eines gefunden?«, hakte Desiderius ungläubig nach. Ihm wollte das alles noch nicht so richtig in den Kopf.
»Ja. Jedoch …« Melecay sah zu Boden, er wirkte nicht, als wollte er aussprechen, was er angefangen hatte.
»Was?«, drängte Desiderius.
»Den Schriften zu folge, befindet sich der letzte existierende Schlüssel in Nohva«, erklärte Melecay. »Gut möglich, dass eure Feinde durch das Portal kommen können, noch bevor wir herausgefunden haben, wie wir hindurch können.«
Desiderius‘ Gedanken überschlugen sich, als er nach Hause ritt.
Portal oder Schiff?
Es wäre natürlich viel vorteilhafter, durch ein Portal zu schreiten und direkt in Nohva aufzukreuzen, ohne eine gefährliche Seefahrt unternehmen zu müssen. Andererseits wusste niemand, ob das Portal überhaupt in naher Zukunft geöffnet werden konnte, und wenn, wohin es genau führte. Magie war niemals einfach und Magie fürchtete er nach wie vor. Er wollte kein Portal benutzen, ohne zuvor Bellzazar um Rat zu fragen.
Doch sein Bruder erhörte keinen seiner Rufe, und Desiderius spürte ihn auch nicht mehr. Nicht nur sein Heimweh war es, das ihm zusetzte und was Wexmell in den letzten Monaten zu spüren bekommen hatte, es war auch seine Sorge um seinen Bruder. Desiderius fürchtete, Bellzazar könnte etwas Schlimmes zugestoßen sein. Und zwar in einer Welt, in die er ihm nicht folgen konnte.
Und dann hatte Nohva auch noch den Schlüssel zu diesem Portal? Das war alles andere als vorteilhaft. Spione könnten schon in Carapuhr sein. Oder noch schlimmer: Meuchelmörder. Das einzige, das ihn nicht in Panik geraten ließ, war das Wissen, das Wexmell für tot gehalten wurde, und ihm dadurch kaum Gefahr drohte.
Doch all das geriet vollkommen in Vergessenheit, als er am Haus ankam.
Etwas stimmte nicht.
Die Tür stand offen. Der Duft von Wein und halb verspeisten Braten drang nach draußen in die kühle Luft. Die Pferde irrten umher, jemand hatte die Ställe offengelassen.
Mit einem Ziehen im Magen glitt Desiderius aus dem Sattel und klopfte beruhigend Wanderers Hals ab, als der Hengst nervös den Kopf hochwarf.
»Wex?«, rief Desiderius halblaut und schlich langsam auf die Stufen zu, die hinauf zur Tür führten. »Luro? Allahad?«
Niemand antwortete ihm.
Etwas auf den Stufen glänzte dunkel. Ein Teil von ihm hoffte, es sei verschütteter Wein, doch als er nähertrat, konnte er das Rot auf den Stufen nicht mehr mit etwas anderem verwechseln. Es war eine Schleifspur aus Blut.
Sofort machte sein Herz einen Satz. Er sprang die Stufen hinauf, ungeachtet der Tatsache, dass er fast ausrutschte, und stolperte ins Innere.
»Wex!«, rief er, doch sein Ruf erstickte in einem Aufschrei.
Die Bodendielen waren blutgetränkt, Lachen aus roten Pfützen bildeten sich unter am Boden liegenden Körpern, die sich nicht bewegten. Schwerter lagen herum. Schwerter, die zu spät und in purer Verzweiflung ergriffen worden waren. Leichen von vermummten Männern lagen herum, sie trugen ein Symbol auf der Brust, das Desiderius nicht fremd war. Eine halbe Sonne und ein halber Sichelmond. Das Symbol der Kirche Nohvas.
Allahad und Luro lagen regungslos am Boden, dunkles Blut floss aus ihren zahlreichen Wunden, ihre Augen waren geschlossen, sie atmeten nicht mehr … Kälte erfasste Desiderius` Herz. Er war beinahe zu gelähmt, um zu begreifen. Das konnte nur ein Alptraum sein …
Hastig suchten Desiderius‘ Augen den Boden ab, bis er … »Wex!«
Wexmell lag mit dem Gesicht nach unten im eigenem Blut. Sein Brustkorb war still, er atmete nicht mehr, und sein schönes, goldgelocktes Haar war rotgefärbt. Frisches Blut sickerte aus einer großen Kopfwunde.
Desiderius stolperte über die Leichen auf ihn zu. Doch bevor er bei seinem Prinzen angelangen konnte, spürte er eine Bewegung hinter sich.
Er wirbelte erschrocken herum.
»Haben wir dich!«
Das letzte, was er sah, bevor der Schwertknauf sein Gesicht traf, war das Wappenzeichen mit dem aufsteigenden, schwarzen Hengst auf der Brust eines gepanzerten Ritters.
1
Teil 1: Tod den Sündern
»Welcher Sterbliche von sich glaubt, den Willen eines Gottes zu kennen, und in seinem Namen Sünder zu ernennen, um sie aus reiner Mordlust zu töten, begeht das schwerste Verbrechen gegen die Göttlichkeit, weil er sich somit selbst zu einem Gott ernennt.«
Auszug aus einer Mitschrift einer Rede des ersten wahren Königs von Nohva
Nohva war mit dem düsteren Schatten des Krieges bedeckt.
Wer nach all den Jahren noch immer etwas Anderes behauptete, war blind und taub. Überall auf dem Kontinent war das Land von zahlreichen Schlachten gezeichnet. Unzählige Scheiterhaufen, auf dem die Gefallenen zu tausenden aufgehäuft waren, brannten in jedem Dorf. Jedes noch so kleine Feld hatte mindestens einmal als Schauplatz eines Kampfes gedient. Die vom langen Winter feuchte Erde war blutdurchdrängt. Dämonen gingen umher. Alte und Kinder wurden in die Armeen beordert, und ihre Frauen und Mütter warteten zu Hause darauf, von ihrem Tod zu erfahren – oder die Dörfer waren bereits von Heeren geplündert worden. Vom Krieg blieb niemand verschont, und welcher Mann glaubte, seine Frau und Kinder seien zu Hause sicherer als auf dem Schlachtfeld, der irrte sich. Der irrte sich gewaltig. Ob Feind oder eigene Kameraden, sobald nach einer Schlacht ein Dorf gesichtet wurde, wurden aus angeblich ehrenwerten Kriegern wilde Tiere, die plünderten und vergewaltigten. Ob Mensch oder Tier, ob tot oder lebendig.
Das war Krieg.
Und das würde sich im Krieg nie ändern. Egal, wie viele ehrenwerte Seelen es tatsächlich unter den Soldaten gab, die Kämpfe machten mehr als über dreiviertel der Männer zu abgestumpften Perversen, für die Gewalt und Tod etwas völlig Normales wurde.
Und doch war es schwer ihnen als eigener Kamerad wütend zu sein. Man konnte schockiert sein, man konnte es verachten, man konnte versuchen, sie aufzuhalten, aber man konnte sie auch zu einem gewissen Teil verstehen, wenn man selbst die Hölle des Krieges gesehen hatte. Es war purer Zufall – vielleicht war es auch Glück – wenn man selbst nicht völlig kalt und herzlos wurde, trotz der Dinge, die man gesehen hatte und nie wieder vergessen konnte.
Cohen spürte den milden Wind des Frühlings im Haar. Die Luft schmeckte salzig, weil sie vom Meer her geweht kam. Unter ihm erstreckte sich eine gewaltige Wüstenlandschaft, staubiger Sand wurde im Morgenrot aufgewirbelt und verdeckte die halbe Sicht auf die gut verteidigte Tempelanlage, die ihm und seinem Reitertrupp regelrecht zu Füßen lag.
Galia, seine wunderschöne Stute, bewegte ihr Gewicht von einem Huf auf den anderen. Sie strahlte eine bemerkenswerte Ruhe aus, die sich auf ihn übertrug. Pferd und Reiter vertrauten einander wie Mutter und Kind es täten. Und das war für seinen Aufgabenbereich auch unabdingbar.
Einige Männer schworen auf Hengste, weil sie furchtlos und unbändig in die Schlacht ritten. Doch da verschätzten sich viele Reiter, denn das Wesen eines Tieres war – ebenso wie bei Zweibeinern – nie an sein Geschlecht gebunden. Galia war mit Abstand das stärkste, schönste und vor allem auch mutigste Kriegspferd, das je in Nohva geboren worden war. Jedenfalls für Cohen.
Er schloss für einen kurzen Moment die Augen und genoss den Kuss des Frühlings im Gesicht. Noch immer war es kalt von der sternenklaren Nacht, selbst am Rand der Wüste. Der Winter im Süden war noch nicht gänzlich vergangen, da begann im Westen schon die erste Schlacht.
Es waren relativ ereignislose Wintermonate gewesen, da alle Seiten des Krieges in der kalten Jahreszeit zu wenig Ressourcen hatten, um Krieg zu führen. Hin und wieder hatten die Rebellen einen Lord angegriffen, und die königlichen Truppen hatten versucht, den betroffenen Adeligen zu verteidigen. Doch im Vergleich zu den Schlachten, die sie über den Sommer und den Herbst mit dem Wüstenvolk geführt hatten, waren die Kämpfe gegen die Rebellen nichts weiter als harmlose Dispute gewesen.
Die Rebellen waren zwar eine mittlerweile beängstigt große Gruppe geworden, jedoch ohne Vorräte und mit schwindendgeringen Waffen und Rüstungen. Der größte Krieg spielte sich zwischen König Rahffs Truppen und dem völlig außer Kontrolle geratenem Wüstenvolk ab, das von ihren Feinden nur noch »Goldis« genannt wurde. Und das nicht nur wegen ihrer bronzefarbenen Haut, sondern vielmehr wegen den erst vor einigen Jahren entdeckten Golderzadern unterhalb der Wüste.
Gold war mehr wert als Silber, doch Cohens Glaube verbot Gold als Zahlungsmittel, da Gold in seinem Glauben allein den Göttern gehörte. Cohens Glaubensbrüder errichteten Kirchen und heilige Schreine aus Gold, opferten Gold, indem sie es in Truhen verschanzten und an heiligen Stätten für die Götter vergruben, in voller Hoffnung, so die Gunst der heiligen Wesen zu erlangen.
Doch die Goldis glaubten nicht an Götter. Sie beteten nur zu einem Gott. Einem Gott, der noch grausamer sein konnte als Cohens eigene Götter.
Sie waren bereit gewesen, das Gold für den König abzuschürfen und es zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, so wie es ihr gutgegebenes Recht gewesen wäre, immerhin gehörten diese Minen ihnen. Aber ihr Vorschlag wurde abgelehnt.
Wie dem auch sei. Das Gold war der eigentliche Grund, weshalb Lord Schavellen – Lord von Dargard – Krieg beginnen wollte. Natürlich im Namen der Götter. Und auch König Rahff war ebenso erpicht darauf, die Minen für sich zu beanspruchen, doch einem Krieg hätte er rein aus finanzieller Sicht wohl kaum zugestimmt, wenn ihn Lord Schavellen und sein sadistischer Sohn nicht dazu erpresst hätten. Wie so oft hatte sich der König Nohvas von den Anhängern der Kirche unterdrücken lassen, weil seine Herrschaft davon abhing, dass er von den Gläubigen unterstützt wurde.
Cohen konnte all das überhaupt nicht verstehen, von Politik hatte er ohnehin keine Ahnung. Aber er sah mehr als die hohen Köpfe, die im Hintergrund die Fäden zogen. Er war ein Krieger mitten in den Schlachten, und er, als einfacherer Soldat, wusste mehr als jeder Adelige, dass es den Männern und Frauen der Völker nicht um Gold ging. Nein, das alles hier, der gesamte Krieg – zusätzlich zum Aufstand der Rebellen – war in einen heiligen Krieg ausgeartet. Götter gegen einen Gott. Religion gegen Religion. Ein Glaube gegen einen anderen. Am Rande des Krieges kämpften die Rebellen für etwas Freiheit, die sie wohl nie erlangen würden, und die großen Heere schlugen sich gegenseitig die Köpfe ab, während die Götter, für deren Rechte sie töteten, vermutlich gar nicht mehr existierten.
Cohen war einst ein Mann gewesen, der ohne nachzufragen alles im Namen der Götter getan hätte. Er war sehr gläubig gewesen, obwohl sein eigener Glaube ihn unterdrückte. Er war nur ein Bastard, und als Bastard war man in den Augen seiner Götter nichts wert, also hatte er nie zu etwas Höherem aufsteigen können als zu dem, was er heute war. Er durfte einen kleinen Reitertrupp anführen, aber nur, weil er des Königs Bastard war, und nur, weil die Männer, die ihm unterstanden, ebenfalls Bastarde waren.
Sie waren die Schandflecke ihres Volkes, und doch waren sie es, die immer wieder ihr Leben zum Schutze jener riskierten, von denen sie verurteilt wurden.
Wie gesagt, Cohen war ein gläubiger Mann gewesen. Nicht einmal der Umstand, dass er niemals die Truppen seines Vaters anführen würde – wie der König es ihm als Kind stets versprochen, aber nie eingehalten hatte – hatte daran etwas ändern können. Doch nun, nach dem Winter und nur wenige Augenblicke vor einer weiteren Schlacht, musste Cohen sich eingestehen, dass er in seinem Glauben erschüttert worden war.
Denn der Glaube an die Götter war schuld, dass er vor wenigen Monaten seinen letzten noch verbliebenen Bruder verloren hatte. Einen Bruder, den er mehr geliebt hatte, als sein eigenes verfluchtes Leben.
Cohen spürte Solrans Blick auf sich. Der Reiter war viele Jahre älter als Cohen und hätte es verdient, an Cohens Stelle zu stehen. Aber wie gesagt, Cohen war der Befehlshaber, weil er nicht irgendein Bastard war, sondern des Königs Bastard.
Zu irgendwas musste dieser winzige Unterschied ja gut sein.
Cohen wandte seinem Kameraden nicht das Gesicht zu, er starrte weiter hinab auf die Tempelanlage, nur seine düsteren Gedanken lichteten sich etwas.
Es war Zeit, sich zu konzentrieren, es stand ein Kampf bevor.
Solran betrachtete Cohen noch eine ganze Weile nachdenklich, erst dann richtete er seinen Blick ebenfalls auf die Tempelanlage und betrachtete die aus weißem Stein gefertigten Türme, deren Spitzen im Morgenrot golden schimmerten.
»Wofür kämpfen wir eigentlich?«, flüsterte Solran in die milde Morgenluft. »Für Lords, die Bastarde und Frauen unterdrücken? Für eine Heimat, die von Ausbeutung gekennzeichnet ist? Kämpfen und sterben wir für Männer, die uns gar nicht wahrnehmen?«
Cohens Lippen öffneten sich unwillkürlich, weil seine Brust und Kehle bei diesen Fragen so eng wurden, dass er zu ersticken glaubte.
Ihm wurde von seinen Männern in letzter Zeit oft diese Fragen gestellt, als spürten sie, dass er ihnen nach dem Tod seines letzten Bruders näher war denn je.
Denn vor Sevkins Ermordung – und für Cohen war es nichts als Mord gewesen – waren sie gegenüber Cohen eher distanziert gewesen, nach dem Winter jedoch waren ihre Blicke und Worte voller Respekt gegenüber ihrem Kommandanten.
Früher hatten sie ohne ihn getrunken und getuschelt, und wenn er in ihre Nähe gekommen war, waren sie verstummt und hatten sich vielsagende Blicke zugeworfen. Ganz nach dem Motto: »Er ist des Königs Bastard, sagt bloß nichts Falsches!«
Als Cohen nach einem längeren Aufenthalt in seinen Gemächern – angeblich musste er sich von einer schlimmen Verletzung erholen – wieder freigelassen wurde, hatte sich seine ganze Welt verändert. Und auch seine Männer. Denn sie wussten, dass er in keiner Schlacht verletzt worden war. Sie ahnten, dass er unfreiwillig weggesperrt worden war. Sicher fragten sie sich, was im Winter in der königlichen Burg tatsächlich geschehen war, aber keiner drängte danach, es von ihm bestätigt zu bekommen.
Fakt war, ihr Kommandant wusste selbst nicht mehr, wohin er gehörte, und das war ihre Chance, ihn an ihren Gedanken teilhaben zu lassen.
Wie immer konnte Cohen die Frage darüber, wofür sie heute kämpften, nur mit einer lieblosen Erwiderung beantworten, die ihm sein Vater eingefleischt hatte.
»Wir kämpfen für unsere Heimat. Für die Ehre und den Ruhm unseres Königs«, murmelte er gedankenverloren.
Er liebte seinen Vater, er schätzte ihn wie keinen anderen Mann. Ihre Verbindung war stark, ihr Verhältnis war einmalig und lobenswert. Cohen mochte nur die Hintermänner nicht, die seinen Vater erpressten.
Warum, verflucht noch mal, hatte er nicht den Tod seines letzten Erben verhindert?
Cohen schloss die Augen und versuchte, jetzt nicht an Sevkin zu denken, oder daran, wie er auf den verlassenen Platz getreten war, mutterseelenallein, über verfaultes Obst und Dreck gestolpert war, um auf den Galgen zu klettern und den Körper seines Bruders loszuschneiden. Er wusste noch, wie angeschwollen und blau Sevkins feine Gesichtszüge gewesen waren, und wie ihm die dicke Zunge aus dem lieblichen Mund gequollen war, als wäre sie ein Fremdkörper und könnte unmöglich zu ihm gehören.
Seine Erinnerung daran wurde brüsk unterbrochen, als die ersten Soldaten über die Sandhügel rannten und auf die Tempelanlage zusteuerten, kurz darauf waren die Warnrufe von Dienerinnen zu hören. Die Fußtruppen machten den ersten Vorstoß, nach ihnen brachten einige Soldaten einen Rammbock, um die massiven Tore der Mauern aufzustoßen, damit sie ungehindert in den Tempel eindringen konnten.
Cohen und seine Männer waren erst dann gefragt, wenn wiedererwarten Soldaten in der Tempelanlage versteckt waren.
Ja, dafür waren sie gut. Nicht auszudenken, die Soldaten des Lords von Dargard würden mal einen feindlichen Soldaten gegenübertreten müssen, statt unschuldige Zivilisten zu ermorden, dachte Cohen zynisch.
»Wir brauchen Rüstungen und neue Waffen für den Frühling«, hatte Lord Schavellen dem König vorgetragen. »Uns fehlen Ressourcen, wir haben keine Wahl, wir müssen uns finanzielle Mittel beschaffen.«
Kriegsbeute nennen sie es. Cohen nannte es Plündern. Wenn man im Krieg eine bedeutende Stadt des Feindes erobert, sie einnimmt und dann die darin befindlichen Güter für die eigenen Armeen verwendet, war dies unabdingbar. Doch einen ungeschützten Tempel auszurauben und die Heiligtümer zu stehlen war ein Kriegsverbrechen in Cohens Augen. Zumal sie damit nur noch mehr die Wüstenbevölkerung gegen sich aufbrachten.
Solran betrachtete das Gemetzel innerhalb der Tempelanlage, als die ersten Soldaten der Ebenen durchbrachen und die ersten qualvollen Schreie der Unschuldigen laut wurden. Er schüttelte leicht den Kopf voller innerlicher Abscheu, dabei wackelte sein grauer Haarschopf.
»Ja«, flüsterte Solran in die Morgenröte hinein, »für Ehre und Ruhm unseres Königs …«
»Was hat das noch mit Ehre zu tun?«, ließ Arrav verlauten. Er war ein grimmiger Geselle, groß und schlank – zu groß für seinen kleinen weißen Hengst – dessen dunkles Haar in Wellen auf seine Schultern fiel.
Als Cohen sich im Sattel mit nachdenklichem Blick zu ihm umwandte, schnitt er gerade in aller Seelenruhe mit einem Dolch ein Stück von einem hellgrünen Apfel ab und schob es sich in den Mund.
Arrav hatte keine Probleme damit, zu töten, er war Cohen immer sehr kaltherzig erschienen, doch nachdem sie in den letzten vier Jahren zusammen zu Felde gezogen waren, wusste Cohen, das Arrav nicht kalt, sondern nur abgestumpft war. Arrav kannte den Unterschied zwischen Töten und Morden. Etwas, das die Soldaten unterhalb dieses Sandhügels vergessen hatten.
Cohen sah sich weiter nach seinen Männern um. Es waren fünf, die ihm unterstanden. Solran, der mehr ein Mentor als ein Untergebener war. Arrav, der im Herzen mehr wie ein kalter Meuchelmörder aber ein treuer Gefährte war. Iksbir, der ein erstaunlich diplomatisches Gespür besaß. Ugrath, Iksbirs jüngerer Bruder, der vom Töten eigentlich nichts hielt und nur kämpfte, weil er dazu gezwungen war. Und schließlich Misa, der so jung war, dass er in Frauenkleider locker mit einem Mädchen zu verwechseln wäre. Nicht einmal in den Stimmbruch war der Junge gekommen, bevor er in die Armee gesteckt wurde.
Fünf, von ursprünglich sechzig Mann. Sie waren nur noch fünf …
Eigentlich vier, denn der fünfte im Bunde, Misa, war in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Ein Junge im Alter von gerademal zwölf Sommern, der am Abend zuvor noch große Reden geschwungen hatte, welch guter Reiter und Kämpfer er wäre, und der nun, so kurz vor der Schlacht, wie ein nasser Sack im Sattel hing und blass um die zierliche Nase wurde.
Während der Junge voller Angst das Plündern betrachtete, sahen die anderen vier Cohen entschlossen entgegen. Ja, sie verabscheuten, was dort unten geschah, aber sie würden kämpfen. Weil sie ihn nach all den Jahren als Kommandanten respektierten, so wie er sie respektierte. Der Krieg hatte sie zu Brüdern gemacht, ihre Lebensumstände verbanden sie alle miteinander. Sie wussten, dass er der beste Reiter in ganz Nohva war, und sie vertrauten auf seine Fähigkeiten. Außerdem würde der König sie allesamt hinrichten lassen, wenn sie Cohens Befehlen nicht gehorchten.
Doch was anfangs der Grund für ihr Folgen war, war heute bereits vergessen. Sie ritten an Cohens Seite, weil er sich vor ihnen bewiesen hatte. Und er wollte sie jetzt nicht enttäuschen.
Voller Unbehagen blickte er wieder hinab und sah zu, wie Blut und Tod den hübschen Tempel besudelte. Auf den weißen Stufen, die zum Heiligtum hinaufführten, lagen eine Handvoll verstreuter Leichen, kein Soldat war unter ihnen. Einige Priester und Dienerinnen schafften es aus der Tempelanlage und flohen in die unerbittliche Weite der Wüste. Cohen hatte den Befehl, jeden Flüchtigen abzufangen und zu töten.
Das war nicht richtig.
Wofür kämpfen wir?
Er wusste es nicht.
Jedenfalls nicht dafür. Nicht, um die reichen Männer noch reicher zu machen. Nicht, um unschuldige Dienerrinnen und Priester abzuschlachten.
Cohen sah all seine gefallenen Kameraden vor sich, so als wäre es erst wenige Augenblick her. Über Fünfzig seiner Männer hatte er verloren, obwohl er für jeden einzelnen von ihnen sein Leben riskiert hatte. Es hatte nichts genützt. Die Götter hatten ihre schützenden Hände nur über ihn, jedoch nie über seine treuen Gefährten gehalten.
Seine Brüder hatte Cohen auch nicht retten können. Raaks, einstiger Kronprinz, starb in der ersten Schlacht gegen die Goldis mitten in den Tiefen Wäldern. Aber nicht durch Feindeshand. Ein Dämon ergriff von Raaks besitz, der Kronprinz war besessen und richtete in seinen eigenen Reihen ein Blutbad an, das sie fast den Sieg kostete. Cohen war gezwungen gewesen, ihn zu töten.
Und Sevkin, sein geliebter Sevkin, so jung und voller Lebensfreude, war seiner eigenen Naivität zum opfergefallen. Und Cohen war nicht dort gewesen, um ihn zu schützen.
Das konnte und würde er sich nie verzeihen. Cohen sah immer wieder Sevkins totes, blaues Gesicht vor sich …
»Nein.« Cohen schüttelte den Kopf und packte die Zügel. »Ich mach da nicht mehr mit!«
Damit riss er Galia herum und ritt unter den ungläubigen Blicken seiner Männer zurück zum Lager. Sie hatten ihn absichtlich provozieren wollen, doch hätten sie nie gedacht, dass er sich gegen den Willen der Kirche stellen würde. Das sah er ihren Blicken an.
Trotz, dass Cohen den König bei allem unterstützen wollte, was dieser entschied, hatte Cohen auch seine eigenen Prinzipien. Und diese konnte er nicht einfach vergessen. Er war kein Mörder und er würde niemals einen Unbewaffneten töten. Das verbot ihm der Eid, den er und seine Männer einst dem Gott der Gnade geleistet hatten. Und nichts konnte einen gläubigen Mann mehr in Furcht versetzen als den Zorn seiner Götter.
***
Auf den eigenen Tod zu warten konnte überaus langweilig werden. Das einzige, was man tun konnte, war abzuschätzen, wie man letztlich sterben würde.
Würde es der Galgen werden? Enthauptung? Was blühte einem Dieb?
Oder kam es erst gar nicht zur Hinrichtung, weil in den Gemäuern des königlichen Kerkers eine Krankheit umging, die nicht nur dazu führte, dass sich über die Hälfte der Gefangenen alle paar Augenblicke übergeben mussten, sondern die letztlich auch sehr rasch zum Tod führte.
Eagle lehnte in seiner Zelle an der hinteren Wand, zu seiner Rechten befanden sich die massiven von Rost überzogenen Gitterstäbe der Nebenzelle.
Als er hierhergekommen war – besser gesagt, als er hier hereingeworfen worden war – hatte er noch eine Zelle für sich allein gehabt. Mittlerweile war der Kerker überfüllt und er teilte sich seinen »Freiraum« nun mit einem Dutzend weiteren Gefangener. Es handelte sich dabei größtenteils um betrunkene Penner, die ihre Ausscheidungen seit Ausbruch der Krankheit nicht mehr bei sich behalten konnten.
Selbst Schweine waren sauberer, die Tiere nutzten nur eine Ecke, und machten nicht einfach dorthin, wo sie sich gerade befanden.
Zugegeben, einige von denen, die mit Egale in der Zelle saßen, waren außer Stande, sich zu bewegen, und konnten nichts dafür. So schwach wie sie waren, würden sie nicht mehr lange durchalten. Und dann wurde es erst richtig unschön, denn die Wachen kamen nur noch selten her, aus Angst vor der Krankheit, also blieben die Toten einige tagelang hier sitzen.
Es gab kaum Essen und wenig zu trinken. Die einzigen, die regelmäßig kamen, waren die Ratten und die gepanzerten Ritter, die Eagles einzigen Gesprächspartner tagein und tagaus aus der Zelle zerrten, ihn folterten, sodass seine qualvollen Schreie durch den gesamten Kerker echoten, und ihn dann wieder zurück in die einzig leere Zelle neben Eagle warfen. Der Mann aus der Nebenzelle war der einzige, der allein blieb. Warum, erriet Eagle nicht, doch er hatte die leise Ahnung, dass die Wachen und Ritter Angst vor dem Mann hatten.
Eagle hingegen hatte keine Angst vor seinem Mitgefangenen, zumal dieser so neben sich stand, dass er nicht einmal seinen eigenen Namen kannte.
Mit einem prüfenden Blick sah Eagle in die Nebenzelle. In der hintersten Ecke saß sein Leidensgenosse, den er liebevoll »Vergessener« nannte, weil niemand ihn zu suchen schien, und verkroch sich in den Schatten. Seine Fußgelenke waren mit schweren Ketten an die Wand gekettet, er trug nur verdreckte und von Folter gezeichnete Leinenunterwäsche, genau wie Eagle. Sie saßen schon viele Monate hier drinnen, hatten den bitterkalten Winter in diesem feuchten Drecksloch gemeinsam überstanden und zugesehen, wie alle anderen starben, als gäbe es im Himmel etwas umsonst. Dementsprechend verlaust sahen Eagle und der Vergessene auch aus. Dichte Bärte – der eine rot, der andere schwarz – und mittlerweile so langes Haar, dass es ihnen über die Ohren gewachsen war.
Was würde er nicht alles für ein Bad geben!
Eines war sicher, er würde die Festung seiner Mutter nie wieder verlassen, sollte ein Wunder geschehen und er zurückkehren. Was aussichtlos erschien. Er würde nie wieder sein Zuhause oder seine Mutter sehen. Nur der Tod würde ihn wieder frei machen.
Er brauchte Ablenkung von seinen traurigen Gedanken.
»Ob deine Freunde heute kommen?«, fragte Eagle über die Geräusche der Sterbende und über das Würgen der Kranken hinweg.
Der Vergessene brummte zurück: »Du hast einen seltsamen Humor, Eagle.«
Eagle schmunzelte in sich hinein. Sie konnten ihm alles nehmen, sein Hab und sein Gut, seine Freiheit, aber nicht seinen Humor.
»Sag ihnen doch einfach, was die hören wollen«, scherzte Eagle. »Ich weiß wirklich nicht, warum du dich so zierst. Sind doch ganz nett, die Burschen.«
Der Schatten verbarg halb das Gesicht des Vergessenen, seine Augen lagen im Dunkeln, aber sein schiefes Schmunzeln war zu erkennen.
»Vielleicht geben sie dir danach einen Becher Wein aus.«
»Aber natürlich. Und dann kleiden sie mich noch schick ein und führen mich noch nett auf ein Bankett des Königs.«
»Wer weiß, kann doch sein?« Eagle zuckte mit den Schultern. »So oft wie sie dich holen, frage ich mich allmählich, was da wirklich hinter verschlossenen Türen vor sich geht.«
Noch immer lag ein Schmunzeln auf dem Gesicht des Vergessenen. Es war sehr selten, dass Eagles Freund so gut bei Laune war, dass er sich zum Lächeln bringen ließ. Für gewöhnlich starrte er nur in die Leere oder saß mit geschlossenen Augen da, ohne je echten Schlaf zu finden. Oft hörte Eagle ihn nachts mit sich selbst flüstern, halb seines Verstandes beraubt, weil er weder wusste, wer er war, noch wie er hier hatte landen können. Ohne Eagle wüsste er nicht einmal, dass er sich in Nohva befand – oder was Nohva überhaupt war – und dass der König, in dessen Kerker sie sich befanden, König Rahff Youri hieß.
Als Eagle den Namen zum ersten Mal erwähnt hatte, da hatte er so etwas wie Erkennen in den Augen seines Freundes wahrgenommen. Doch das kurze Aufblitzen war so schnell wieder erloschen, wie es aufgetaucht war. Und mittlerweile bezweifelte Eagle, dass der Vergessene je wieder sein Gedächtnis zurückerlangen würde.
Es tat ihm leid für seinen Freund. Nicht nur, weil er nie erfahren würde, wer er wirklich war, sondern auch, weil die Wachen ihm nicht glauben wollten, dass er sich an nichts erinnerte. Sie folterten ihn und verlangten Dinge zu erfahren, die den Vergessenen nur umso mehr verwirrten.
Ein Husten ließ Eagle wieder in die Nachbarzelle blicken. Es war ein trockenes, tiefsitzendes Husten. Der Vergessene musste halb umkommen vor Durst. Seit drei Tagen hatten sie keine Wasserrationen mehr bekommen.
»He«, flüsterte Eagle und drängte sich an die Gitterstäbe, er sorgte dafür, dass die anderen Gefangenen nur seinen Rücken sehen konnten. »He, komm her, Vergessener. Nimm das hier.«
Eagle zauberte einen Becher hervor, den er seit Tagen in der Ecke versteckte, die er nie verließ, damit die anderen Gauner nicht sein gut behütetes Wasser austranken. Es war nicht mehr viel, aber er teilte es stets mit seinem Freund aus der Nachbarszelle.
In dem dunklen Kerker, und nach all den von Folter beherrschten Monaten, war die Bindung zwischen den beiden Männern stärker als das Band zwischen Brüdern. Wie bei zwei Soldaten, die einen Krieg gemeinsam durch- und überlebten, war eine Verbindung zwischen ihnen entstanden, die sie nicht zum Ausdruck bringen konnten. Aber sie fühlten es beide. Eine so tiefe Freundschaft, die kein Außenstehender je verstehen könnte.
Der Vergessene streckte einen Arm nach dem Becher aus, seine markanten Gesichtszüge tauchten im hellen Licht auf, das durch ein Gitterfenster in die Zellen fiel. Es war schmutzig und fahl. Die Ketten klirrten, als er Eagle den Becher abnahm und einen winzigen Schluck nahm, weil er Eagle nicht das Wasser austrinken wollte. Dabei gehörte es ohnehin ihnen beiden. Um zu überleben, warfen sie seit Monaten alles zusammen. Wasser, Brot. Alles, was sie gereicht bekamen, horteten sie, statt es wie die anderen gleich gierig zu verspeisen. Mal passte der Vergessene darauf auf – etwa, wenn Eagle sich in eine andere Ecke verzog um sich in einen Eimer zu erleichtern – mal versteckte Eagle das Wasser und Essen in einer winzigen Kuhle in der Wand, gegen die er sich lehnte, wenn der Vergessene wieder abgeführt wurde, um gefoltert zu werden.
In diesem stinkenden, feuchten Drecksloch von einem Kerker, wo Tod und Krankheit zu Hause waren, waren sie einander die einzigen Lichtblicke. Ohne ihre Freundschaft hätte keiner von ihnen solange überlebt. Das wussten sie beide.
Als der Vergessene den Becher zurückgab, bemerkte Eagle nicht zum ersten Mal die seltsamen Narben in dessen Handinnenflächen.
»Woher die wohl stammen?«, murmelte Eagle mit einem Nicken auf die Hände des anderen Mannes. Er verstaute das Wasser wieder hinter dem Rücken. Es war nur noch ein winziger Schluck, und er konnte nur hoffen, dass die Wachen bald wieder Wasser bringen würden.
»Das wüsste ich auch gerne«, erwiderte der Vergessene, während er sich seine Hände ansah, als gehörten sie nicht zu ihm.
Es waren nicht die einzigen Naben, die Eagle aufgefallen waren. Unter dem Leinenhemd, das von den Folterungen nur noch in Fetzen auf dem muskulösen Oberkörper hing, war auch eine verbrannte Schulter und eine wulstige Narbe direkt über dem Herzen zu erkennen.
Eines war Eagle ganz deutlich bewusst, bei dem Vergessenen handelte es sich nicht um einen einfachen Bauern oder einen kleinen Dieb. Nein, Eagle war sich sicher, dass er einen Krieger vor sich hatte. Vielleicht gehörte er den Rebellen an.
Aber wie sollte ein Rebell aus Nohva an das Tagebuch des Großkönigs von Carapuhr herankommen?
Noch immer hatte Eagle das Buch, das bei der Inhaftierung des Vergessenen aus dessen Kleidern gefallen war. In der Hektik an jenem Tag, hatten die Ritter dem Mann nicht alles abgenommen. Erst hatten sie ihn aushungern lassen, bevor sie gekommen waren, um ihn bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Bis dahin hatte Eagle das nasse Tagebuch bereits an sich genommen, gelesen und bewahrte es seitdem unter seinen Achseln auf. Er wusste nicht, ob und wie er dem Vergessenen sagen sollte, dass er etwas von ihm an sich genommen hatte. Eagle wollte seinem Freund im Augenblick nicht noch mehr verwirren. Dieses Buch würde mehr Fragen aufwerfen, als es Antworten geben konnte. Und das konnte er dem Verstand des Vergessenen nicht zumuten.
Außerdem war es ohnehin sinnlos. Es war vorbei. Für sie beide.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, fragte der Vergessene voller Unbehagen; »Was glaubst du, warum sie uns noch nicht hingerichtet haben?«
Bevor Eagle antworten konnte, erhob ein Mann mit schwacher Stimme das Wort. »Der König verbot weitere Hinrichtungen für kurze Zeit.«
Der Mann saß Eagle gegenüber an der Zellentür, nur Lumpen um den abgemagerten Leib geschlungen, graues, kurzes Haar, das von einem kreisrunden Haarausfall zeugte, stand von seinem mit Altersflecken überzogenen Schädel ab.
Er hob den müden Blick, seine Augen waren trüb. »Der letzte seiner legitimen Erben wurde hingerichtet, und der König bat die Bevölkerung um Verständnis, das er Zeit zum Trauern beanspruchte, und in dieser Zeit erst einmal jegliche Hinrichtungen verschoben werden.« Er grinste grimmig. »Aber macht euch keine Hoffnung, diese Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir sind alle todgeweiht.«
Der Vergessene und Eagle senkten die Blicke. Sie wussten beide nichts über die Außenwelt. Nichts über den Krieg, der seit Jahren wütete, sie hörten nur von anderen Gefangenen davon. Der Vergessene konnte sich nicht mehr erinnern, ob er im Krieg gedient hatte, und Eagle war sein Leben lang auf der Festung seiner Mutter von allen Ereignissen in Nohva abgeschnitten gewesen, bis er davongelaufen und hier gelandet war.
Eagle wartete, bis der Alte den Kopf wieder hängen ließ, dann flüsterte er so leise er konnte dem Vergessenen zu: »Unsere einzige Chance zur Flucht, ergibt sich auf dem Weg zum Galgen.«
»Und wie genau soll das aussehen, Eagle?«, fragte der Vergessene hoffnungslos.
Wenn Eagle das wüsste, würde ihn die entsetzliche Angst vor seiner Hinrichtung nicht mehr den Schlaf rauben. »Ich … weiß es nicht.«
Es stimmte, sie waren todgeweiht.
2
Etwas mehr als zwei Wochen nach seiner Befehlsverweigerung, kehrte Cohen mit seinen treuen Gefährten zur königlichen Burg zurück. Er fühlte sich wie der größte Versager und teilte keineswegs die große Begeisterung über seine »Gute Tat«, so wie seine Männer.
Er hatte einen Befehl verweigert, schlimmer noch, er hatte das »Schlachtfeld« einfach verlassen und seine Verbündeten im Stich gelassen. Mal davon abgesehen, dass er damit seinen Eid gehalten hatte, hatte er einen anderen Eid damit gebrochen.
Manchmal war das Leben eines Soldaten wirklich nicht leicht. Und gerade für jemanden wie Cohen, dem Ehre alles bedeutete, was einen Mann ausmachen sollte, war sein eigenes Vergehen schwer zu ertragen.
Und zu allem Überfluss konnte er sich auch noch von diesem kleinen Sadisten, Cocoun – den Sohn und Erbe des Lord Schavellen – die ganze Reise bis nach Hause anhören, welch feiger Bastard er doch wäre.
Das brach auch im Hof der Burg nicht ab, als Cohen Galia einem Stallburschen übergab und seine Männer verabschiedete, die sich schnell in ihre Stammtaverne, »Zum Raben«, aufmachten – sie luden ihn ein, mitzukommen, doch er musste zuerst diese unangenehme Sache seines Verrats dem König vortragen. Cocoun ließ einfach nicht von ihm ab.
Nachdem der große Mann mit den blauen Augen und dem kurzen blonden Haar seinen anmutigen weißen Hengst abgegeben hatte, eilte er Cohen mit einem überheblichen Gang hinterher.
»Was der König jetzt wohl von seinem Lieblingssöhnchen halten wird, hmmm?« Er liebte es, auf den Fehlern anderer herumzureiten. »Ich muss schon sagen, Cohen, ich hätte nie von dir erwartet, dass du Angst vor ein paar Priestern hast!« Er lachte ihn aus und klopfte ihm mit der flachen Hand auf die Schulter. »Scheint dich noch ganz schön aus dem Wind zu bringen, dass wir deinen Bruder hängen ließen, habe ich recht?«
Cohen blieb so abrupt stehen, dass Cocoun es erst nach einigen Schritten bemerkte. Verwundert drehte er sich nach Cohen um, der mit angespannten Muskeln stocksteif mitten im Burghof stand und die Hände abwechselnd zu Fäusten ballte und wieder öffnete. Er mahlte mit den Kiefern und blickte diesem Scheusal von einem Menschen in das selbstgerechte Gesicht.
Cocoun war einst Cohens bester Freund gewesen, damals, als sie noch Kinder gewesen waren. Aber ihre Freundschaft war schon lange dahin. Er hatte irgendwann bemerkt, dass Cocoun zu einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen heranwuchs. Stets hatte er Cohen herablassend behandelt, weil Cohen nur ein Bastard war. Sie hatten sich schon lange nichts mehr zu sagen. Jedoch hatte Cohen ihn erst dann richtig zu verabscheuen begonnen, als er Cocoun einmal dabei zugesehen hatte, wie er aus reiner Lust und Laune die Dienerinnen in seinem Haus schikanierte. Wobei das Wort »Schikanieren« für das, was er ihnen angetan hat, stark untertrieben schien. Cocoun hatte Spaß daran, Untergebene zu foltern, zu vergewaltigen und aus reiner Lust und Laune zu töten. Cohen wusste es besser als jeder andere.
Und das wirklich Schlimme daran war, dass es offensichtlich in Ordnung für die Menschen war. Niemand behelligte ihn deshalb. Niemand hatte je versucht, ihm eine Falle zu stellen, um seine Verbrechen ans Tageslicht zu bringen. Aber Sevkin wurde hingerichtet, obwohl er nie jemanden wehgetan hatte.
Nun ja, niemanden außer letzten Endes Cohen.
Cocoun trat etwas näher, die Mittagssonne spiegelte sich in der auf Hochglanz polierten Silberrüstung, der leichte Wind bewegte seinen purpurnen Umhang, der nicht einmal ihm gehörte.
Noch immer bewohnte die Familie Schavellen den einstigen Königspalast in Dargard, und noch immer lagerten dort die Besitztürmer der Airynns. Cocoun bediente sich gerne an ihren Umhängen und schmückte sich wie ein König. Und nachdem Sevkin nun auch tot war, standen die Chancen, dass die Krone nach des Königs Tod an die Familie Schavellen überging, sehr hoch. Denn Cohen war und blieb ein Bastard ohne Rechte. Etwas Anderes wollte er auch gar nicht sein. Nicht, wenn er sich Cocoun vor Augen führte.
Cohen hätte dem anderen zu gerne das zufriedene Grinsen aus dem Gesicht geprügelt, doch damit hätte er Cocoun nur in die Hände gespielt.
»Ich weiß wirklich nicht, wieso wir mal Freunde waren«, platze es Cohen unverwandt heraus.
»Ich bin eben charmant«, konterte Cocoun und zuckte arrogant die Schultern.
Cohen schnaubte herablassend und ging kopfschüttelnd an seinen ehemaligen Freund vorbei. »Meine Frau erwartet mich, Cocoun, also entschuldige mich bitte.«
Cocoun sah ihm nach und rief provozierend: »Richte ihr schöne Grüße von mir aus, sie ist eine Augenweide. Zu schade, dass sie keinen Stand hat, sonst wäre sie meine Frau geworden.«
Mit den Zähnen knirschend zwang sich Cohen, weiter zu gehen.
***
»Das war kein Kampf Soldat gegen Soldat, Vater, das war ein Niedermetzeln von Unbewaffneten.«
In den Gemächern des Königs war es düster. Stets waren die dicken Samtvorhänge zugezogen, ihr Rot wurde nur von den Fackeln und Kerzen angestrahlt, die der König selbst am Tage aufstellen ließ. Es war reichlich warm in diesem großen Raum, im Kamin brannte ein Feuer, obwohl draußen bereits milde Winde wehten. Doch König Rahff war auf Grund seines Alters ein Mann, dem schnell kalt wurde.
Der König saß hinter seinem Schreibtisch, unzählige Schriftrollen und Briefe türmten sich vor ihm auf, er wirkte müde und genervt. Trotz seines Alters war Rahff jedoch noch ein Mann, indem Leben steckte. Er hatte sich seiner Schlankheit und seiner Muskeln bewahrt, auf seinen Wangen war ein gepflegter, silberner Bartschatten zu erkennen, und sein dunkles Haar war erst kürzlich wieder kurz geschnitten worden, was ihn jünger wirken ließ. Cohen wusste, dass sein Vater noch immer ein ernstzunehmender Krieger war, den kein Feind unterschätzen sollte.
»Wir werden es auf deinen Eid schieben«, beschloss der König. »Mach dir deshalb keine Sorgen. Wie du schon sagtest, es war keine Schlacht. Ich habe dich ohnehin nur mitgeschickt, damit mir jemand eine ehrliche Beurteilung der Geschehnisse dort berichten kann. Dir habe ich vertraut, diesem kleinen Schavellen Spross allerdings nicht. Wenn Cocoun etwas gegen dich vorzutragen hat, werde ich ihm ausrichten, dass du so gehandelt hast, wie die Krone es von dir erwartet.«
Die Worte seines Vaters erleichterten Cohen keineswegs. Er fühlte sich immer noch wie ein Feigling. Vermutlich, weil Cocoun ihn zwei Wochen lang als solchen beschimpft hatte.
»Für mich findest du immer Ausreden«, murmelte Cohen mit starren Blick zu Boden, »für deinen jüngsten Sohn hast du keine gefunden.«
Noch bevor er es ausgesprochen hatte, spürte Cohen des Königs strengen Blick auf sich.
Er drehte sich um und verbarg damit vor seinem Vater den Kummer, der in seinen Augen lag. Hinter ihm befand sich ein Buntglasfenster, aus dem er hinauszusehen versuchte. Doch die schönen Gärten der Burg wurden durch das rote Karo, aus dem er hinausblickte, nur zu etwas, das ihn wieder an den Krieg erinnerte.
Warum färbte sich alles rot wie Blut, egal, wohin er ging?
Lag es an ihm, oder an der Zeit, in der er lebte?
»Dein Bruder wählte sein Schicksal selbst, Cohen«, sagte der König und beugte sich wieder über seine Arbeit. Er musste viele Bittsteller abwehren, noch bevor sie vor den Thron treten konnten, sonst würde er vermutlich niemals den Thronsaal verlassen. Zu viele Menschen kamen her und knieten vor ihm, um ihn um seine Gunst anzuflehen.