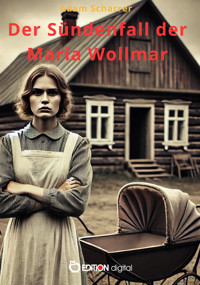4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Jugendlicher zwischen Armut und Aufbruch: Heinrich Sperber ist kein Held, kein Rebell – er ist einer von Tausenden, ein Sohn der Landstraße, der das Elend der deutschen Unterschicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den eigenen Händen tastet. In schonungsloser Ehrlichkeit schildert Adam Scharrer die Geschichte eines Jungen, der von Kindheit an mit harter Arbeit, Hunger und Demütigung konfrontiert wird, der durchs Land vagabundiert, zwischen Aufbegehren und Resignation schwankt – und doch seine Menschlichkeit nicht verliert. Eine autobiografisch geprägte Sozialreportage über Ausgrenzung, Überlebenswillen und Solidarität – kraftvoll, erschütternd, zeitlos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Adam Scharrer
Auch eine Jugend
Ein Leben am Rande der Gesellschaft
ISBN 978-3-68912-471-7 (E–Book)
Die Erzählung erschien 1979 im Aufbau Verlag Berlin und Weimar.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
AUCH EINE JUGEND
Ich habe über mich nicht viel Besonderes zu erzählen. Ich ging den Weg des proletarischen Kindes, das infolge der kleinen Scholle der Eltern als erster von etwa anderthalb Dutzend Geschwistern überflüssig wird und „unter die Leut“ geht, wie viele Tausende. In Bayern sind die Menschen fromm und grob, tun ihre Pflicht Gott und der Welt gegenüber, wie dies dort so der Brauch seit Generationen. Sie geben ihre ersparten Eier den Kapuzinermönchen und essen selbst trocken Brot, wenn die Sonne fast senkrecht steht. Mütter steigen mit schwangerem Leib auf die Hopfenleiter, und bei schwerer Arbeit von Sonnenauf- bis -untergang bleibt wenig Kraft und Zeit für pädagogische Wissenschaft und Praxis. Ein Pfiff – muss genügen. In dem Vater, der vor Schmerz zusammenbricht, weil ihm ein Sohn von einem Dutzend ertrank – der Sohn, den er vorher gottsjämmerlich verprügelte –, schreien nur die Fetzen eines zertretenen Gefühlslebens die geistige und physische Versklavung eines geschundenen Volkes in die Welt.
Ich war kein „artiges“ Kind. Machte mir so meine Gedanken schon recht früh. Aber ich war noch zu klein – sagte man mir. Hatte viele Fehler, mochte zum Beispiel kein fettes Fleisch und hatte manch anderen Hang zu Niederträchtigkeiten. Ich sah bald ein, dass die ganze Welt gegen mich war, und wurde still und – verlogen. Der Taler, der für den Pastor bestimmt war, als ich konfirmiert wurde, war mein erstes verdientes Geld, ohne dass ich Gewissensbisse bekam. Im Gegenteil: Ich glaube, ich habe damals zum ersten Mal über meine Erzieher gelacht. Das letzte Mal lachte ich über sie, als ich meinen Lehrmeister, einen ausgesprochenen Lehrlingsschinder, mit fünfzehn Mark anpumpte anlässlich der Gesellenprüfung. Ich wollte sie abarbeiten – sagte ich –, und er war froh, dass ich bleiben wollte. Ich brauchte Reisegeld, dachte ich – und ging.
Der erste Mensch, der mir verstehend auf die Schulter klopfte, mich anhörte und begriff, wie es um mich stand, war ein alter Vagabund. Das tat wohl – und führte mich in die Irre. So musste ich erst mühselig alle Wege abseits der Gesellschaft durchwandern, ehe ich den Ausweg fand. Wie Tausende noch heute, die, in die Dummheit hineingeboren, vergebens nach der rettenden Hand greifen. Aber man muss verstehen, aus hellen und finsteren Tagen Nutzen zu ziehen – glaube ich. Man unterliegt dann nicht so leicht der Phrase des Alltags. Man lernt nüchtern in die Welt schauen und wird nicht irre, wenn man allein auch gegen eine ganze Welt seinen Weg gehen muss. Ich gestehe, dass ich in der „großen Zeit“ den Trottel gut spielte, solange die Zeit, mit einem Kreuzdonnerwetter dreinzuschlagen, nicht gekommen war und es galt, die Zähne zusammenzubeißen. Die Proletarier tragen doch im Grunde genommen das gleiche Schicksal. Viele lernte ich kennen, die mir erst erzählten, was ich selbst erlebte.
Ich möchte daher in den folgenden Erzählungen meinem Freunde Heinrich Sperber das Wort geben. Ich kann noch verraten, dass ich am Ende des vierten Jahrzehnts noch nicht ganz „vernünftig“ geworden bin und wahrscheinlich noch manche Dummheit machen werde. Das liegt wohl so im Blut.
Nach Jahren begrüßte ich zwei alte Freunde wieder, mit denen ich im Ruhrgebiet manche unvergessliche Stunde verbracht hatte. Wie ändern sich doch die Zeiten und die Menschen! Der fast zwei Meter große Arnsdorf, den ich mir nur vorstellen konnte mit der Kohlenschaufel, mit der er hantierte wie mit einem Löffel und mit der er das gefräßige Maul einer großen Dampfmaschine fütterte, stand vor mir im blauen Sonntagsanzug. Das Kapitänsabzeichen an der blauen Mütze vervollständigte die äußere Veränderung. Und wenn es auch nur ein 200-Tonnen-Frachtdampfer war, den er kommandierte – Kapitän ist Kapitän.
„Wo ist Heinrich?“ Ich konnte nicht abwarten. In demselben Augenblick wirft ein Gesicht ein bekanntes Lächeln über meine Schulter. „Tag, alter Junge!“ Heinrich Sperber schüttelte mir die Hand. „Was guckst du?“, scherzte er. Ja, was gab es da auch noch zu wundern. Ein Schiffskoch trägt sonntags eine reine weiße Jacke und nicht wie früher als Schlosser blaue Arbeitsanzüge voll Dreck und Fett. Und ein mich kritisch musternder junger Schäferhund ist zwar an Bord auf einem der vielen kleinen Kasten eine Seltenheit, aber keine Unmöglichkeit.
Auf jeden Fall kein Grund, der Einladung zum Frühstück länger Widerstand zu leisten.
Teils um das Gespräch in Gang zu halten, teils aus purer Neugierde – Heinrich war oben noch mit der Zubereitung des Frühstücks beschäftigt – erkundigte ich mich nun nach dem Besitzer des Hundes. Ich war natürlich der Meinung, er gehörte Arnsdorf. „Nein“, meinte dieser, „Schweizer (auf diesen Namen hört der junge Schäferhund) ist eine kleine Schwäche von Heinrich, aber wir alle haben uns bereits so an ihn gewöhnt, dass er unser Freund geworden ist. Weißt du“, fuhr er dann fort, „das Leben hier ist doch im Großen und Ganzen ruhig, da lernt man sich erst richtig kennen, und Heinrich und ich haben fast keine Geheimnisse mehr voreinander. Heinrich kann außerdem sehr nett erzählen; nur muss man es verstehen, im rechten Augenblick etwas aus ihm herauszuholen. Man darf ihn nicht direkt auffordern, sondern man muss selbst damit anfangen, dann nimmt er gewöhnlich bald das Wort.“
Wir haben diese unsere geheime Abmachung eingehalten und haben während meines achttägigen Urlaubs das aus Heinrich Sperber „herausgeholt“, was ich in den folgenden Aufzeichnungen berichte.
1. Jugendfreunde
„Schweizer“, erzählte Sperber, „war mein Freund, der Kamerad meiner Kindheit. Unter einer dicken Eiche am Anger habe ich ihn begraben, habe ihn hingefahren mit dem Schubkarren; wo sollte er auch sonst liegen, wenn nicht dort, wo er einst herrschte. Ich habe ihm nichts auf seinen Hügel pflanzen können; die Herde würde es ja nur zertrampeln. Aber die alte dicke Eiche wird noch lange stehen, länger als die Würmer brauchen werden, um Schweizer aufzufressen. Später habe ich die dicke Wurzel, die auf sein Grab zuläuft, mit dem Beil tief eingekerbt.
Ich war wohl erst an die fünf Jahre alt, als unser Schweizer mit vier anderen Geschwistern geboren wurde. Die anderen hat mein Vater im Bach versenkt, weil er nicht wusste, wer ihr Vater war. Aber mit dem einen wollte er es versuchen. Es war der kräftigste, gelb wie reife Ähren, mit einer schönen weißen Blesse über den Augen. Als ich zur Schule ging und schon täglich mit meinem Vater auf den Anger musste, war Schweizer auf der Höhe seiner Kraft, voll Feuer und unverwüstlicher Angriffslust.
Dabei war er gutmütig; die nervösen Kälber, die nicht ahnen konnten, dass ein Griff Schweizers sie hinwerfen konnte wie ein Bündel Lumpen, hielt er an den Fesseln fest wie kleine Verbrecher; ließ sie ein wenig zappeln, um sie seine Kraft fühlen zu lassen, und drehte sie dann einfach um, um ihnen beizubringen, dass die Heimreise nur mit seiner Erlaubnis angetreten werden dürfe. Bald merkten sie, dass die Herrschaft von Schweizer eine unbeschränkte ist. Die Kühe, die gern den Klee besäumten, sich gelegentlich eine schöne Rübe aus dem Acker holten, schielten immer erst verstohlen nach Schweizer hin. Sie wussten, dass er keinen Spaß verstand. Die Unbelehrbaren mussten meistens schmerzhafte Tätowierungen auf ihren Fesseln mit in Kauf nehmen. Schweizers Fangzähne waren scharf, sein Griff so sicher, dass auch die Bewegung der Füße im schnellsten Lauf nichts nutzte. Wenn nachmittags die Herde auf den Anger kam, kam Schweizer sofort auf mich zu. Ich musste von der Schule aus sofort meinen Posten bei der Gänseherde antreten und wartete schon immer darauf, wenn gegen drei Uhr mein Vater mit der Herde erschien, die vormittags auf einer anderen Weide graste.
Die Tafel Schweizers war nicht allzu reichlich gedeckt.
Es gab fast kein Fleisch; und doch war die Arbeit nicht leicht; dazu steigerte die frische Luft den Appetit weit über das Maß hinaus, wie es in der Futterschüssel Schweizers zum Ausdruck kam. Wo ich einen Knochen, eine Schwarte, ein Stück Brot ergattern konnte, verwahrte ich es für meinen dankbaren Freund.
Die Herde Gänse, die ich zu bewachen hatte, hatte nämlich auch ihre Mucken. Oben an der Bahn waren zwei Meter vom Damm Staatseigentum. Das Gras dieser zwei Meter gehörte den Ziegen des Bahnwärters und war dicht und lang. Dieses Gras zog natürlich jedes Gänseherz an. Einige, die heimlich verschwinden wollten, fraßen sich, wie in Gedanken, immer weiter nach der Bahnunterführung hin, um dann mit einem Male zu laufen, was sie konnten. Oh, sie kannten alle umliegenden Äcker und die diversen Leckerbissen ganz genau. Der Anger war lang, und in der Zeit der ersten Schuljahre liegt man gern im Sande, erhebt sich erst, wenn es schon zu spät ist, um sich wieder hinzulegen, weil es schon zu spät ist. Das wussten auch meine weißen, schwarzen und scheckigen Gänseuntertanen.
Schweizer hat sie dann, kaum dass er mich gegrüßt hatte, für einen Knochen immer rasch zusammengeholt. Zuletzt liefen sie schon zusammen, wenn die ersten Kühe in Sicht waren oder die Glocken der Herde hörbar wurden. Auch Gänse mit schlechtem Gewissen gibt es. Sie wussten nämlich sehr wohl, was erlaubt und was verboten ist. Zuletzt genügte ein Pfiff oder der laute Ausruf „Schweizer!“, und die Gänsegemeinde erinnerte sich der gesetzlichen Vorschriften, die auch ein Volk von Gänsen respektieren muss, soll eine vernünftige Regierung möglich sein.