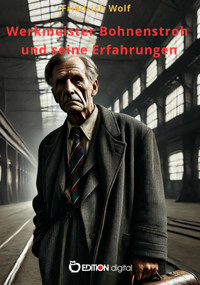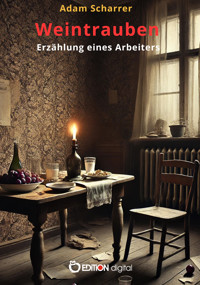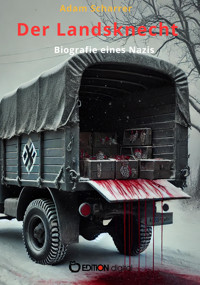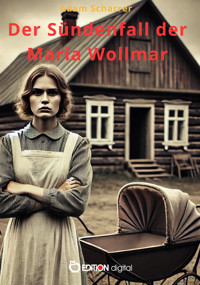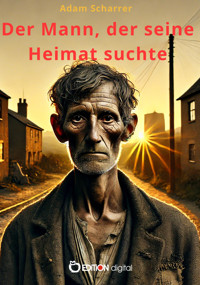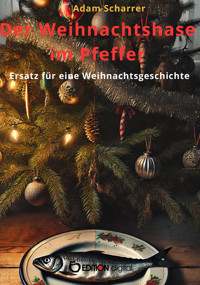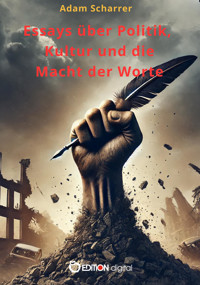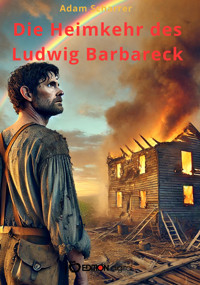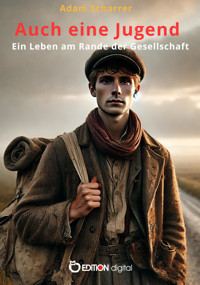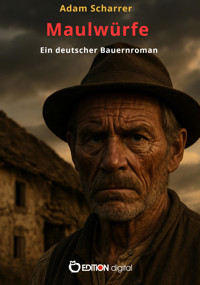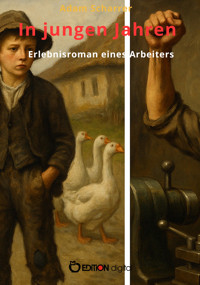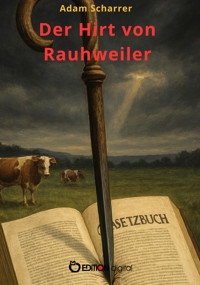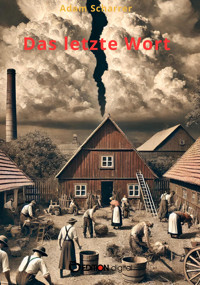
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählungen vom Überleben, vom Aufbegehren, vom Verstummen. Adam Scharrer schildert in packender Sprache das Ringen einfacher Menschen mit harter Arbeit, familiären Zerwürfnissen, politischer Repression und dem Verlust von Menschlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Ob im bäuerlichen Alltag oder unter dem Druck der nationalsozialistischen Diktatur – seine Figuren versuchen, das Richtige zu tun. Doch oft sind die Verhältnisse stärker als der Einzelne. Die beiden Erzählungen sind lebensnah, erschütternd und hochaktuell – ein literarisches Zeitdokument von eindringlicher Wucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Adam Scharrer
Das letzte Wort
ISBN 978-3-68912-495-3 (E–Book)
Die beiden Erzählungen erschienen 1948 im Verlag „Lied der Zeit“, Berlin.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Vorwort
Einmal muss man wohl damit beginnen, die Masken und Fratzen wegzuräumen, die in der Nazi-Zeit (und auch schon vordem) als Ersatz für menschliche Werte und menschliche Würde auch in der Literatur über das deutsche Dorf herhalten mussten. Man schrieb und quasselte von einer „erdgebundenen“, „der Scholle verhafteten“ Literatur und traktierte den Leser mit „Heldengestalten“, die alle miteinander am liebsten Pflug und Pferd und Haus und Hof im Stich ließen, um sich vom ärmsten Hungerleider bis zum Baron von und zu in das Gemetzel des Krieges gegen irgendeinen Feind zu stürzen.
Nirgends tritt die Verachtung alles menschlichen krasser zutage als in der sogenannten Bauernliteratur des „Dritten Reiches“, denn der bäuerliche Mensch verwächst von Kindesbeinen an mit der Erde, die ihn nährt, der er die Saat anvertraut, der er die Ernte abringt, um von neuem zu säen. Und seine Welt, das sind Haus und Hof und Ställe und Scheunen, und der Kampf um das tägliche Brot verschlingt alle Kraft vom Kind bis zum Greis bei jenen, die nur wenige und magere Felder zu bestellen haben, weil, na weil eben die anderen Zehntausend das Hundertfache oder Tausendfache für sich in Anspruch nehmen, angeblich, weil das so von Gott gewollt sei. Der Gott musste auch hier als Firmenschild der Kriegshetzer herhalten, um die landlosen und landarmen Bauern abzulenken von ihrem gerechten Kämpf um eine gerechte Verteilung des Bodens in der Heimat.
Dieser Kampf hat jedoch niemals aufgehört, trotz aller verlogenen Schreiberei und aller geistigen und physischen Knechtschaft. Und von diesem Kampf um die wirklichen Nöte und kleinen Freuden und einer, wenn auch im Verborgenen tätigen, aber tief menschlichen Gesinnung der Menschen im deutschen Dorf während der unglückseligen Zeit unseres Volkes soll in den beiden Erzählungen berichtet und gleichzeitig daran erinnert werden, wie wichtig es auch für die Menschen in der Stadt ist, trotz aller eigenen Nöte die Bande mit allen im Dorfe neu zu knüpfen und fester zu knüpfen, die guten Willens sind.
Adam Scharrer
Das letzte Wort
Es hatte bereits drei Wochen geregnet, als endlich die Sonne wieder durchkam, und Krummhofer hatte das Heu der zweiten Mahd auf den Wiesen liegen. Da durften Menschen und Vieh nicht geschont werden. Das meiste Heu kam auch gut unter Dach, nur auf das letzte Fuder, das die Krummhoferin mit den Kühen heimfuhr, prasselte ein hagelkalter Regenguss, der auch die Krummhoferin bis auf die Haut durchnässte. Anderen Tags klagte sie über Halsschmerzen, bekam Fieber, dann Lungenentzündung, und eine Woche später starb sie. An ihrem Bett standen vier Kinder: der Simon, die Martha, die Julie und der Peter. Sie waren in recht ungleichem Alter: der Simon achtzehn, die Martha zwölf, die Julie zehn und der Peter acht Jahre alt. Haus, Scheune und Vieh waren versichert, die Frau nicht. Krummhofer konnte durch doppelte Arbeit nichts aufholen, denn er hatte schon immer so viel gearbeitet, als er konnte.
Einige Wochen nach der Beerdigung zahlte Krummhofer Maria, der Magd, die Hälfte des Jahreslohnes auf den Tisch und sagte: „Wenn du noch einen Monat warten könntest mit dem andern Teil, dann tätst du mir einen großen Gefallen.“
Maria hatte in den letzten Wochen immer wieder daran denken müssen, was die Bäuerin in den letzten, lichten Stunden aus dem hohen Fieber heraus zu ihr gesagt hatte. „Maria“, hatte sie gesagt, „wenn ich fort muss, und du kannst es, hilf ihm über das Schlimmste hinweg. Und wenn du auch das könntest, ganz bei ihm bleiben, schon wegen der Kinder, dann wär mir das Sterben um vieles leichter. Und lohnen wird er es dir, kannst es mir glauben, Maria, und die Kinder auch, wenn du sie davor bewahrst, ganz ohne Mutter zu bleiben oder eine fremde zu bekommen, wo sie so mit in den Kauf genommen werden.“
„Ich brauch jetzt kein Geld“, antwortete Maria hastig. „Ich hab jetzt gar nicht damit gerechnet, wo mir doch auch noch alles so wund und weh ist. Ein paar Mark brauch ich, zum Kochen und für die Wirtschaft. Mit dem anderen Geld werden wir schon einig werden. Ich bin doch jetzt nicht auf das Geld versessen, das dürft Ihr doch nicht von mir denken.“ Doch gerade durch die Antwort Marias fiel Krummhofer plötzlich ein, dass Maria in den letzten Wochen kein Geld für den Haushalt und die Wirtschaft verlangt hatte. Krummhofer grübelte, wann er ihr zum letzten Male Geld gegeben. Er konnte sich auch entsinnen. Zehn Mark waren es, einige Tage nach der Beerdigung. Sicher hatte Maria von ihrem eigenen Geld zugelegt. Auch hatte Krummhofer ihr jedes Jahr zehn Mark zum Lohn zugelegt. In diesem Jahr hatte er nichts davon erwähnt, obgleich Maria noch früher aufstand, noch später schlafen ging, sonntags in ihrer Kammer saß und für die Kinder flickte und stopfte, hundert Dinge bedenken und machen musste, die sonst die Bäuerin gemacht hatte. „Entschuldige, Maria“, sagte Krummhofer, „es ist nicht nur der Lohn. Es sind ja so viele Sachen, die wir noch bereden müssen. Es ist halt ein großes Loch geblieben, das nicht zugedeckt werden kann wie ein Grab. Nimm das Geld für die Wirtschaft. Schreib alles genau auf, und fass das nicht falsch auf. Ich weiß, du rechnest schon richtig, aber du rechnest mehr als richtig. Und reden wir dann über das andere später.“
Krummhofer ging aus der Stube. Lang und gebeugt stand er im Obstgarten und grübelte. Er hatte wohl über fünfzig Hektar Land, ein großer Teil war aber unfruchtbarer Sandboden, mit kümmerlichen Kiefern bewachsen. Ein anderer Teil war sumpfig und lag brach. Krummhofer hatte sich vorgenommen, das Wasser aus den sumpfigen Wiesen mit Röhren abzuleiten und an der tiefsten Stelle einen Fischteich mit Ablaufgraben nach dem Bach anzulegen. Mit tausend Mark wäre die Sache seiner Meinung nach zu machen gewesen. Doch dazu war viel Fuhrarbeit notwendig, mit Ochsen nicht zu schaffen. Ein gutes Gespann Pferde sollte der Anfang zu diesem Plan sein. Simon war ja nun schon herangewachsen und konnte den Knecht ersetzen. Und damit im Zusammenhang stand die weitere Absicht Krummhofers, den kümmerlichen Kiefernwald abzuholzen und auf den Sand Boden aufzufahren. Die Stubben hätten ihm die Ziegelarbeiter herausgegraben, wenn er sie ihnen unentgeltlich gelassen hätte. Jedes Jahr einen Hektar Boden befahren, wäre für zwei Pferde Gelegenheitsarbeit gewesen. Der Hafer für die Pferde wäre auf dem Neuland vom ersten Jahre an gewachsen. Ganz fest hatte Krummhofer noch vor wenigen Wochen an das Gelingen seines Vorhabens geglaubt. Auf seinem Hof stand eine Hypothek von dreitausend Mark; eine zweite von einigen tausend Mark wäre tragbar gewesen, wenn die Frau am Leben geblieben wäre. Aber nun, allein, mit fünfzig Jahren auf dem Rücken, schien ihm alles ganz hoffnungslos. Es kam ihm vor, als wenn von zwei guten, gängigen Pferden eines tot niederstürzte. Was die Kraft von zweien, die gut zusammen ziehen, leicht bewältigt, ist für das eine unmöglich.
An den Sonntagen kam regelmäßig die Schwester Krummhofers wie „um nach dem Rechten zu sehen“. Sie war nicht sparsam im Austeilen von Befehlen, hauptsächlich Maria gegenüber. Eines Sonntagmorgens sagte Maria zu Krummhofer: „Heute Nachmittag möchte ich fortgehen. Ihr werdet mich ja nicht brauchen?“ Hätte Krummhofer nicht gewusst, warum sie fortging, hätte er wohl ohne jeden Einwand zugestimmt, aber weil er es wusste, sagte er: „Gehen kannst du, Maria, das ist dein gutes Recht, aber vor anderen Leuten ausweichen brauchst du nicht, das möcht ich dir bloß sagen.“
Die Mädchen fragten ganz erstaunt, wo Maria hinwollte und ob sie nicht mitgehen könnten. „Ein andermal vielleicht“, sagte Maria verlegen, dann ging sie. Bald darauf pfiff der Lokalzug, mit dem die Tante kam. Sie fragte nach Maria, und als sie erfuhr, dass die fortgegangen sei, meinte sie: „Das ist aber wirklich allerhand! Sie hat doch gewusst, dass ich komme. Aber von den Leuten ist halt einer wie der andere. Sie machen keinen Handgriff mehr als bezahlt wird.“ Flink huschte sie in die Küche.
Krummhofer ging aus dem Haus. Eine volle Stunde blieb er fort. Die Schwester fragte die Kinder, was Maria die Woche über gekocht habe, wann sie aufstünde und schlafen gehe. Aber die Kinder gaben kurze Antworten. Mit dem Zug um acht Uhr abends fuhr sie wieder ab. Simon brachte sie zur Bahn.
Krummhofer setzte die Rüben für die Schweine aufs Feuer und schüttete den Ochsen und den Kühen Häcksel in den Born. Dann kam Maria. Sie zog sich um und machte still und stumm ihre Arbeit. Und Krummhofer kalkulierte ganz richtig, dass auch Maria sich Gedanken machte, wie das nun weiter werden sollte.
Es waren nämlich nicht nur die Verwandten Krummhofers, die da stichelten, auch im Dorf gab es nicht wenig Lästermäuler. „Die Maria wird schon wissen, was sie macht!“, sagten sie. „Und bequemer kann sie es ja gar nicht haben, und lohnen tut sich die Sache ja auch. Und der Alte wird auch mal Appetit kriegen auf junges Fleisch. Und die Maria wird ihm schon Appetit machen!“ Von diesen Redereien wusste auch Krummhofer. Bisher hatte er geschwiegen, aber schwieg er weiter, fürchtete er, dann wucherten auch die Redereien weiter wie ein Geschwür unter der Haut.