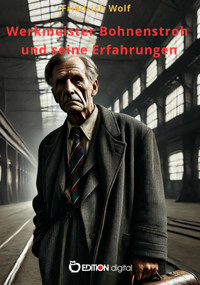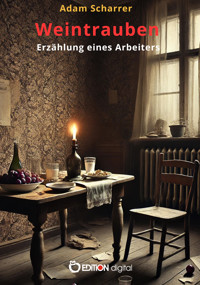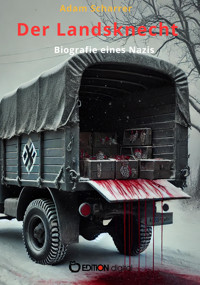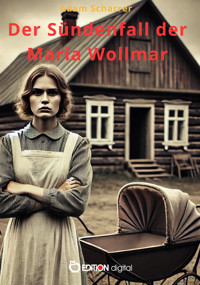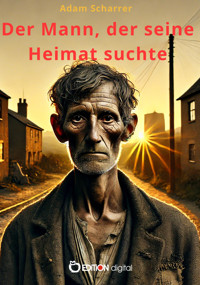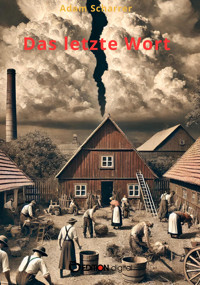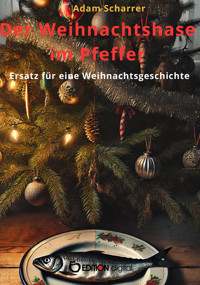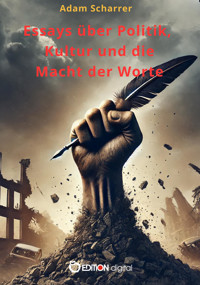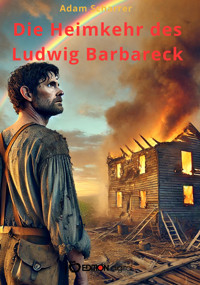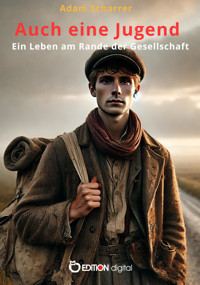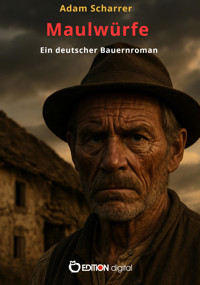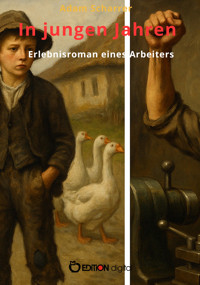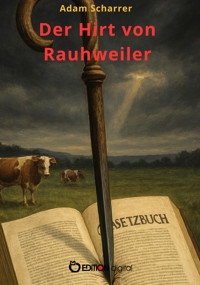3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schuss, der bleibt – das fragmentarische Porträt eines Mannes, den der Krieg nicht loslässt. Im Lazarett liegt ein Soldat – stumm, reglos, getroffen von einer Kugel, die nicht nur seinen Rücken, sondern sein ganzes Leben zeichnet. In eindringlichen Episoden erzählt Adam Scharrer die Geschichte eines Mannes, der das Töten verweigert – und dafür mit dem Schweigen der Gesellschaft bestraft wird. Zwischen den Fronten von Körper und Geist, Schmerz und Erinnerung, Krieg und Gewissen entsteht das Fragment eines Romans, das weit mehr ist als die Summe seiner Teile: ein radikales Zeugnis über Verletzung, Entfremdung und die Suche nach Würde. Mit psychologischer Tiefe, politischer Klarheit und erschütternder Ehrlichkeit entwirft Scharrer ein literarisches Mahnmal gegen das Vergessen – und für die Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Adam Scharrer
Der Mann mit der Kugel im Rücken
Fragment eines Romans
ISBN 978-3-68912-465-6 (E–Book)
Das Buch erschien 1979 im Aufbau Verlag Berlin und Weimar.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
ERSTER TEIL
ERSTES KAPITEL: Ein Plan, der etwas für sich hat
Richard Reglin war im Jahre 1916 in den Streukegel eines Maschinengewehres geraten. Eine Kugel saß ihm nun noch, zwölf Jahre später, im Rücken, dicht an der Wirbelsäule. Da eine operative Entfernung der Kugel ärztlicherseits als lebensgefährlich beurteilt wurde, hatte Richard sich zu einer Einwilligung für eine Operation bisher nicht entschließen können. Aber nun „wanderte“ die Kugel, und es bestand eine geringe Hoffnung, dass sie sich in günstiger Richtung bewegte. Es war ein nie versiegender Schmerz, unter dem Richard zu leiden hatte, und manchmal steigerten sich die Schmerzen bis zu kaum erträglichen Anfällen, und deswegen beobachtete die Mutter Richard auch jetzt ängstlich und misstrauisch, als er – soeben von der Arbeit nach Hause gekommen – sich auf dem Küchensofa ausstreckte. „Ist es schlimmer geworden?“, fragte sie dann. „Soll ich dein Bett aufdecken und das Heizkissen einschalten?“
„Nicht schlimmer als sonst“, antwortete Richard. „Überdies werde ich bald Zeit haben, mich zu schonen, nächste Woche wird unsere Bude stillgelegt.“
Das Gesicht der Mutter wurde noch um einen Schein besorgter, und ihr Blick von ihrem Sohne zu ihrem Manne bestätigte, dass sie die Antwort Richards voll inhaltlich begriffen hatte. Richard wurde wieder arbeitslos. Die Mutter fand sich jedoch rasch in das Unvermeidliche. „Nun, dann wird auch wieder Rat werden“, sagte sie und räumte den Tisch ab. Sie ging den Sechzig entgegen, war groß gewachsen und hielt sich noch aufrecht wie eine Vierzigerin, wie zum Trotz gegen die schwere Bürde, die sie durchs Leben trug. Einen Sohn hatte sie durch den Krieg verloren. Erna, die Tochter, lebte seit fünf Jahren in nicht sehr glücklicher, kinderloser Ehe. Der alte Reglin war Maurer von Beruf, dreiundsechzig Jahre alt, nun Wohlfahrtsrentner. Der Winter war hart und lang gewesen, und es war nun noch, im März, empfindlich kalt. Aber der Frühling war dennoch spürbar, und durch den kleinen Garten, der an die kleine Stube anschloss, konnte während der warmen Jahreszeit die Enge der Eineinhalbzimmerwohnung überwunden werden. „Wird schon wieder werden“, betonte Frau Reglin aufs Neue. „Es hat ja immer wieder werden müssen.“ Sie setzte sich an die Nähmaschine, aber sie schneiderte „nur für den Hausgebrauch“, wie sie sagte, denn die Rente Richards war ohnehin um fünfzehn Prozent gekürzt worden. Der Patient hätte sich bereits in hohem Maße an seinen Zustand gewöhnt, hieß es in der Begründung des Vertrauensarztes. Aber die Kürzung der Renten im Allgemeinen hing auch damit zusammen, dass der offiziell gepredigte und praktizierte Zwang zur Sparsamkeit, wie sie in dem Abbau von „überschüssigen“ Arbeitskräften in den Industrie- und Verwaltungsbetrieben zum Ausdruck kam, auch die Wohlfahrtsunterstützung mit einbezog, und wenn es ruchbar würde, dass Frau Reglin mit ihrer Näherei regelmäßig verdiente, war damit zu rechnen, dass auch die Unterstützung für ihren Mann gestrichen würde. Und deshalb arbeitete Frau Reglin nur für vertrauenswürdige Kundschaft. Viel sprang dabei nicht heraus: Sechs bis acht Mark die Woche, und die letzten fünf Mark hatte sie verschwenderischerweise geopfert, um noch nachträglich ihren neunundfünfzigsten Geburtstag zu feiern. Sie hatte ein Kleid für eine Nachbarin genäht, eine Kriegerwitwe, Frieda Krappe hieß sie, zweiunddreißig Jahre alt. Und von Frieda hatte Frau Reglin die fünf Mark eigentlich nicht annehmen wollen, denn die Sache war die, dass Richard in Frieda „verknallt“ war und wohl auch umgekehrt, wie die alte Reglin sich ausdrückte. Aber Frieda bestand darauf, die Arbeit für das Kleid zu bezahlen, erklärte sich jedoch damit einverstanden, die fünf Mark für die Feier des Geburtstages der Frau Reglin zu verwenden, denn dadurch war wieder eine Gelegenheit gegeben, einen Abend mit den Reglins zu verbringen. Und während also Frau Reglin am Abend in der Küche den Kaffee aufbrühte, den Geburtstagskuchen schnitt, die Flasche Likör und die kleine Packung Pralinen bereitstellte und für die Männer die Zigarren zurechtlegte, klopfte Frieda an. Sie bat um einige kleine Änderungen an ihrem neuen Kleid, und als Frau Reglin sie nun gewissermaßen offiziell zur Feier einlud, waren die Männer tatsächlich überrascht, und Richard brummte: „Du scheinst es ja noch recht dick zu haben!“ Der Alte sagte nur: „Na ja, nobel geht die Welt zugrunde!“ Und als Frieda nun sagte: „Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme“ und sich auf einen Stuhl nötigen ließ, sagte Richard gutmütig: „Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf!“
Die beiden Männer hatten unterdessen ganz vergessen, dass der Sonnabend für den Skatabend reserviert war. Dies konnte natürlich der „dritte Mann“, der Radtke, nicht wissen, und er stellte sich pünktlich um acht Uhr ein. Die Stube war bereits gehörig verqualmt, die halbgeleerte Likörflasche stand da und einige geleerte Bierflaschen, und Frau Reglin hatte gerade Kaffee aufgebrüht. „Na, wenn das so ist, dann meine herzlichste Gratulation!“, sagte Radtke und reichte Frieda und Richard die Hand, und er war anscheinend schwer zu überzeugen, dass hier, „im engsten Kreise“ natürlich, nicht etwa eine Verlobung gefeiert würde, sondern ein Geburtstag. Zumindest war es auffällig, dass Frieda in diesen „engen Familienkreis“ mit einbezogen war. Radtke war jedoch nicht der Mann, gegen Dinge anzustreiten, die man seiner Meinung nach nur noch nicht so recht wahrhaben wollte, und als er nun eingeladen wurde, mitzufeiern, sagte er schlagfertig: „Da meinerseits sowieso vorgesehen war, den Abend mit euch zu verbringen, will ich kein Spielverderber sein.“ So bekam auch er seine Flasche Bier und seinen Schnaps und seinen Kuchen und seine Zigarre, aber auf die hausbackene Frage „Wie geht’s sonst?“, antwortete er nicht wie sonst: „Belämmert!“, sondern er sagte mit gewichtigem Ernst: „Ich hab mir ein Haus gekauft!“
Aufgeräumtes Lachen, nur zu verständlich, wenn man bedenkt, dass es Radtke auch dann schwerfiel, die Mäuler seiner Familie einigermaßen zu stopfen, wenn er Arbeit hatte, und nun war er bereits viele Monate ohne Arbeit. Er blieb aber unerschüttert ernst, und als die Lachsalve abgeebbt war, sagte er: „Wenn ich euch nun berichte, wie sich die Sache verhält, dann seht ihr vielleicht ein, dass es gar nicht zum Lachen ist.“
Radtke war von Beruf Gärtner, aber es war lange her, dass er diesen Beruf ausgeübt hatte. Zum eigenen Geschäft hätte es vielleicht gereicht, wenn der Krieg nicht gekommen wäre und Radtke sich nicht jahrelang im Schützengraben hätte herumsielen müssen, während das Ersparte entwertet wurde und die „Sachwerte“, also auch Grundstücke, ins fantastische hochkletterten. Als dann auch Radtke wieder einigermaßen zur Besinnung kam, war er fünfzig Jahre alt geworden und hatte, wenn es „klappte“, im Sommer als Steinträger Arbeit gehabt und im Winter als Schallplattenpresser. Er hatte „nicht schlecht“ verdient, in der Zeit der üppigsten Inflation sogar Millionen und Milliarden, und bald nach der „Stabilisierung“ war er arbeitslos geworden. Das nun erworbene Haus hatte er seinem ältesten Sohn zu verdanken. Der hatte eine Zeit lang nebenberuflich die Steuerbücher der Witwe eines Altwarenhändlers geführt und die Witwe dann geheiratet, und wenn Not am Mann war, konnte er den Eltern gelegentlich auch aushelfen. Es war aber sehr oft Not am Mann, es war gewissermaßen ein Fass ohne Boden, während dem alten Radtke die Gärtnerei immer noch im Kopf herumspukte, bis der Sohn ebendieses Haus entdeckte. Es war ein Haus am Langensee, nicht mehr bewohnbar, weil das Grundwasser vom See her drückte, und in letzter Zeit hatte sich der Druck des Wassers so verstärkt, dass das Haus nur noch auf Abbruch verkauft werden konnte. Und aufstellen (so sagte Radtke wörtlich), aufstellen wollte er es auf einem Stück Siedlungsland, zu haben auf Abzahlung, in Raten von monatlich zwanzig Mark, drei Kilometer vom jetzigen Standort, und wenn „alles klappte“, dann kommt Radtke doch noch zu einem eigenen Haus und zu einer eigenen Gärtnerei …
Dieser Plan, ein massives Haus abzureißen und es drei Kilometer vom früheren Standort wieder aufzubauen (und zwar möglichst ohne fremde Hilfe, wie Radtke beteuerte), schien vorerst allen fantastisch. Richard goss die Schnapsgläser voll und bemerkte etwas abfällig: „Na, wenn das so einfach ist, dann prost!“ Aber der Plan hatte für alle auch etwas Bestechendes. Das Haus war bezahlt, wie Radtke weiter berichtete, auch die Anzahlung für die Parzelle, und diese war bereits im Grundbuch eingetragen, sicherheitshalber auf den Namen des ältesten Sohnes, damit die „Wohlfahrt“ ihm, Radtke, nicht etwa einen „Vermögenszuwachs“ nachweisen und die Wohlfahrtsunterstützung streichen konnte. Abreißen wollte Radtke das Haus selbst, die noch bei den Eltern lebenden Kinder konnten dabei tüchtig helfen; die gröbsten Brocken würden mit Pferden abtransportiert, das andere mit dem Handwagen. „In einer Woche habe ich die Klamotten auf meinem Grundstück“, erklärte Radtke siegesgewiss. „Und das andere, das Aufstellen, na, das richt ich mir eben ein, wie es mir passt.“ Dieser Plan umfasste aber nicht nur den Neuaufbau des abgetragenen Hauses, sondern auch die sofortige Nutzbarmachung der Parzelle mit Kartoffeln, Gemüse, Tomaten; mit Gärtnerbeeten vorerst nur zum geringen Teil. Dafür müsste erst der Boden kultiviert werden, aber bis zum nächsten Jahr würde auch diese Sache schon in Frage kommen, und für dieses Jahr also genüge eine Bretterbude mit einem Ofen zum Kochen. Kartoffeln wachsen, Gemüse; Fische kann man angeln. Die Angelkarte kostet das ganze Jahr fünf Mark, macht sich doppelt und dreifach bezahlt. Schlamm aus dem See kann man zur Kultivierung des Bodens so viel haben, wie man will, unentgeltlich, ausgezeichnetes Material, außerdem stünden noch ein Dutzend ausgewachsener Bäume auf dem Grundstück, Kiefern, die würden ungefällt ausgegraben, damit durch ihr Gewicht beim Fallen auch die Stubben mit herausgerissen würden. Wasser zum Gießen könnte man aus dem See nehmen, fürs erste auch zum Kochen, bis der älteste Sohn, eben der jetzige Altwarenhändler, billig eine gebrauchte Pumpe aufgestöbert hätte. Stacheldraht hätte er bereits gekauft, drei Mark die Rolle, in Rüdersdorf, es wäre zwei Stunden zu fahren, also im ganzen vier, das könnten die Kinder mit dem Handwagen machen. Für eine schattige Ecke gäbe es in allernächster Nähe Sträucher genug, die könne man jetzt noch umsetzen, und sie würden bereits im kommenden Sommer gut angewachsen sein und Schatten spenden. Einen Tisch dazwischen, ein Dach darüber … „und die .Wohlfahrt“ müssen sie mir weiterzahlen, solange sie einem keine Arbeit nachweisen können, und vorerst ist an andere Arbeit ja doch nicht zu denken, und auf diese Art vertrödelt man seine Tage wenigstens nicht ganz umsonst“. – „Verlieren kann ich jedenfalls nichts …“
Nun war das abfällige Lächeln auf den Gesichtern verschwunden, und den Ausschlag dafür hatte der letzte Satz gegeben, und er war auch der Ausgangspunkt zur Überprüfung dafür, inwieweit Radtke in der Lage war, diesen immerhin etwas fantastischen Plan zu realisieren. Eine gewisse Garantie dafür war Radtke unbestreitbar selbst: ein Mensch, der willens war, sich restlos ins Zeug zu legen, wenn Aussicht bestand, dass etwas dabei heraussprang. Und Kraft hatte Radtke noch, und seine Kinder würde er auch gehörig herannehmen, und weiter stand fest, dass da etwas im Entstehen war, was einen greifbaren Anreiz bot. Das Grundstück war also bereits da, rechtmäßiges Eigentum, eine Woche später würden die abgerissenen Brocken des Hauses an Ort und Stelle, wohl auch bereits die Bretterbude aufgebaut sein, und dann konnte man also, sowie es auftaute, mit dem Umgraben der Erde beginnen. Und dies war schon nicht mehr problematisch, auch nicht die Hoffnung auf Kartoffeln und Gemüse. Und das Haus selbst? Nun ja, dazu gehörten auch Zement, Kalk, Nägel, Beschläge und Schlösser und Glas und Ziegel, aber man brauchte nur durch eine der Laubenkolonien zu gehen, um sich zu überzeugen, wie erfinderisch die Not macht, und Radtke war als besonders erfinderisch bekannt. Er wird sich was hinbauen, dass er mit seiner Familie unterkriechen kann. Auf diese Weise spart er die Wohnungsmiete, und sein Tag wird von morgens bis abends mit Arbeit angefüllt sein. Und wenn es auch eine armselige Armeleutewohnung ist, die dem ganzen Plan zugrunde liegt und von der Wohlfahrtsunterstützung getragen werden soll … Es ist doch keine sinnlose Rechnung, wenn man die Zeiten mit in Betracht zieht …
Stumm saßen sie alle da, bis Richard in diese Stummheit hinein sagte: „Die Sache ist gar nicht so übel! … Wenn ich nur so zupacken könnte, wie ich gern möchte …“
„Aber vielleicht käme eine andere Parzelle für dich in Frage?“, warf Radtke nun ein. „Da ist zum Beispiel ein Eckgrundstück, einfach fabelhaft! Teils hoher Baumbestand, teils Busch und Sträucher und ungefähr die Hälfte guter, wurzelfreier Boden, einfach ideal! Wenn ihr vier Bäume opfert, bekommt ihr aus zwei Bäumen die Bretter für eine Laube geschnitten. Ich hab mit der Frau Demel gesprochen, die da einen Kramladen aufgemacht und die Vertretung für den Grundstücksmakler übernommen hat. Ich hab sie gebeten, das Eckgrundstück noch ein paar Tage festzuhalten. Ich hab mir gedacht, dass ich euch erst mal benachrichtige, weil wir doch schon früher darüber gesprochen haben.“
Den Gedanken des Erwerbs einer Parzelle hatte auch Richard schon oft erwogen, und da er nun die Arbeit verlor, war die Sache spruchreif. Und auch für Richard handelte es sich darum: Wie entrinne ich dieser verdammten Untätigkeit, und wie nütze ich meine Zeit und meine Rente am besten, solange ich noch kann. „Wir fahren morgen raus und sehen uns die Sache an“, schlug er vor. Er sah von einem zum anderen, und zuletzt traf sein Blick Frieda, und als sie erwiderte: „Ich kann doch weder zu- noch abraten“, sagte Richard: „Brauchst du ja auch nicht, wir machen eben einen Ausflug.“
Niemand widersprach. Der alte Reglin meinte mit einem Blick zu Radtke: „Wenn das so ist, wie du sagst, und dass man auf die Art gleich zu Brettern kommt und ohne bares Geld, könnte man meiner Ansicht nach der Sache näher treten.“ Und Frau Reglin machte für sich einen Überschlag über die finanziellen Verhältnisse der Familie Reglin. Richard hatte sich in den letzten Jahren sechshundert Mark gespart, die Alten circa dreihundert aus der „Aufwertung“ für ihre durch die Inflation verlorenen Ersparnisse gerettet. Und für dreihundert Mark war nach dem Bericht Radtkes die ganze Parzelle zu haben, und auf die weitere Frage, ob von dem Stacheldraht noch zu haben wäre, sagte Radtke: „Massenhaft. Er ist nur teilweise ein bisschen angerostet, mit Eisenlack überstrichen ist er wie neu!“
Die Kolonie trug den Namen „Neues Leben“. Die Inhaberin der kleinen Kolonialwarenhandlung, Olga Demel, war eine behände und redselige Frau Ende der Dreißig, schlank, immer elegant, mit Bubikopf und Dauerlocken. Adolf, ihr Sohn, achtzehn Jahre alt, figurierte als die „rechte Hand“ Olgas. Auch ihre Mutter lebte mit den beiden, eine herzleidende, schon recht hinfällig gewordene Frau.
Radtke führte also seine Begleiter zu Olga, und Richard entschloss sich für heiße Würstchen und Bier, ein Vorschlag, der auch bei den anderen Anklang fand, und Radtke erkundigte sich, ob Olga das Eckgrundstück an der Spitze nach dem Bahnhof zu noch nicht verkauft habe. „Noch nicht!“, antwortete Olga. „Sie haben mich doch gebeten, die Parzelle für einen Bekannten von Ihnen zu reservieren, und was ich verspreche, halte ich auch.“ Sie ging in ein kleines Nebengelass, holte den Plan der Siedlung, und tatsächlich war besagtes Eckgrundstück mit einem roten Kreuz vorgemerkt, wenn auch nicht festzustellen war, ob Olga dieses Kreuz nun erst eingezeichnet hatte.
„Also die Herrschaften reflektieren eventuell?“
„Vielleicht Herr Reglin junior …“, antwortete Radtke und deutete auf Richard. Nach allen weiteren Auskünften Olgas gingen die Parzellen weg „wie warme Semmeln“. Kein Wunder. Fünfzehn Minuten von der Bahnstation, Wald, Wasser, wunderbarer Strand.
„Schenken Sie uns noch vier Bier ein, dann wollen wir uns die Sache ansehen“, sagte Richard, und als er die Parzelle angesehen hatte, war er angenehm überrascht. Junge Eichen, Vogelbeerbäume, Birken, Haselnuss und Holunder wucherten wild durcheinander, doch nur auf einem Teil der Parzelle, dazwischen einige hohe Bäume. Der andere Teil bestand aus baumlosem Boden, über einen Spaten tief Humus.
„Ich nehme die Parzelle“, sagte Richard nach kurzer Beratung mit seinen Eltern.
Dann besahen sie sich die Parzelle Radtkes. Sie war kahl bis auf einige hohe Föhren, nach dem See zu etwas abschüssig, schwarze Erde, und Radtke kam sofort wieder ins Erzählen, was er aus dieser Erde herauszuholen gedachte. Natürlich waren da manche „Wenn“ und „Aber“ dabei, doch die Erde lag da, das Wasser daneben, und man sah Radtke an, dass er förmlich danach fieberte, mit der Arbeit zu beginnen. Mit Kennerblicken musterte er den See und prophezeite: „Da drinnen muss es nur so wimmeln von Fischen, jedenfalls ist die Sache hier besser, als in Berlin das Pflaster zu trampeln.“ Dann gingen sie am See entlang, schwenkten ab zur Kolonie „Sandberg“, ein Name, den ein ausgesprochener Galgenvogel aufgebracht haben mag, denn der Boden dieser hügeligen Anhöhe bestand tatsächlich aus reinem Sand. Aber die Parzellen waren billig verkauft worden, eine Mark pro Quadratmeter, fünfzig Pfennig hatte der Grundstücksmakler bezahlt. Innerhalb von wenigen Wochen war der „Sandberg“ aufgesiedelt und die Parzellen verkauft, meist an Arbeitslose. Einige hatten sich bereits primitive Hütten erbaut und sich in ihnen eingerichtet. Auch der Sandberg lag am See, und auch die Sandberger hofften auf Fische und auf die Beeren und Pilze im Wald, und Holz zum Heizen und Kochen gab der Wald auch, und etwas Gemüse wird auch auf dem Sand wachsen, so hofften sie weiter. Als Arbeitsloser hat man ja Zeit, Boden und Seeschlamm heranzuschaffen, und die Sonne und die frische Luft gibt es dazu, also immer noch besser als in den Hinterhöfen der Mietskasernen. Das war so ungefähr die Auskunft des Vorsitzenden des „Siedlervereins Sandberg“, mit dem Radtke und seine Begleiter auf ihrem Spaziergang bekannt wurden, ein Mann in den Dreißigerjahren, Sigrist mit Namen. Er hauste mit seiner Mutter in einem ausrangierten Güterwagen, der kunstgerecht an einem Sandhügel angebaut war. Radtke und Richard berichteten, dass sie sich in „Neues Leben“ angekauft hätten.
„Die Parzellen ,Neues Leben‘ sind natürlich besser“, bemerkte Sigrist, „sie kosten ja auch mehr als das Doppelte.“ Und dann berichtete Sigrist noch: „Die Mehrzahl der bisher dort Angesiedelten sind Deutschnationale und Nazi.“
ZWEITES KAPITEL: Gutgemeinte Ratschläge und ein „verdammter“ Bengel
Freitag darauf wurde der „Apparatebaubetrieb Schwarz“ geschlossen. Die Kollegen fanden sich noch einmal in der unweit davon gelegenen Wirtschaft zu dem schon traditionell gewordenen wöchentlichen Eisbeinessen ein. „Ich bin Gott sei Dank voll unterstützungsberechtigt“, konnte der eine und der andere von sich sagen. Das waren die, die das Glück gehabt hatten, sechsundzwanzig Wochen ununterbrochen beschäftigt gewesen zu sein, und dadurch hatten sie sich Anspruch auf die „Alu“, den vollen Satz Erwerbslosenunterstützung, erworben. Andere, die nur „Krise“, das heißt Krisenunterstützung, zu beanspruchen hatten, also den zweithöchsten Satz, trösteten sich gegenüber denen, die auch aus der „Krise“ ausgesteuert und auf die „Wohlfahrt“ angewiesen waren, und diese wiederum ließen durchblicken, dass sie sich mit irgendeiner Nebenbeschäftigung über Wasser zu halten wüssten. Für die Stimmung dieses letzten Beisammenseins war noch von Bedeutung, dass dieses wöchentliche Eisbeinessen auf Kosten einer gemeinsamen Kasse ging, in die die Beträge flossen, die über den vereinbarten Akkordsatz hinausgingen. Eine Mark und dreißig Pfennige hatten als Höchstsatz pro Stunde verrechnet werden dürfen; wer „über den Zapfen gehauen“, also mehr herausgeschunden, hatte den Überschuss in diese „Eisbeinkasse“ abgeben müssen, und als der Kassierer der Eisbeinkasse nun abrechnete und jedem noch sieben Mark und vierzig Pfennige herauszahlte, sagte Richard: „Und nun Kollegen, bin ich bereit, noch eine Lage und auch noch ein paar Knackwürste und Zigarren zum besten zu geben.“
Natürlich blieben auch die sitzen, die schon vordem immer weggewollt und auf die Abrechnung gedrängt hatten, und als Richard nun von seinem Plan mit seiner Parzelle berichtete, fehlte es nicht an Ermunterungen und zusprechenden Ratschlägen. „Dann kommt dir die Entlassung ja wie gerufen!“, sagte einer. Das war eine Anspielung darauf, dass ihm bei freiwilliger Arbeitsniederlegung keine Erwerbslosenunterstützung gezahlt worden wäre. „Und Familie hast du auch nicht“, stellte ein anderer fest, „da kannst du dir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und lebst wie Gott in Frankreich.“ Wieder ein anderer zog aus dieser Perspektive die Schlussfolgerung: „An deiner Stelle, da könnten sie mir am Arsch lecken.“ Hier sprach deutlich das Bedauern mit, nicht in der glücklichen Lage zu sein wie eben Richard mit seinem Rückensteckschuss und der damit verbundenen Rente. Ein kerngesunder Mensch hatte dieses Bedauern ausgesprochen.
Es hatte geschneit, und es war schlüpfrig glatt; Richard merkte es daran, dass ihm auf dem Weg nach Hause der Stock wegrutschte, und sofort merkte er recht empfindlich die Erschütterung im Kreuz und erkannte auch die Gefahr, die ihm drohte. Er war sonst stets mit der Hochbahn gefahren, aber die Erschütterung und der Schreck hatten ihn so gepackt, dass er stehenblieb und vor Aufregung zitterte. Nun fiel ihm auch ein, dass die Hochbahn um diese Zeit sehr voll war, und um rasch und ohne weiteren Schaden nach Hause zu kommen, winkte er sich eine Autodroschke heran. Der Schmerz im Rücken packte Richard nun mit so elementarer Gewalt, dass er kaum das Stöhnen unterdrücken konnte, und dieser Schmerz strahlte über den ganzen Rücken aus, und Richard wusste sehr wohl, dass ein Rückfall in die des Öfteren auftretende, wie sengendes Feuer peinigende Nervenentzündung im Anzuge war.
Es hieß also wieder einmal still liegen und die Schmerzen ertragen. Die einzige erfolgversprechende Medizin war Wärme und die Frage nach der Ursache dieses Rückfalles überflüssig.
Richard verbat sich auch jeden Besuch, nur Radtke wies er nicht ab, aber es kam kein Gespräch auf. „Hol der Teufel diese Scheißparzelle, mich holt er ja wahrscheinlich auch bald“, wehrte Richard ab.
Einige Tage später jedoch hörte er Friedas Jungen, den Rudi, in der Stube sprechen. „Fix und fertig eingezäunt und mit eiserner Eingangstür und Schloss davor.“