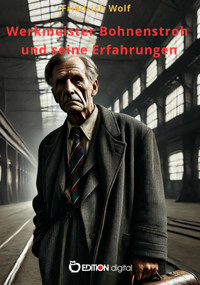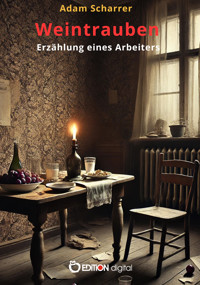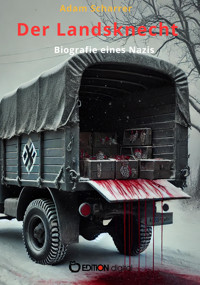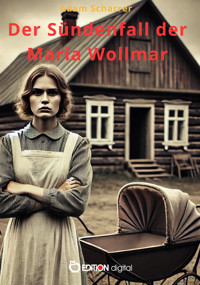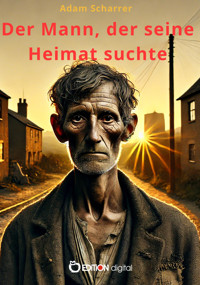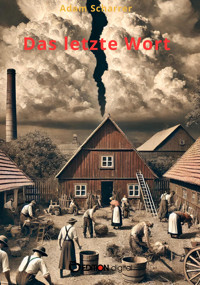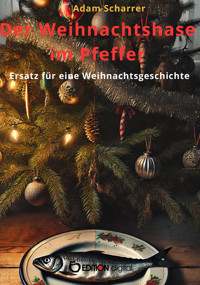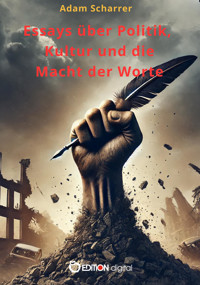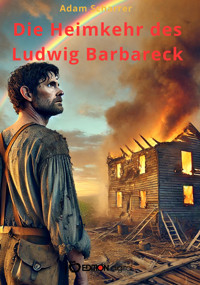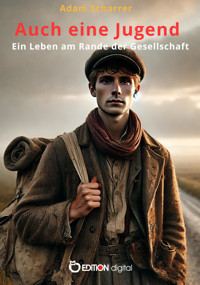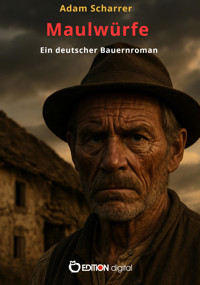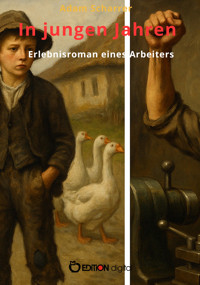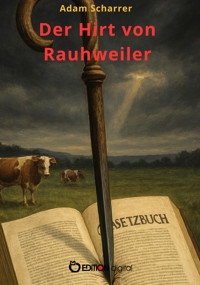8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Armut und Aufbruch, Anpassung und Widerstand – das bewegende Porträt einer Familie im Sturm der Zeit Der Autor erzählt die dramatische Geschichte einer Berliner Arbeiterfamilie in der Weimarer Republik und dem Beginn der NS-Herrschaft. Im Zentrum stehen Erna und Willi Schuhmann – ein Paar zwischen Hoffnung und Härte, Idealen und Alltag. Während Erna für Menschlichkeit, Haltung und Solidarität kämpft, gerät Willi immer tiefer in die Widersprüche seiner Zeit: als Sozialist, als Vater, als Mitläufer in der SA. Adam Scharrer entwirft ein vielstimmiges Gesellschaftspanorama – dicht, ungeschönt und erschütternd aktuell. Er zeigt, wie politische Umbrüche Familien zerreißen, wie Menschen zwischen Anpassung und Widerstand zerrieben werden – und wie schwer es ist, an der eigenen Würde festzuhalten. Ein zeitloser Roman über Mut, Verrat und den täglichen Überlebenskampf in schweren Zeiten. Ein literarisches Zeugnis voller Empathie, Schärfe und Hoffnung – neu zu entdecken für heutige Leserinnen und Leser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Adam Scharrer
Familie Schuhmann
Roman
ISBN 978-3-68912-455-7 (E–Book)
Das Buch erschien erstmals 1939 im Verlag Das Internationale Buch, Moskau.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
I
Außer ihrem Lohn als Waschfrau erhielt Frau Stenzel auch manchmal abgetragene Kleider. Ihr Junge, der Ernst, kam so zu einer warmen Jacke mit Holzknöpfen und breitem Gurt mit Schnalle und Trude zu einem blauen Badeanzug mit weißen Sternen. Für die Jüngste, die Erna, bekam Frau Stenzel eines Tages eine Kinderbettstelle, weiß angestrichen und innen mit lila Stoff ausgeschlagen.
Da nur noch wenig Platz in der Stube war, stellte Frau Stenzel die Bettstelle in Vaters „Ecke“ und rückte den Schreibtisch zwischen Sofa und Fenster. Stenzel ließ jedoch für diese Ummöblierung keinerlei Gründe gelten. „Weg da mit den Klamotten!“, protestierte er und trat mit dem Fuß die Seitenwand der Bettstelle durch. Der lila Stoff ging in Fetzen. Erna saß stumm und erschrocken auf dem Sofa, während die Eltern laut miteinander zankten. Plötzlich schlug der Vater die Mutter ins Gesicht. Erna schrie verzweifelt los und hängte sich an den Rock der Mutter, Stenzel ging wieder fort und warf die Tür krachend hinter sich zu.
Mutter setzte sich auf das Sofa und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Erna hatte ihre Mutter noch nie weinen sehen. Eine nie gekannte Angst um die Mutter packte sie. „Weißt du was, Mutter“, sagte sie, „wir suchen uns eine andere Wohnung und ziehen heimlich hin und sagen Vater nicht, wo wir wohnen, und bleiben ganz allein für uns!“
„Der findet uns doch, mein Kind!“, antwortete die Mutter. Dann stellte sie die Bettstelle auf den Boden und räumte Vaters „Ecke“ wieder zurecht. Dort stand sein Schreibtisch, darauf ein Schreibzeug, ein Löscher, ein Briefbeschwerer, auf einem Ständer ein mit Messing beschlagenes Ochsenhorn: eine Prämie des Skatvereins. An der Wand hingen Bilder vom Athletenbund und von Vaters Militärzeit. Auf einem großen Bild waren Soldaten mit bunten, an Stöcken flatternden Bändern zu sehen. Zwei Soldaten lagen, den Kopf auf die Hand gestützt, der eine rechts, der andere links, neben einem Bierfass. Der linke war Stenzel. Darunter ein Spruch:
Was winkt so freundlich in der Ferne?
Das liebe teure Vaterhaus!
Ich war Soldat und war es gerne,
Doch jetzt ist meine Dienstzeit aus.
Drum, Brüder, trinkt, stoßt die Gläser an,
Es lebe der Reservemann,
Der treu gedient hat seine Zeit,
Dem sei ein volles Glas geweiht!
Erna musste weiterhin auf dem schmalen Sofa schlafen, dessen Sitz nach vorn schräg abfiel. Es war Winter, manchmal erwachte sie steif und kalt, denn wenn sie sich im Schlaf umdrehte, fielen die Decken auf die Erde. Ernst und Trude schliefen in dem einen, Vater und Mutter in den beiden anderen Betten. Nur wenn Vater nachts nicht nach Hause kam, durfte Erna bei Mutter schlafen. Einmal blieb er sechs Wochen fort. Er saß im Gefängnis wegen einer Messerstecherei.
II
Trude, nun dreizehn Jahre alt, war bei einem Räucherwarengeschäft als Kindermädchen angekommen. Sie bekam Mittag- und Abendbrot und wöchentlich eine Mark. Ernst machte manchmal Besorgungen für einen Schlächtermeister. Dafür bekam er immer ein Stück Wurst. Grund genug für Ernst, nach Schulschluss regelmäßig zu fragen, ob seine Hilfe gebraucht würde. War das nicht der Fall, blieb Ernst in der Nähe, damit ihm kein anderer Junge einen Auftrag wegschnappte. Es dauerte nicht lange, da hatten der Meister und die Meisterin sich an sein pünktliches Erscheinen gewöhnt. Ernst half, wo es zu helfen gab. Sein Lohn war täglich ein Paket Wurstreste und wöchentlich fünfzig Pfennig.
Erna musste nach Schulschluss ihre Schwester Else warten, die inzwischen angekommen war. Vormittags besorgte das die Nachbarin, Frau Schirrmacher, ihr Mann war Schneider. Er war zwanzig Jahre älter als die Frau, schon über siebzig. Für neue Sachen bekam er keine Aufträge mehr. Er wendete und flickte. Die Leute hatten Mühe, die Miete für die Wohnung aufzubringen, und waren für Wurst und Räucherwaren gern gefällig. Frau Schirrmacher wärmte für Erna und für Else das Essen und schnitt ihnen Brot. „Großvater“ saß mit gekreuzten Beinen auf dem Tisch, nähte und machte Späße. Die Kinder störten ihn nicht, denn er war schwerhörig.
Als Stenzel bei den Pflasterern arbeitete, musste Erna ihm das Essen hinbringen. Wenn sie bis zwölf Uhr Schulunterricht hatte, musste sie schnell laufen, damit Stenzel noch vor ein Uhr essen konnte. In der Mittagspause lagen die Pflasterer und Stampfer abseits der Straße im Schatten eines Baumes. Stenzel war der einzige, dem das Mittagessen gebracht wurde. Die andern aßen ihr Mittagbrot nach Feierabend.
„Deine Olle meint es aber gut mit dir!“, sagte eines Tages ein Kollege. „Immer Wurst auf dem Brot und Fleisch im Essen; wie macht die denn das?“
„Was der Mensch braucht, muss er haben!“, antwortete Stenzel gewichtig. „Und die Gören lungern sowieso den ganzen Tag rum, wär noch schöner, wenn sie nicht mal Essen tragen wollten.“ Stenzel las beim Essen in der Rennzeitung und trank dazu zwei Flaschen Bier.
Der Sonnabend war Lohntag. Stenzel kam meistens spät nach Hause, manchmal erst am Sonntag, einmal erst am Montag. Er setzte sich an den Tisch und fragte: „Ist noch was zu essen da?“
„Nein“, antwortete Frau Stenzel. „Die Kinder haben es aufgegessen, es wird ja sonst sauer.“
Stenzel ging aus der Küche in die Stube. Nach einer Weile kam er wieder zurück und sagte: „Borg mir mal drei Mark bis morgen.“
„Ich hab kein Geld!“
„Borg mir drei Mark. Ich hab Krach gehabt mit dem Meister, hab noch drei Tage Lohn zu bekommen. Ich hab die drei Mark auf Ehrenwort geborgt. Übermorgen arbeite ich bei einem andern Meister.“
So sprach er immer, wenn er wieder nüchtern war. Dann schämte er sich und log. Vielleicht hatte er „auf Ehrenwort“ in der Gastwirtschaft anschreiben lassen oder beim Skat verloren und wollte nun zeigen, dass er ein „Ehrenmann“ sei.
„Ich hab kein Geld!“, beteuerte Frau Stenzel von neuem. „Ich hatte zu tun, dass ich die Miete zusammenkriegte. Sonnabend habe ich die letzten fünf Mark für den vorigen Monat bezahlt.“
Stenzel ging wieder in die Stube. Er suchte nach den Sparkassen der Kinder. Die Sparbüchsen hatte jedoch Frau Schirrmacher in Verwahrung. Nach einer Weile kam er wieder zurück und fragte drohend: „Du willst mir kein Geld geben?“
„Ich hab nichts!“
Stenzel ging zu Schirrmacher. Dort waren Ernst, Erna und Else. Dort waren sie immer, wenn ihr Vater betrunken nach Hause kam. Auch heute hatte Mutter das befürchtet und sie hinübergeschickt. Sie sahen neugierig auf ihren Vater. Er hatte schon oft im Rausch Frau Schirrmacher laut beschimpft, weil sie immer der Mutter beigestanden hatte. Schirrmachers waren daher erstaunt über den Besuch.
„Ich komme euch um eine Gefälligkeit bitten, Nachbarn“, sagte Stenzel unvermittelt. „Könntet ihr mir bis morgen mit drei Mark aushelfen?“
Frau Schirrmacher überlegte. Wenn Frau Stenzel Geld von ihr wollte, wäre sie selbst gekommen. „Das geht wirklich nicht!“, sagte Frau Schirrmacher langsam. „Wir sind ja immer selbst so knapp.“
Stenzel sah schweigend in das spitze Gesicht der Frau. Die Kinder waren so leise, als hielten sie den Atem an. Der taube Schirrmacher schob nichts ahnend eine Prise Tabak in die Nase und nieste kräftig.
„Na, dann nichts für ungut!“ Stenzel ging. Als er aus der Tür war, rief er Ernst. „Willst du Vater einen Gefallen tun?“
„Was denn?“, fragte Ernst verwirrt.
„Gib mir drei Mark von deinem Spargeld, du kriegst sie morgen wieder.“
Stenzel hatte auch früher stets versprochen, das Geld gleich wieder zurückzulegen. Es waren einmal zwei Mark fünfundsiebzig, das andere Mal sechs Mark dreißig. Fünf Mark davon hatte Ernst von der Fleischermeisterin zum Geburtstag erhalten. Von dem Geld wollte er sich Schaftstiefel kaufen, wie sie die Fleischergesellen trugen. Nun hatte er wieder eine Mark achtzig in der Sparbüchse.
„Gib schon her! Kriegst es doch wieder! Hast sie wohl versteckt, die Büchse?“ Da öffnete die Mutter die Tür und sagte: „Das Geld von Ernst ist auch für die Miete draufgegangen.“
Stenzel schlug die Tür krachend ins Schloss. „Geld her!“, brüllte er dann Ernst an, „sonst wackelt die Wand!“
Nun ging die Tür gegenüber auf. Dort wohnte ein Metallarbeiter, der in Wechselschicht arbeitete und nicht gut auf Stenzel zu sprechen war, weil der schon öfters solchen Krach gemacht hatte, dass er nicht schlafen konnte. „Was ist denn los?“, fragte der Metallarbeiter.
Stenzel drehte sich um und machte einen Sprung auf den Mann zu. Der schlug die Tür zu und verschloss sie. Stenzel trommelte mit der Faust dagegen und schrie: „Mach doch mal auf, du hässlicher Zwerg, damit ich dir zeigen kann, was los ist. Wollte es dir schon immer mal zeigen!“
Schirrmachers schlossen ab. Frau Stenzel öffnete noch einmal leise, sah wie Ernst die Treppe hinunterlief, und schloss ebenfalls zu. Stenzel hörte es. Er warf sich mit seinem vollen Gewicht gegen die Tür. „Warte, Dreckbengel!“, schrie er. „Dir werde ich Respekt vor deinem Vater beibringen!“ Er dachte, Ernst sei bei der Mutter in der Stube.
Ernst stand im Hof. Die Mutter schrie ihm zu: „Lauf zur Polizei!“
Einige Nachbarn liefen zum Hauswirt. Der kam mit seinem Hund, noch bevor Stenzel die Tür eingebrochen hatte.
„Weg da!“, schrie der Hauswirt. „Sonst …“ Er bückte sich, um seinen Hund loszumachen.
„Na, das wollen wir doch erst mal sehen!“, höhnte Stenzel und wollte sich wieder gegen die Tür werfen.
Da ließ der Hauswirt seinen Hund los. Der sprang Stenzel in wilder Unbändigkeit an die Brust. Stenzel schlug schwer hintenüber. Mit dem Kopf auf den Fußboden. Der Hauswirt rief den Hund zurück. Als dieser den Kopf drehte, schnellte Stenzel hoch, packte den Hund mit beiden Händen um den Hals und suchte ihn zu erwürgen. Doch er täuschte sich in der Kraft und Gewandtheit des Hundes. Der wand sich in den Händen Stenzels wie ein schlüpfriger Fisch und erwischte ihn am Oberschenkel. Der Hauswirt musste den Hund wegreißen. Als die Polizei kam, stand Stenzel mit entblößtem Hintern da.
„Kommen Sie bitte einen Augenblick in meine Wohnung“, sagte Stenzel. „Es wird sich sofort alles aufklären. Ich bin derjenige, der Strafantrag stellen wird. Niemand anders als ich, meine Herren! Was ich mit meiner Familie abzumachen habe, geht andere Leute gar nichts an. Hunde auf Menschen hetzen ohne jeden Grund, na, das wollen wir doch erst mal sehen! Das soll Ihnen teuer zu stehen kommen, Herr …!“
Frau Stenzel hatte unterdessen aufgeschlossen. Die Polizisten und Stenzel gingen in die Wohnung. „Ziehen Sie sich um und kommen Sie mit!“, sagte der Wachtmeister barsch.
Stenzel versuchte einzulenken. „Nun sag mal, Mutter, ist so was nicht zum Verrücktwerden?“
„Reden Sie nicht! Alles Weitere wird sich finden!“
Frau Stenzel wusch ihrem Mann die Wunde am Schenkel aus und verband sie. Dann holte sie Wäsche und einen sauberen Anzug. Als Stenzel gehen musste, gab er seiner Frau die Hand und sagte: „Brauchst keine Angst haben, Mutter, ich komm bald wieder.“
Frau Stenzel bat den Hauswirt, die Wohnung behalten zu dürfen, doch er blieb unerbittlich.
Da Stenzel in der Gegend als gewalttätig bekannt war, bekam Frau Stenzel auch in der Nähe keine Wohnung. Wenn sie in eine andere Gegend zögen, wären Trude und Ernst weitab von ihren Arbeitsstellen. Frau Stenzel hatte ebenfalls einige Arbeitsstellen in der Nähe. Auch Frau Schirrmacher würden sie vermissen.
Sie musste trotzdem auf die Suche nach einer Wohnung gehen. „Wie viel Kinder haben Sie?“, war die erste Frage.
„Vier“, sagte Frau Stenzel. Das fünfte trug sie im Leib.
„Tut mir leid, liebe Frau! An Leute mit soviel Kindern kann ich nicht vermieten.“
Eine dunkle Hofwohnung in einer verrufenen Straße am Schlesischen Bahnhof blieb als letzte Hoffnung. Aber nun verlangte der Hauswirt die Unterschrift beider Ehegatten. Frau Stenzel war überzeugt: es wird auch mit dieser Wohnung nichts, wenn sie sagt, wo ihr Mann ist. „Behalten Sie Ihre Dreckwohnung“, sagte sie und ging nach Hause.
Am andern Tag erhielt sie eine Vorladung zur Kriminalpolizei. Dort erfuhr sie, dass es diesmal lange dauern werde, bis ihr Mann zurückkehren würde. Er hatte auf der Wache die Beamten tätlich angegriffen. Vier Mann hatten zu tun gehabt, um ihn zu bändigen. Nun lag er im Gefängnislazarett. Die Anklage lautete auf Sachbeschädigung, Bedrohung, Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. „Wie viel kann er denn kriegen, Herr Kriminalkommissar?“, fragte Frau Stenzel schüchtern.
„Schwer zu sagen. Er hat schon ein paar Vorstrafen. Einige Monate fallen sicher ab. Vielleicht auch einige Jahre.“
Frau Stenzel ging erneut zum Hauswirt und bat um Aufhebung der Kündigung. Er willigte jetzt ein. „Nur Ihnen zuliebe! Aber Ihr Mann darf nicht mehr ins Haus!“
Diese Drohung erwies sich jedoch als unnötig. Dem zu sieben Monaten verurteilten Gelegenheitsarbeiter Emil Stenzel wurden nach Ausbruch des Krieges durch kaiserliche Amnestie drei Monate seiner Strafe erlassen. An einem grauen Herbsttag verließ er das Gefängnis mit der Weisung, sich binnen achtundvierzig Stunden bei dem zuständigen Regiment zu melden.
Frau Stenzel war fort; sie wusch. In der Stube waren Erna, Else und Reinhold, der jüngste Bruder, zwei Monate alt. Erna machte für ihn die Flasche zurecht. Dann fragte Erna verlegen: „Soll ich dir Kaffee kochen, Vater?“
„Ja“, antwortete Stenzel mit heiserer Stimme und gab Erna zwei Groschen für Semmeln. Als die Mutter nach Hause kam, saßen sie zusammen am Tisch. Am andern Tag fuhr Stenzel zu seinem Regiment. Er ermahnte die Kinder, artig zu sein, der Mutter zu gehorchen und zu helfen. Als Erna eine Weile später die Mutter mit nassen Augen vor dem großen Reservistenbild Vaters stehen sah, fragte sie: „Kommt denn Vater bald wieder?“
„So bald wird er nicht wiederkommen“, seufzte die Mutter.
„Dann brauchst du doch nicht zu weinen!“, sagte Erna.
III
Erna wurde zur Unterstützung der Pflegeschwester für eine geisteskranke Frau verdingt. Der Mann dieser Frau war den Heldentod gestorben. Erna musste bei der Arbeit in den Zimmern stets darauf achten, bei einem Anfall der Kranken rechtzeitig den Klingelknopf zu erreichen. Die Türen durften nicht verschlossen werden, sonst bekam die Kranke Tobsuchtsanfälle und zertrümmerte alles Erreichbare. Wie ein Gespenst ging sie von einem Zimmer ins andere, saß oft stundenlang still und grübelte vor sich hin. Sie war von dem Wahn befallen, sie würde gewaltsam von ihrem Mann ferngehalten.
Eines Tages war die Kranke an einer Wäscheleine in den Hof geklettert. Nur durch die Drohung, dass sie wieder in eine Anstalt käme, war sie zur Rückkehr in die Wohnung zu bewegen. Still und scheu kauerte sie sich in eine Zimmerecke. „Kein Wagen soll kommen! Kein Wagen!“, flehte sie. Aber einige Tage später kam der Wagen doch wieder. Die Kranke hatte sich am Kronleuchter mit einer Gardinenschnur zu erhängen versucht. Doch die Last war zu schwer gewesen. Der Kronleuchter war krachend zu Boden gesaust.
Erna suchte sich eine Stellung als Zimmermädchen in einer Pension. Sie hatte von sechs bis neun Uhr morgens die Korridore und die Toiletten in vier Etagen, von neun bis drei Uhr nachmittags vierundzwanzig Zimmer zu reinigen, von drei bis sieben Uhr abends ein Dutzend oder noch mehr Bäder zu richten. Vor zehn Uhr abends waren die Mädchen selten mit dem Geschirrwaschen fertig.
Als Stenzel aus dem Krieg heimkehrte, arbeitete Erna bei einem Bäckermeister in der Nähe der elterlichen Wohnung. Diese Stellung hatte den Vorteil, dass Erna außer ihrem Lohn manches liegengebliebene Brot oder manches Stück Kuchen für Mutter und Else bekam. Trude war nun schon verheiratet. Ernst arbeitete in einem Hotel als Hausknecht. Der kleine Reinhold war an Diphtherie gestorben.
An einem Sonntagnachmittag fand Erna die Mutter verstört auf dem alten Sofa in der Küche. Stenzel hatte Ernas Bettwäsche, die von Mutter verwahrt wurde, ins Leihhaus getragen und die Pfandscheine verkauft. Erna ging trotz der Warnung der Mutter in die Stube. Stenzel stand vor dem Spiegel, die schon dünnen, grauen Haare sorgfältig gescheitelt, den Bart unternehmungslustig nach oben gedreht, im Begriff, einen hellfarbenen Binder um den Kragen zu knüpfen.
„Schuft!“, sagte Erna und machte die Tür wieder zu.
Stenzel stürzte aus der Stube und schlug auf Erna ein, bis sie sich nicht mehr erheben konnte. Sie musste in ein Krankenhaus überführt werden.
Eines Tages, während der Besuchsstunde, sagte die Mutter zu Erna: „Ich soll Grüße bestellen von Willi Schuhmann.“
„Von Willi?“, fragte Erna nachdenklich. Die Familie Schuhmann wohnte im Vorderhaus. Willi und Erna kannten sich schon viele Jahre. Willis Vater war Angestellter in der Konsumgenossenschaft. Wenn Willi Erna in der letzten Zeit auf der Straße oder auf der Treppe oder im Bäckerladen gesehen, hatte er immer tief seinen Hut gezogen. Auch Ernas Mutter war das Interesse Willis an Erna aufgefallen. „Er hat schon oft nach dir gefragt“, fuhr die Mutter fort. „Er ist überhaupt ein sehr anständiger Mensch.“
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wohnte Erna bei ihrer Schwester Trude. Dort besuchte Willi sie. Sie gingen im Park spazieren. Willi fragte Erna, wie es ihr ginge.
„Es wäre vielleicht besser gewesen, ich wäre gestorben.“
„So etwas dürfen Sie doch nicht denken!“ Willi blieb erschrocken stehen. „Sie sind doch jung, haben das Leben noch vor sich!“ Die Blumen blühten, die Bäume standen in vollem Grün, die Sonne spielte verschwenderisch mit den sommerlichen Farben. „Das Leben kann sehr schön sein“, fuhr Willi fort, „wenn man nur versteht, richtig zu leben!“ Er bot Erna seinen Arm, um ihr das Gehen zu erleichtern. In einem Sommerlokal tranken sie Kaffee.
Langsam gingen sie zurück. Willi machte bedächtige, kurze Schritte und sprach von seiner Arbeit und von seinen Plänen.
Er hatte Kaufmann gelernt und war durch Vermittlung seines Vaters bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin angestellt worden. Der Dienst sei zwar nicht leicht, erzählte er, kranke Menschen wären meist in schlechter Stimmung und geneigt, die Beamten für unerfüllte, ja für unerfüllbare Wünsche verantwortlich zu machen; aber man könne durch Höflichkeit und Korrektheit bei vielen Kranken ein eingefleischtes Vorurteil beseitigen. Die Patienten seien zu fünfundsiebzig Prozent immer dieselben.
Erschütternd sei, wie viele Menschen geschlechtskrank seien, auch Frauen und junge Mädchen. Dabei sähe diesen oft hübschen, vornehm aussehenden jungen Mädchen niemand an, mit welch schrecklicher Krankheit sie behaftet seien. Er sei aus diesem Grunde Frauen gegenüber immer sehr zurückhaltend gewesen, obgleich ihn das Junggesellenleben nicht mehr befriedige.
Dann erzählte Willi, dass er eigentlich gekommen sei, um Erna zu fragen, ob sie nach ihrer Genesung als Hilfe zu seiner Mutter kommen wolle. Die Arbeit in der Wohnung und im Garten würde zu viel für seine Mutter.
Erna willigte ein. Willi holte sie ab. Ernas Mutter kam mit. Sie fuhren mit dem Autobus. An einer der Laubenstraßen vor Baumschulenweg warteten Willis Eltern. Unter dem Fliederbaum war der Abendbrottisch gedeckt. Eine Stunde später verabschiedete sich Ernas Mutter. Erna begleitete sie bis an die Straße.
„Gute Nacht, Mutter!“
„Gute Nacht, Erna. Erhol dich gut!“
Willi und Schuhmann gingen früh zu Bett. „Sie müssen früh wieder raus“, meinte Frau Schuhmann. Die Betten der Männer standen hintereinander an der rechten Wand in der vorderen Stube der Laube. Davor hing ein Vorhang.
Frau Schuhmann nahm die Asche aus dem Herd, legte Papier hinein, obenauf Kleinholz, damit sie am Morgen rasch Feuer hätte. Dann stellte sie den Wecker und fragte: „Wollen wir noch ein bisschen frische Luft schöpfen, Erna?“
„Gern“, sagte Erna. Im Laubengelände brannten nur noch wenige Lichter. Dahinter lag die Großstadt mit ihrem ununterbrochenen Trubel.
Die Sterne hingen tief am mattblauen Himmel. Von nebenan her, aus der Sommerlaube, hörte man das Flüstern eines Liebespaares. Die Wärme stand unbewegt in den Hecken.
Nach Frau Schuhmanns Mitteilungen gab es für Erna Arbeit genug. Die Wohnung in der Stadt bestand aus drei Zimmern und Küche. Die Männer konnten nicht viel helfen, sie waren nach Feierabend oft in Sitzungen oder in Versammlungen, und wenn sie zu Hause waren, saßen sie vielfach über einer schriftlichen Arbeit für die Partei oder für die Gewerkschaft. Nun, im Sommer, wo ein doppelter Haushalt notwendig wurde, hatte es Frau Schuhmann doppelt schwer. Der Alte konnte nicht jeden Tag in die Laube kommen. Er wollte dann im Restaurant essen, aber Frau Schuhmann wusste, dass es ihm nicht schmeckte. Sie brachte ihm dann Essen in die Wohnung. Das war für sie sehr ermüdend. Sie war schon über die fünfzig. Ihre Krampfadern waren schon zweimal geplatzt.
„Na, habt ihr euch vertragen?“, fragte Willi, als er am andern Tag von der Arbeit kam. Er sah lächelnd von Mutter auf Erna. „Ich weiß nicht, ob ich Ärger gemacht habe“, antwortete Erna.
Schuhmann schwitzte. „Verfluchte Hitze!“, schimpfte er. „Da kommt man ja rein aus der Puste!“ Er setzte sich schwer auf die Bank unter dem Fliederbaum vor der Tür. Frau Schuhmann brachte ihm ein Glas Buttermilch. „Trink aber langsam, ich hab sie aus dem Keller geholt.“ Er trank mit Behagen. „Wenn man nur zu Hause bleiben könnte“, stöhnte er, „wäre ja alles halb so schlimm.“
„Müsst ihr denn heute wieder fort?“, fragte Frau Schuhmann.
„Ja, leider.“
Nach dem Essen legten die Männer sich kurze Zeit aufs Bett, dann gingen sie wieder.
IV
An manchen Tagen schliefen Willis Eltern in der Stadtwohnung. Willi hantierte im Garten an einem mit Erde überdeckten und von allerhand Pflanzen überwachsenen Steinberg. Das sei sein „Alpinum“, sagte er und nannte Erna die Namen aller dieser Pflanzen und Disteln. Die meisten dieser Namen waren lateinisch. Willi hatte einige Hefte, in denen die Pflanzen abgebildet und die Namen darunter gedruckt waren. Er und Erna setzten sich auf die Bank unter dem Fliederbaum. Bald lag der Tisch voller Hefte und Bücher. Mit großem Respekt vor so viel Wissen hörte Erna zu.
An einem Sonnabend brachte Willi zum Kaffee Kuchen und Schlagsahne mit. Dann las er Erna aus einem Buche vor: eine Liebesgeschichte. Er vermied es, Erna dabei anzusehen. Als er geendet hatte, fragte er sie, ob sie richtig verstanden hätte.
Sie schwieg verlegen.
Er machte ein feierliches Gesicht. Dann sagte er, er habe Erna lieb, und er habe ihr die Stelle vorgelesen, weil auch die Männer und Frauen aus der Arbeiterschaft ein besseres Verhältnis zueinander finden müssten, als dies sehr oft der Fall sei. Er wünsche sich eine Frau, die ihm ein treuer Kamerad sein werde. Gerade Erna dürfte verstehen, dass ein unbedachter Schritt ein ganzes Leben zur Hölle machen könne, sie brauche nur an die Ehe ihrer Eltern und ihre Kindheit zu denken. Dann erklärte er Erna, dass die Ehe, und das menschliche Leben überhaupt, einem höheren Zweck dienen müsse: dem der Befreiung der Menschheit. Wohl wisse Erna noch wenig von der Idee des Sozialismus, aber er wolle ihr helfen, sie zu begreifen. Nur wenn Mann und Frau für eine über der Person stehende Sache lebten und kämpften, bekäme das Leben einen Sinn. „Würdest du mir ein solcher Kamerad sein wollen, Erna?“, schloss Willi. Er sah sie erwartungsvoll an und legte seine Hand auf die ihre.
„Ich weiß nicht, ob ich es kann“, sagte Erna.
„Möchtest du es mit mir versuchen?“
Erna löste ihre Hand aus der Willis. „Ans Heiraten habe ich noch gar nicht gedacht.“
„Ich habe auch nicht erwartet, dass du es so leichtnimmst. Aber bereuen, glaube ich, wirst du es nicht, Erna!“
… Ernas Mutter kränkelte. Sie klagte über Magenbeschwerden und magerte schrecklich ab. Der Arzt schrieb genaue Diät vor, doch im Lande herrschte der Hunger. Das deutsche Geld zerrann durch seine Entwertung in nichts. Ein Brot kostete heute ein Million Mark, morgen zwei, übermorgen fünf Millionen, eine Woche später eine Milliarde.
Stenzel wurde wieder einmal verhaftet. Bei einer Haussuchung waren in seinem Schreibtisch Pfandscheine auf Ringe und eine Damenuhr gefunden worden. „Wahrscheinlich handelt es sich um gestohlene Sachen“, meinte die Mutter.
Erna saß ratlos auf dem Stuhl. Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Willi könnte vielleicht helfen. Er müsste ein Gesuch an das Wohlfahrtsamt schreiben oder selbst hingehen. „Lass nur den Kopf nicht hängen“, ermunterte Erna. „Ich werde mit Willi reden. Morgen früh komme ich wieder.“
„Belästige Willi nicht mit solchen Sachen“, bat die Mutter. „Ich komme schon durch. Ich werde die große Stube vermieten … Wie steht es denn mit euch beiden?“, fragte sie dann.
„Mit uns beiden? Das hat noch Zeit. Ich weiß es noch nicht.“
„Aber Willi – hat er dir noch nichts gesagt?“
„Lass doch das, Mutter!“
Doch die Mutter blieb hartnäckig. „Sei nicht dumm, Mädel. Auch ich war einmal jung, und ich habe nur deinen Vater geliebt, nur ihn, alles hätte ich für ihn gegeben, habe es ja auch gegeben.“ Mutter hustete trocken. „Aber von der Liebe kann man nicht leben. An der leeren Krippe schlagen sich die Pferde!“
Als Erna nach Hause ging, kam Willi ihr entgegen. Er erklärte sich sofort bereit, ihrer Mutter bei den Behörden zu helfen. „Ich werde auch mit meinen Eltern sprechen. Wir haben sicher noch etwas Vorrat. Vielleicht kann Vater auch aus dem Konsumverein noch etwas beschaffen. Es dreht sich ja um einen Ausnahmefall.“
Sie gingen auf der menschenleeren Landstraße weiter. „Sonst willst du nichts mit mir besprechen, Erna?“, fragte Willi nach einer Weile.
Erna sah zu Boden und schwieg.
Willi drückte sie an sich und küsste sie.
Zweites Kapitel
I
Ernas Mutter starb an Magenkrebs. Else arbeitete als Anlegerin in einer Zeitungsdruckerei und wohnte bei Trude. Willi und Erna heirateten. Das Geld war wieder wertbeständig geworden. Willis Monatsgehalt betrug dreihundert Mark. Sie mieteten eine Wohnung in der Harnerstraße.
Die neue Wohnung lag im Vorderhaus in der dritten Etage. Sie bestand aus zwei Zimmern, einer Küche, einer Mädchenkammer, einer Speisekammer, einem Badezimmer und einem Balkon. Am Korridor lag eine Kammer zur Aufbewahrung von Holz und Kohlen. Fußboden und Wände waren neu und glatt. Die Reinigung machte wenig Mühe. Keller- und Bodenräume waren hell und luftig.
An Werktagen stand Willi morgens um halb sieben auf, badete, machte einige Freiübungen, dann frühstückten sie gemeinsam. Punkt halb acht ging Willi aus der Wohnung, um drei Viertel acht war er im Büro. Er stellte sein Frühstück ordnungsgemäß in seinen Schrank. Dort standen auch gemahlener Bohnenkaffee, Kakao, kondensierte Milch, Zucker, einige Teller und ein Essbesteck. Dann zog Willi seine Arbeitsjacke an, setzte sich auf seinen Sessel und machte sich flüchtig mit den Neuigkeiten der Zeitung vertraut. Er ging nie von seinem Arbeitstisch, ohne ihn sorgfältig aufzuräumen, und fand ihn daher am Morgen sauber und ordentlich vor. Punkt acht Uhr öffnete Willi seinen Schalter. Dreißig Minuten nach vier Uhr nachmittags kam er nach Hause. Um dieselbe Zeit war Erna mit dem Decken des Mittagstisches fertig. Nach dem Essen schlief Willi eine Stunde, und Erna wusch während dieser Zeit das Geschirr. Wenn Willi aufstand, war wieder alles in Ordnung. Dann tranken sie Kaffee, und für abends hatte Willi meistens etwas auf dem Kalender vorgemerkt. Sie gingen zu Willis Eltern oder in die Parteiversammlung, oder Willi ging allein in eine Funktionärversammlung. Sie waren auch Mitglieder der „Volksbühne“. Manchmal gingen sie in ein Kino. Am meisten interessierte sich Willi für Filme, die über Natur- und Völkerkunde berichteten und in der „Sternwarte“ gezeigt wurden. Im Sommer verbrachten sie ihre Sonntage meistens im Laubengarten der Eltern. Nur selten fuhren sie ins Freie. Willi scheute das Gedränge und den Staub.
II
Im Hause selbst unterhielten sie wenig Bekanntschaft. In der Wohnung gegenüber wohnten der Lokomotivführer Kottke und seine Familie: Frau und zwei Kinder. Die Leute waren aus dem Rheinland, wortkarg und streng katholisch. In der nur aus Zimmer und Küche bestehenden Mittelwohnung wohnte Familie Weihäugel. Der Mann war Hilfsschlosser in einer Werkstatt der Berliner Verkehrsgesellschaft. Seine Frau erzählte von ihm, dass er früher jeden Groschen versoffen hätte. Jahrelang hätte er das so getrieben, hätte Frau und Kinder völlig vernachlässigt, misshandelt, es sei einfach nicht mehr zum Aushalten gewesen. Bis sie auf den rettenden Gedanken gekommen sei, es mit dem „Blauen Kreuz“ zu versuchen. Und das sei ihr dann Gott sei Dank auch gelungen. Nach jedem Rausch hätte ihr Mann nämlich stets einen furchtbaren Katzenjammer bekommen, und in diesem Zustand habe sie ihn einmal ins „Blaue Kreuz“ geschleppt. Seitdem besitze sie ein wahres Muster von Ehemann. Diese Geschichte erzählte Frau Weihäugel immer und immer wieder. Sie war aus Altenburg in Sachsen, und ihre Stimme plätscherte so behäbig in der gemütlichen Breite des sächsischen Dialekts, dass Erna Angst bekam, wenn Frau Weihäugel an die Tür klopfte. Die Frau wartete auch gar nicht ab, bis Erna ihr einen Stuhl anbot. Sie setzte sich unaufgefordert, und ob sie nun darüber berichtete, was sie gekocht hatte oder kochen wollte, was sie gekauft hatte oder kaufen wollte, was ihr an Klatschgeschichten im Haus zu Ohren gekommen war, immer wieder kam sie zu dem Schluss: „Wenn ich so dran denke, Frau Schuhmann, was ich und die Kinder früher durchgemacht haben, na, ich kann nur sagen, es ist sehr schade, dass das ,Blaue Kreuz’ nicht mehr unter der Bevölkerung bekannt ist. Wenn die Regierung diese Einrichtung mehr unterstützen würde, ein gutes Werk täte sie. Viel Elend könnte sie aus der Welt schaffen. Die ganzen Parteien, kann ich Ihnen sagen, und die ganzen Vereine, wie sie auch heißen mögen, was helfen die schon! Dass ich heute mit meinem Mann so gut lebe, haben wir nur dem ‚Blauen Kreuz’ zu verdanken.“
Frau Weihäugel war fünfunddreißig Jahre alt, mittelgroß. Ihre Brüste und Arme drohten bei jeder Bewegung die Bluse zu sprengen, und ihr pausbackiges Gesicht glühte immer wie im Fieber. Der Lohn des Mannes war wohl bescheiden, doch Frau Weihäugel berichtete stolz, dass sie von ihren Eltern gut unterstützt würden. Mit Kartoffeln und Obst würden sie vollständig versorgt, nur die Fracht müssten sie bezahlen. Vier Kinder seien sie gewesen, zwei Brüder seien aber im Krieg gefallen, und der jüngste sei erst zwanzig. Butter und Schmalz erhalte sie auch öfter. Im Herbst, wenn die Eltern schlachteten, auch etwas Wurst und Fleisch. In diesem Jahr hätten die Eltern sogar ein kleines Schweinchen für sie gekauft und hätten geschrieben, dass sie es bis zum Herbst füttern wollten, nur einige Zentner Kleie wollten sie bezahlt haben. „Na, und das rechnet schon mit!“, sagte Frau Weihäugel gewichtig. „Ganz gut geht es uns jetzt, und ich bin Gott sei Dank so eine Natur, bei mir schlägt alles an, auch wenn ich bloß Pellkartoffeln und einen Heringsschwanz habe.“
III
Eine Treppe tiefer wohnten der Gerichtsvollzieher Liebenfeld, der Maler Wingering und der Gewürzreisende Sand. Sand grüßte stets sehr höflich, und aus seinem Gesicht sprach immer die gleiche Freundlichkeit eines Kellners. Er ging sorgfältig angezogen, ein wenig stutzerhaft, mit Stoffgamaschen über den Schuhen und weißseidenem Kragenschoner, und er war dafür bekannt, dass niemand die Treppe so schnell und geräuschlos auf und ab laufen könne wie er. Beine und Treppen schienen aufeinander eingespielt wie eine auf das genaueste funktionierende Mechanik. Die Treppe hinauf nahm er immer drei Stufen, und mit dem letzten Schritt war er genau vor dem Klingelknopf. Erna hatte ihn schon einige Male beobachtet und hatte lachen müssen. Eines Tages, als Sand das sah, fragte er ungeniert: „Sie freuen sich ja so, gnädige Frau?“
„Mir macht es Spaß, wie sicher Sie die Treppen immer finden und wie eilig Sie es immer haben. Wie wenn Ihr Zug gerade immer weggefahren wäre.“
„Ach soo?“
Da öffnete Frau Sand die Tür. Sie grüßte unfreundlich, sie war überhaupt in ihrem ganzen Äußeren das Gegenteil ihres Mannes. Offenes Misstrauen war in diesem bäuerlichen Gesicht. Sie machte die Tür sofort zu, und Erna hörte, wie sie im Flur ganz unbeherrscht sagte: „Was wollte die denn von dir?“
Eines Tages sah Sand Erna im Park auf einer Bank sitzen. „Guten Tag, gnädige Frau. Donnerwetter, ist das wieder warm! Gestatten Sie?“ Und schon saß er neben Erna, wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht, rief dann den Speiseeisverkäufer heran, forderte zwei Portionen und reichte eine davon Erna. „Wie kommen Sie dazu?“, fragte Erna.
„Na wieso, soll ich hier allein essen?“
Nach einigen weiteren Fragen hin und her erzählte Sand, dass er drei Jahre im Krieg und dann noch zwei Jahre bei der Polizei gewesen sei. Und dann sei er mit nichts dagestanden, seine Eltern hätten in Landsberg an der Oder eine kleine Bierwirtschaft, aber die sei auch gerade so, dass die Alten ihr Auskommen hätten. Er allein hätte sich vielleicht noch durchschlagen können; aber wie es im Leben nun einmal sei – es ginge mit dem Alleinsein nicht auf die Dauer. Was aber praktisch machen? Was man in fünf Jahren als Soldat gelernt habe, könne man in Zivil schlecht brauchen. Als Arbeiter? Zu wenig Geld! Als Beamter? Keine Praxis. Von der Schulbank weg in den Krieg. Da sei er eben die Reihe seiner Bekannten und Freunde einmal durchgegangen, und da sei ein Schulkamerad darunter gewesen, der mit Gewürzen gereist sei und gut verdient habe. Allerdings habe der ihm sofort gesagt, dass ein halbes Jahr draufgehen würde, bis er mehr als die geringe Provision von sechzig Mark monatlich verdiene. Ein halbes Jahr müsse man schon dafür aufwenden, um sich die Kundschaft zusammenzulaufen. Das hielten viele nicht durch.
Er hätte sich jedoch vorgenommen durchzuhalten und hätte auch durchgehalten. Die Jahre 1922 und 1923 seien natürlich ohnehin traurig gewesen, aber Anfang 1924 habe er im ersten Vierteljahr jeden Monat durchschnittlich dreihundert Mark verdient, und das sei bei dem hohen Wert des Geldes nach der Stabilisierung ein schöner Batzen gewesen. Nun sei seine Sache so eingespielt, dass er schon im Voraus ungefähr berechnen könne, was der Monat bringen müsse. Es drehe sich nun nicht mehr darum, neue Kundschaft zu suchen, sondern die feste Kundschaft pünktlich zu bedienen. Alles Weitere hänge von der allgemeinen Geschäftslage ab, und die sei nicht schlecht. Seine Monatstaxe sei nun fünfhundert Mark. Als Erna fragte, mit welchen Gewürzen er reise, zählte er diese bereitwillig auf: die verschiedensten Sorten Pfeffer, Paprika, Vanille, Lorbeerblätter, Kümmel, Muskatnuss und etliche andere, die Erna nicht kannte. Das Köfferchen für die Proben war nicht größer als eine Zigarrenschachtel und ging bequem in die Aktentasche. „Und nun habe ich noch eine Vertretung für Seilerwaren übernommen“, schloss Sand seinen Vortrag. „Die Kundschaft ist zum großen Teil dieselbe. Hundert Mark Nebenverdienst fallen monatlich ab, ohne dass ich nur einen einzigen Schritt mehr mache. Wenn man als Reisender nämlich erst eine feste Kundschaft hat, muss die Firma sich eine zweite Vertretung wohl oder übel gefallen lassen, sonst geht der Reisende zur Konkurrenz und nimmt die Kundschaft mit. Im Anfang fiel es auch mir verdammt schwer, aber jetzt bin ich herzlich froh, dass ich nicht in irgendeinem Büro festsitze. Wenn man erst an seine Freizügigkeit gewöhnt ist, soll das schwerfallen. Herr Liebenfeld hat sicher mehr zu laufen als ich und immer unangenehme Pfändungssachen und hat schon dreizehn Dienstjahre und verdient, sage und schreibe, zweihundertsiebzig Mark. Vier Kinder hat er, und seine Mutter wohnt auch bei ihm. Ihr Mann war Offiziersstellvertreter und ist gefallen. Sie bekommt Rente, sonst könnten die Liebenfelds die hohe Miete für die große Wohnung wohl schwer aufbringen. Na und wie gesagt, ein solcher Beruf ist wirklich keine angenehme Sache. Jeder Mensch, zu dem der Mann kommt, wünscht ihn doch zum Teufel, und man sieht es dem Mann auch an, wie das auf ihn wirkt. Fünfunddreißig Jahre ist er alt und schon grau. Einen solchen Posten – nicht geschenkt möchte ich ihn haben. Ich hielte das einfach nicht aus.“
Sand schwieg und wartete, und da auch Erna schwieg, wurde die Pause immer peinlicher.
„Sie sind wohl eine Berlinerin, gnädige Frau?“, fragte Sand nun.
„Hören Sie auf mit Ihrem ‚gnädige Frau’.“
„Entschuldigen Sie, Frau Schuhmann. Man gewöhnt sich so daran, dass man sich dabei tatsächlich nichts denkt.“
„Danke!“
Sand dachte nach und wurde verlegen. „Verstehen Sie mich bitte nicht falsch“, bat er. „Die Frauen, mit denen ich zusammenkomme, wollen es so haben.“
„Ich habe nichts dagegen. Aber mir wollen Sie doch wohl keinen Kümmel andrehen?“
„Gewiss nicht. Ihnen nicht.“
Sand rauchte eine Zigarette an, lehnte sich zurück. Erna fühlte seinen Blick auf ihrem Hals. Dann sagte Sand: „Ich muss Sie um Entschuldigung bitten bezüglich des Verhaltens meiner Frau, als Sie neulich einen Augenblick mit mir vor unserer Tür standen.“
„Ich wüsste nicht, warum? Vielleicht hat Ihre Frau Gründe, misstrauisch zu sein!“
„Was Sie vielleicht denken, Frau Schuhmann, trifft nicht zu“, erwiderte Sand ruhig und fast beleidigt. „Meiner Frau gefällt es nicht in Berlin. Sie kann sich nicht einleben. Es fehlt ihr auch die passende Bekanntschaft.“ Dann erzählte Sand, dass zum Unglück diese Wingerings ihre Flurnachbarn seien. Ganz sonderbare Leute! Die Küche sei mit so grellen Farben ausgemalt, dass man direkt geblendet sei, wenn man hineinschaue. Vier grellrote breite Streifen, wie riesige Balken, seien an die Wände gemalt und an die Decke ein mit Sternen übersäter Himmel. Gar nicht wie ein geschlossener Raum nehme sich diese Küche aus, sondern wie ein Tor, und so sei das auch wohl gemeint. Durch dieses Tor käme man in das Zimmer, und das sähe auch wieder nicht aus wie ein Wohnzimmer, sondern eher wie eine Malerwerkstatt oder wie eine Theaterbühne oder Theaterrumpelkammer. Man könne sich auch einbilden, man sei in einem Puff! „Tatsächlich“, beteuerte Sand, als er Ernas erstaunten Blick sah, und gab eine ausführliche Beschreibung jenes Zimmers.
In der Mitte ein Tisch mit einer bunten Decke darüber, man könne gar nicht unterscheiden, ob dies Bunte eine Stickerei oder Farbenkleckse seien. Der Tisch voll mit schmutzigem Geschirr, Büchern, Bildern, Pinseln, Bleistiften, Zeichnungen, Zigaretten, Aschbechern, Gipsbüsten und Tuschkästen. Auf dem Fußboden ein Linoleumteppich, doch der sei kaum zu sehen vor lauter Hockern und Sesseln, alles ganz grob gemacht und blau angestrichen. Richtige Möbel hätten die Leute überhaupt nicht, außer einem Schrank und ein paar Truhen, irgendwo ganz wahllos zusammengekauft. Auf ein paar Kissen läge eine breite Matratze und darüber ein Fell. Am Tag sei das wohl das Sofa und nachts das Bett. Und die Wände seien vollgehängt mit Zeichnungen von nackten Weibern und Männern. Die eigene Frau hätte Wingering in den verschiedensten Stellungen abgemalt, kniend, stehend, liegend, sitzend, von hinten und von vorn. Er selbst habe sich auch gemalt, aber bloß das Gesicht, dieses Jesusgesicht mit dem langen schwarzen Bart und den kohlschwarzen stechenden Augen. Ganz unheimlich sei es schon am Tag bei diesen Leuten, aber noch unheimlicher sei es dort wohl nachts. Manchmal käme ein ganzer Haufen Menschen zusammen, wohl auch solche Maler oder ähnliches Volk, Männer und Frauen, sehr oft schliefen sie auch da.
„Und nun stellen Sie sich vor“, fuhr Sand unvermittelt fort, „wie solche Menschen auf einen Menschen wirken wie meine Frau. Ihr Vater war Friedhofsgärtner, weit draußen vor dem Städtchen. Ganz still lebten die Leute dort und verkauften werktags und sonntags Blumen. Und da platzte nun der Krieg hinein und dann die Revolution und dann die Inflation. Wissen Sie, Frau Schuhmann, da hatte ja unsereiner schon zu tun, dass er durchkam. Als ich vom Militär entlassen war, stand ich da, und manchmal beneidete ich meine Kameraden, die nicht mehr am Leben waren. Eine ganze Weile hatte ich mit mir zu tun, so ganz ohne Halt und ohne Knochen kam ich mir vor. In diesem Zustand habe ich meine Frau kennengelernt. Ich ging immer auf den Friedhof und kaufte immer ein paar Blumen. Und da sind wir einmal ins Gespräch gekommen. Ein Bruder von ihr war in Frankreich schwer verwundet worden und in der Heimat gestorben. Aber sie sprach ganz ruhig darüber. Das war überhaupt eigenartig mit ihr. Sie war wie ein Stück unberührtes Leben, jung, gesund, braun gebrannt, wenn sie so zwischen ihren Blumen und Kränzen hantierte: direkt aufrichten konnte man sich an ihr. Das hat mich auch immer wieder angezogen. Ich brauchte direkt so was. Na und die Eltern waren auch ganz nette Leute, und da dachte ich: Was soll man da weiter suchen! Und – wir waren doch jung – es blieb mir dann auch nichts andres übrig als zu heiraten. Nun gewiss, ich hätte ja selbst Friedhofsgärtner werden können, aber ich wollte nicht. Auf die Dauer war das doch nichts für mich. Und meine Frau wollte um keinen Preis nach Berlin. Aber es ging doch nicht anders. Und doch war es ein Fehler. Heute ist meine Frau mit den Nerven so weit runter, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Sie hat die Platzangst!“
Erna musste hellauf lachen, und die Leute auf den andern Bänken schauten neugierig zu ihnen herüber. Sand freute sich wie über die Wirkung eines gelungenen Witzes und sagte: „Eigentlich ist es ja gar nicht zum Lachen, aber wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.“
„Nicht doch!“, sagte Erna und wurde ganz ernst. „War Ihre Frau schon beim Arzt?“
„Sie geht nicht!“, antwortete Sand. Erna wollte mehr von dieser Krankheit wissen, und Sand erzählte: „Sie will nicht in der Straßenbahn fahren, nicht im Autobus, nicht in der Stadtbahn, sie will überhaupt nicht aus der Wohnung. Sie hat Angst vor dem Verkehr auf der Straße, sie hat Angst vor den Menschen. Kaum, dass ich sie soweit bringe, mit mir in den Park zu gehen, und wenn, dann will sie nach einigen Minuten wieder nach Hause. Sie hat Angst, es seien Einbrecher in der Wohnung. Wenn sie heimkommt, sucht sie die ganze Wohnung ab, unter den Betten, im Schrank, auf der Toilette, horcht nach jedem Wort und jedem Tritt auf der Treppe. Wenn ich dann zu Hause bin, beruhigt sie sich wieder, aber die meiste Zeit bin ich ja nicht zu Hause. Ich habe ihr vorgeschlagen, ein Dienstmädchen zu mieten, damit immer jemand bei ihr oder bei den Kindern ist, wenn sie mit mir fortgeht. Sie will nicht. Es lebt sich schwer mit so einer Frau. Sie ist nämlich auch wahnsinnig eifersüchtig!“
„Wie viel Kinder haben Sie?“
„Zwei. Der Junge ist fünf, das Mädchen zwei Jahre alt.“
„Schlimm.“
Sand überlegte eine Weile, dann sagte er, dass er Erna schon lange bitten wollte, ihm behilflich zu sein. Sie sei doch früher Krankenpflegerin gewesen und hätte gerade mit solchen Kranken Erfahrung.
„Wer hat Ihnen gesagt, dass ich Krankenpflegerin war?“
„Frau Schulz“, antwortete Sand.
Die Familie Schulz wohnte vier Treppen hoch. Der Mann war Werkmeister in einer Kugellagerfabrik. Die Frau war sehr in die Breite gegangen, und wenn sie vom Einkaufen zurückkam, blieb sie auf jedem Treppenpodest lange stehen, um sich zu verschnaufen. Fand sie dann Gelegenheit zur Unterhaltung, dann wurden die Gespräche lang, und den Stoff zu diesen Gesprächen bildete ausschließlich das enge Leben der Leute im Haus. Erna hatte mit Frau Schulz außer einem gelegentlichen Gruß noch kein Wort gesprochen, aber sie konnte sich nun schon denken, dass Frau Schulz dies von der Weihäugel wusste.
Nach einer Weile griff Sand plötzlich nach seinem Gewürzmusterkoffer und sagte: „Nichts für ungut, Frau Schuhmann. Ich muss jetzt gehen!“
Erna sah ihm nach, da stand plötzlich seine Frau vor ihm. „Halt den Mund!“, sagte die. „Ich gehe hier entlang, jeder kann mich sehen. Auch die!“ Erna sah zwei Augen voll giftigen Hasses auf sich gerichtet. Frau Sand sagte: „Sie sollten sich schämen, über das Unglück anderer zu lachen!“
IV
Als Erna von diesem Erlebnis Willi berichtete, stellte sich heraus, dass Willi bereits über vieles unterrichtet war. Eine Treppe wohnte Parteigenosse Steinbrink, Unterbezirksleiter der SPD und Meister in der Vorwärtsdruckerei. Von ihm wusste Willi, dass Sand gar nicht das Unschuldslamm war, als das er sich ausgab, und dass die Krankheit der Frau noch eine andere Ursache hatte als die, von der Sand gesprochen hatte. Frau Sand war tatsächlich naiv und unerfahren, als Sand sie heiratete, und hatte ihm blindlings vertraut. Von der Untreue ihres Mannes erfuhr sie erst durch den Arzt, der eine Geschlechtskrankheit bei ihr feststellte. Sand hatte sich auch damals von jeder Schuld loszureden und seiner Frau zu beweisen versucht, dass sie sich nicht durch ihn, sondern irgendwo anders angesteckt habe. Er versuchte ihr glaubhaft zu machen, dass die Gefahr der Ansteckung in einer Großstadt größer sei als man allgemein annehme, und zwar durch die Berührung von Gegenständen, die ein Kranker berührt habe: Türklinken, Geld, Einwickelpapier in Gemüse- und Seifenläden. Eine ganze Reihe solcher Möglichkeiten zählte Sand auf, und wahrscheinlich wäre es ihm auch gelungen, der Frau das einzureden, wenn nicht eines Tages ein junges Mädchen bei Frau Sand erschienen wäre und ihr mitgeteilt hätte: „Er hat auch mich angesteckt. Er hat mich genauso betrogen wie Sie! Er hat mir geschworen, dass er unverheiratet ist!“ Sand sei dazugekommen, hätte das Mädchen beschimpft und hinausgeworfen. Das Mädchen hätte Anzeige erstattet, und so sei der Fall in die Zeitung gekommen.
„Und seitdem hat die Frau die Platzangst!“, betonte Willi mit bedeutsamer Geste. „Sie schämt sich, unter Menschen zu gehen. Und seit dieser Zeit liest der Kerl nun den ‚Angriff’. Vorher hat er den ,Vorwärts’ gelesen, aber der ,Vorwärts’ hat über diese Sache berichtet. Lass dich nicht mit diesen Leuten ein“, bat Willi. „Es sind Kleinbürger. Da kommst du ins Gerede und weißt nicht wie. Wir müssen uns unsrer Sache widmen, der Sache des Sozialismus und der Partei. Du hast noch eine große Aufgabe vor dir. Du musst lesen, lesen und noch einmal lesen. Du musst dich auf eigne Füße stellen, damit du mit der Partei lebst. Damit du mitreden kannst. Sich in Einzelheiten verzetteln, hat keinen Zweck. Jeder Tag und jede Stunde des menschlichen Lebens, die ungenützt vorübergeht, ist verloren. Ich würde dir auch raten, Klavierunterricht zu nehmen. Du hast eine gute Stimme und gewiss auch musikalisches Gehör.“
V
Partei, Gewerkschaften und alle übrigen Arbeiterorganisationen hatten durch die Inflation ihr Vermögen bis auf die Sachwerte verloren, aber nun setzten sie wieder Kapital an. Willi beschäftigte sich hauptsächlich mit kulturpolitischen Fragen und sprach über diese Themen in Partei- und Gewerkschaftsversammlungen. Jedes Thema bearbeitete er mit viel Ernst und Umsicht. Einige Tage sammelte er Material. Tisch und Schreibtisch lagen dann voll mit Büchern, mit Zetteln und Zettelchen, einmal, zweimal, dreimal unterstrichen, rot und blau. Dann fertigte Willi ein provisorisches Manuskript an, arbeitete es durch, hielt den Vortrag laut im Zimmer, fügte die während des Sprechens neu aufkommenden Gedanken ein und schrieb dann das Manuskript auf der Schreibmaschine ab. Manchmal ergänzte er es nach dieser Abschrift und vermerkte auf dem ersten Manuskript: „Erste Fassung“, auf dem zweiten: „Zweite Fassung“.
Zu den Vorträgen ging Erna stets mit. Sie war manchmal traurig, weil nichts in ihrem Kopf hängenblieb als Worte, deren Sinn ihr verschlossen blieb. Willi tröstete sie: „So rasch geht das natürlich nicht!“ Aber sie könne ihm dennoch gut helfen. Würde der Mann durch die Frau entlastet, so käme diese Arbeit der Frau zugleich der Sache zugute, auch wenn diese Entlastung lediglich in Hausarbeit bestünde. Man müsse die richtige Arbeitsteilung zu finden wissen. Auch einen nach seiner Meinung gut passenden Vergleich hatte Willi bereit: den zwischen Meister und Lehrling. Er fand immer gut passende Worte, eine Sache genau zu begründen. Auch warum für ihre junge Ehe im Moment ein Kind nicht zweckmäßig sei, setzte er Erna geduldig und ausführlich auseinander. Die Inflation hatte alle früheren Ersparnisse vernichtet, Hochzeit, Wohnung, Möbel mit allem Drum und Dran kosteten mehr als zweitausend Mark. Allein für die Wohnung hatten sie dem früheren Besitzer sechshundert Mark Abstand zahlen müssen, und wären ihnen nicht die guten Beziehungen zum Wohnungsamt zugute gekommen, dann hätten sie die Wohnung gar nicht erhalten. Willi war wohl bald zum Krankenkassenobersekretär aufgerückt und verdiente nun dreihundertfünfzig Mark monatlich, aber er war der Meinung, dass man bei der Geburt eines Kindes einige tausend Mark in Reserve haben müsse. Die Unkosten für die Erziehung eines Kindes wären in der Regel höher als man vorher berechne, und ob Erna ein Jahr früher oder später ein Kind bekäme, sei im Grunde einerlei. Genaugenommen hätte Erna ja noch gar nicht heiraten wollen.
Auf diese Weise, Tatsache an Tatsache gereiht, hatte Willi wirklich recht, und er war auch immer froh, wenn Erna dies einsah, ihm als Lehrling eifrig zur Hand ging, die Manuskripte auf der Maschine abschrieb, die Bleistifte anspitzte, den Schwamm zum Aufkleben der Briefmarken anfeuchtete und rechtzeitig Badewasser bereithielt. Wohl war Ernas Wissen noch dürftig, aber Willi war der Meinung, dass dieser Mangel leicht zu beheben sei. Er verwies auf den Bücherschrank. Dort standen wohlgeordnet circa siebenhundert Bücher und Broschüren.
Wenn Erna darüber nachdachte, wie lange sie wohl brauchen würde, bis sie alle diese Bücher gelesen hätte, bekam ihr Gesicht einen recht bekümmerten Ausdruck. Willi kaufte fast jede Woche Bücher, überdies war er Mitglied einer Buchgemeinschaft. Die beiden letzten Romane lagen auf dem Schreibtisch. Sie knisterten noch, als Erna darin blätterte. Auf dem steifen Deckel des einen stand: „Das Schellengeläut“, auf dem andern: „Es geht ein Wind durch die Mühlen.“
VI
Eines Tages sprach Willi im Unterbezirk über „Demokratie und Diktatur“. Willi sprach circa zwei Stunden. Nach seinem Material nahmen sich die Errungenschaften der Partei und der Gewerkschaften recht imposant aus: Koalitions- und Pressefreiheit, Ausbau der Sozialgesetzgebung, Arbeitslosenunterstützung, gesetzliches Mitbestimmungsrecht der Arbeiter in den Betrieben durch die Betriebsräte, wachsender Einfluss der Partei auf die gesamte kommunale und staatliche Verwaltung. Nach Willis Meinung läge es nunmehr nur an der arbeitenden Bevölkerung selbst, der Sozialdemokratie in den bevorstehenden Wahlen die Mehrheit der Reichstags- und Landtagsmandate zu verschaffen, um dem Sozialismus in noch rascherem Tempo näherzukommen. Diktatur, ob von rechts oder von links, sei nie und nimmer mit den Grundsätzen des Sozialismus zu vereinbaren, und deshalb polemisierte Willi scharf gegen die Kommunisten und gegen die Hitlerpartei. Er sprach die feste Zuversicht aus, dass die Partei aus dem Wahlkampf als Sieger hervorgehen werde, wenn jeder Parteigenosse seine Pflicht erfülle. Steinbrink leitete die Versammlung und forderte Wortmeldungen. Er war dreißig Jahre alt, übermittelgroß, von stattlichem Äußern und solide gekleidet.
„Na, Horning“, sagte er nach einer Weile, „auch einverstanden, oder …?“ Dabei lächelte er etwas herausfordernd einem gedrungenen Mann mit glattrasiertem Kopf zu.
„Es hat ja wohl wenig Zweck!“, antwortete Horning, wie im Ton aufrichtigen Bedauerns.
Willi empfand diesen Zwischenruf als eine Diskreditierung seiner Arbeit. „Ich protestiere gegen solche zweideutigen Bemerkungen!“, antwortete er. „Wenn jemand nichts zu sagen hat, dann soll er nicht solche faulen Ausreden vorschieben.“
„Hab dich nicht so!“, rief nun der neben Horning sitzende Genosse Kern, ein etwa fünfundvierzigjähriger Mann mit aschfarbenem Spitzbart. „Wir sind doch nicht in der Kirche und haben es doch wohl nicht mit Pfaffen zu tun!“
Willis Blick wurde ganz starr und hilflos. Steinbrink sagte leise zu ihm: „Nicht darauf reagieren! Das wollen sie bloß. Das darf ihnen aber nicht gelingen. Wir müssen sie heute zum Reden bringen und erledigen.“
Horning stand nun doch auf und redete los: „Unser Referent ist hier aufgefahren mit einem ganzen Wagen voll Errungenschaften. Alles schön und gut. Ich bin aber nun erwerbslos und bekomme für Frau und Kind wöchentlich zwölf Mark Unterstützung. Fünf Mark muss ich wöchentlich Miete zahlen, bleibt noch täglich eine Mark zum Leben. In dieser einen Mark sind für mich und meine Familie die ganzen Errungenschaften der Revolution drin. Und wenn ich wieder Arbeit bekomme, dann bleiben uns, wenn ich nach meinem Tariflohn als Hilfsarbeiter bezahlt werde, zwei Mark täglich zum Leben. Es ist also keine faule Ausrede, wenn ich in puncto Begeisterung nicht mit dem Referenten mitkomme. Ich kann einfach, wie man so sagt, hinten nicht mehr hoch! Und so geht es nicht mir allein, so geht es Hunderttausenden!“
„Unerhört!“, ließ sich jetzt eine spitze Frauenstimme vernehmen. Es war die Stimme der Bezirkswohlfahrtspflegerin Kaluta.
„Ich möchte bloß wissen, was du hier überhaupt noch willst!“
Steinbrink unterbrach sie: „Sie haben nicht das Wort, Genossin Kaluta!“
„Dann melde ich mich jetzt zum Wort.“
„Jetzt hat der Genosse Horning das Wort.“
„Ich bin fertig!“, sagte Horning und setzte sich.
„So redet kein Parteigenosse!“, begann die Kaluta von neuem. „So reden nicht Leute, die zu uns gehören! Man muss die Dinge einmal beim richtigen Namen nennen! Hier wird ein unsauberes Spiel gespielt!“
„Dass Sie ein Engel sind, daran zweifle ich nicht, Genossin Kaluta!“, erwiderte Horning trocken.
„Ich verbitte mir solche dummen Witze!“
„Sprechen Sie bitte zur Sache, Genossin Kaluta!“ Das war Fernhagen, ein Arbeitskollege von Willi. Steinbrink klingelte: „Auch ich muss bitten, die Zwiegespräche zu unterlassen und sich an das Thema zu halten!“