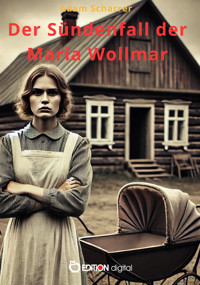6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Täter erzählt – und die Geschichte klagt an. Joachim Lakner, ein einfacher Arbeiter aus Niederfranken, wird zum glühenden Anhänger des Nationalsozialismus – und schließlich zum fanatischen Vollstrecker des faschistischen Terrors. Adam Scharrer zeichnet in diesem literarischen Psychogramm den Weg eines „kleinen Mannes“ nach, der sich der Ideologie bedingungslos unterordnet, Mitläufer wird, Täter wird – und dabei doch glaubt, ein Held zu sein. Mit schonungsloser Klarheit und psychologischer Präzision beschreibt Scharrer, wie Verführung, soziale Not, ideologische Indoktrination und der Rausch der Macht aus einem Menschen ein willfähriges Werkzeug des Totalitarismus machen. Ohne zu moralisieren, legt der Autor die zerstörerische Kraft des Faschismus offen – in einem Roman, der im sowjetischen Exil entstand und bis heute nichts von seiner Eindringlichkeit verloren hat. Der Landsknecht ist ein literarisches Dokument über Schuld, Selbstbetrug und das fragile Verhältnis zwischen persönlicher Verantwortung und historischer Verstrickung – beklemmend aktuell in einer Zeit, in der autoritäre Versuchungen wieder lauter werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Adam Scharrer
Der Landsknecht
Biografie eines Nazis
ISBN 978-3-68912-483-0 (E–Book)
Die Erzählung erschien erstmals 1943 im Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau.
Für das E-Book wurde die Erzählung dem Sammelband „Der Mann mit der Kugel im Rücken“ entnommen, erschienen 1979 im Aufbau Verlag Berlin und Weimar.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
DER LANDSKNECHT. Biografie eines Nazis
1. Wie der SA-Mann Joachim Lakner eine Familie gründete
Joachim Lakner war spät und stark angetrunken zu Bett gekommen, und als er am Sonntagmorgen, noch im Halbschlaf, seine Taschen durchsuchte, fand er alles in allem nur siebenunddreißig Pfennige vor. Bei dieser Gelegenheit entdeckte er auch, dass das Hinterteil seiner Hose hoffnungslos zerrissen war. Joachim hatte den Hosenboden schon einige Male gestopft und zusammengezogen, und nun sah er aus wie ein zerfetzter Korb. Joachim entsann sich nun auch, wie das geschehen war: Kurz vor Schluss des gestrigen „Kameradschaftsabends“ war es gewesen. Henning, der Sturmführer, hatte Joachim den Stuhl weggezogen, als dieser sich setzen wollte. Ein Jux hatte das sein sollen, und es war auch einer geworden. Joachim war ahnungslos und mit einem Ruck in sich zusammengeplumpst, dass die Hose krachend durchgerissen war. Ein schallendes Gelächter war der Lohn für diesen gelungenen Streich gewesen, und Henning hatte eine neue Lage Bier spendiert. Joachim aber, innerlich kochend vor Zorn, hatte sich mit der dummen Redensart aus der Affäre gezogen: „Jetzt muss ich mich so lang ins Bett legen, bis die Hose anständig geflickt ist, denn meine andere ist auch kaputt.“ So war es auch. Mit der Sonntagshose war Joachim während einer Geländeübung im Stacheldraht hängengeblieben, und nun war sie beim Schneider.
Eine zerdrückte Zigarre, die er noch in der Tasche seines Braunhemdes fand, machte die Stimmung nicht viel besser. Unter seiner Kammer, im Stall, trampelten die Pferde schon unruhig und forderten von ihrem Knecht das Futter. „Ihr Teufel, ihr verfluchten, könnt wohl wieder nicht warten?“, schimpfte er. „Na, ich werd’s euch gleich beibringen …“ Und nach einem weiteren grimmigen Blick auf den zerfetzten Hintern seiner Hose gestand er sich: Diesem geschniegelten und gebügelten Fratz könnt ich jetzt noch das Messer in die Därme hauen, dass alles nur so zischt! Mit diesem geschniegelten und gebügelten Fratz war der Henning gemeint, der sich in Oberwalddorf als Tierarzt betätigte und SA-Sturmführer geworden war, obwohl Joachim die Meinung hegte, dass in erster Linie er ein Anrecht darauf gehabt hatte. Aber die ganze Hetz geht auf Kosten von unsereinem, räsonierte er weiter, während er den Hosenboden von innen mit Sacknadel und Schnur zusammenzog. „Die ganze Hetz hat sich nur für andere Leut bezahlt gemacht!“, schimpfte er, während er barfuß in die schief getretenen Stiefel schlüpfte, und diesmal war es auf seinen Dienstherrn gemünzt, den Ortsbauernführer Benedikt Scheffelfuß, Besitzer des Gasthauses „Zum starken Mann“. „Die ganze Hetz ist eine ausgemachte Niederträchtigkeit“, sagte Joachim dann noch, denn es war ihm zudem wieder eingefallen, dass die siebenunddreißig Pfennige sein ganzes Vermögen waren. Er hatte als Lohn einhundertfünfzig Mark im Jahr zu bekommen und für jeden Sonntag zwei Mark Biergeld. Seinen Lohn hatte er aber bereits im Voraus abgehoben – der war draufgegangen während der Aus- und Aufmärsche und der Fahnenweihen und sonstigen Feste und Veranstaltungen der SA und der „Bewegung“. Und die zwei Mark Biergeld für den heutigen Sonntag hatte Joachim sich bereits gestern geben lassen. Ja, und auch das: Er hatte um die paar Kröten fast betteln müssen, denn Scheffelfuß verhielt sich nun, da Hitler an der Macht war, zu Joachim wieder genauso wie früher als Herr zu seinem Knecht. „Die Gauner wissen schon, wie man ein Geschäft macht!“, stellte Joachim dann abschließend fest. „Die Herrgottslumpen wissen immer, wie man sich die Butter fischt, und für unsereinen bleibt die blaue Milch.“
Damit trottete Joachim in den Hof, an den Brunnen, ließ sich das kalte Wasser über den Kopf laufen und verschwand im Pferdestall. Dort nahm er die Lederpeitsche von der Wand und schlug dem unruhig trampelnden Apfelschimmel über den Kopf. „Pass nur auf, du Teufel, dass ich dir die Ohren nicht vom Schädel schlag!“, drohte er dem Gaul. Das Pferd stellte sich in Erwartung weiterer Schläge nervös auf die Hinterbeine, konnte aber nicht hochkommen, der niedrigen Decke wegen. Es wieherte ängstlich und erschrocken auf. „Ja, ja, ganz andere Saiten werde ich aufziehen“, drohte Joachim weiter und warf die Peitsche neben die Haferkiste, schüttete den Pferden Häcksel auf, gab ihnen aber doch ein Maß voll Hafer mehr in den Born als üblich. Was können schließlich die armen Viecher dafür, dass nicht ich Sturmführer geworden bin, sagte er sich.
Er warf den Mist aus dem Stall, bürstete die Pferde, säuberte und lackierte die Geschirre, verklebte dann die zerdrückte Zigarre mit Zeitungspapier und steckte sie in Brand. Draußen wurden bereits die Milchkannen vom Hof gefahren, es musste also bald Frühstückszeit sein. Und nach dem Frühstück, dann war auch für Joachim Sonntag – aber bei dieser Feststellung wurde ihm wieder ganz trübselig zumute.
Der Hempel, der alte Strolch, wird jetzt natürlich auch erst wieder die Hand aufhalten, bevor er meine Sonntagshose flickt, befürchtete Joachim, und dies nicht ganz ohne Grund. Er hatte bei dem Schneider noch Schulden zu bezahlen, für seine Verhältnisse gar nicht so wenig. Diese selbe Hose hatte er sich nämlich von Hempel machen lassen und dazu einen Mantel – eine Rechnung von annähernd hundert Mark, „’ne Kleinigkeit. Ein Dreck!“, brummte er ärgerlich. „Wenn …“ Dieses letzte Wörtchen bekam einen so eigentümlich verächtlichen Klang, dass Joachim in großem Bogen zwischen die Pferde spuckte, als wollte er damit seiner Verachtung gegen diese schlechteste aller Welten Ausdruck verleihen, die gerade ihn so stiefmütterlich behandelte. Dicke Rauchwolken vor sich hin blasend, die Zigarre schier zu einem Besen zerkauend, stellte er anklägerisch fest: Wenn irgendwo die Kommunisten und Sozialisten und Pazifisten auseinanderzuhauen waren, dazu war dann der Joachim gut! Da hat es immer geheißen: Ja, der Joachim, das ist ein Kerl, auf den das ganze Dorf, der ganze Gau, das ganze Volk stolz sein kann. Auf Männern wie Joachim ruht die Zukunft Deutschlands! … Tag und Nacht war er unterwegs gewesen, immer mit Dolch und Totschläger, und als ihm mit einem Bierkrug das Nasenbein zerschlagen worden war, da hatte er sich vor lauter Ruhm und Lob kaum retten können. Wurst und Kuchen und Obst und Zigaretten wurden ihm ins Spital gebracht, sein Bild war in der Zeitung veröffentlicht worden und ein Artikel dazu, der länger war als der Bericht über die silberne Hochzeit des schwerreichen Ziegeleibesitzers Kachelmayer. Da waren ihm die Hände geschüttelt und gedrückt worden, und die Lobhudelei wollte nicht enden: „Deine Heldentaten und dein Heldenmut werden nicht vergessen werden, Joachim. Nie wird vergessen werden, wer für die Bewegung sein Blut vergossen hat.“ Ja, so war das – und als er dann aus dem Spital entlassen worden war, die Nase noch im Verband, da hatte er in der Wirtsstube gar nicht gespürt, dass er nur Knecht beim Scheffelfuß war. Da war eingeschenkt worden, und irgendwer hatte eben bezahlt. Auch der Hempel, der ihm Hose und Mantel geschneidert hatte, war nicht sofort auf Geld versessen gewesen. „Wirst es schon beizeiten bezahlen können“, hatte der sich getröstet. Auch ein Fahrrad hatte Joachim, als verdienter SA-Mann, auf Kredit bekommen, gegen drei Mark Ratenzahlung wöchentlich. Ach, es waren ja damals überhaupt andere Zeiten. Joachim hatte manchmal die ganze SA in Oberwalddorf freigehalten und ihre Bräute dazu, denn eine Zeit lang konnte er sich das wirklich leisten. Er hatte sich sein Erbteil auf den elterlichen Hof herauszahlen lassen: über zweitausend Mark auf einen Schlag, und da er die Aufwendung als zu niedrig angefochten hatte, noch einmal eintausend Mark. Die Hälfte der ersten Summe war gleich bei einer Gaufahnenweihe in der Kreisstadt draufgegangen. Herrje, zu jener Zeit war noch Schwung in der Bewegung … Als das Geld dann eines Tages alle war, wurde eben geborgt – und man bekam geborgt, weil die Leute Vertrauen zur Bewegung hatten …
Joachim warf seine zerkaute Zigarre auf den frischen, dampfenden Pferdemist hinter dem Apfelschimmel, stand auf, ging vor die Stalltür und schaute sich in dem übersonnten Hof um. Tauben girrten und trippelten auf dem Hausdach, ein Hahn krähte herausfordernd auf dem Misthaufen, der Pfau stolzierte majestätisch mit aufgeschlagenem Rad um den Brunnen. Und alle diese munteren Geschöpfe und dazu die Mädchen in hellen Sommerkleidern, die da und dort auftauchten, schienen zu tuscheln: Ja, Joachim, das war einmal! Man hat dich dazu gebraucht, die dreckige Arbeit für die hohen Herren zu machen, und hat dir dafür die Backen getätschelt, aber jetzt bist du wieder der Knecht im Gasthaus „Zum starken Mann“ und weiter nichts. Hoch hinaus hast du ja immer gewollt und schon von dem Posten als Sturmführer geträumt, aber diese Posten haben die hohen Herren unter ihresgleichen verteilt. Dein Erbteil hast du durchgebracht, hast deinen eigenen Bruder vor Gericht gezerrt und durch den Druck der „Bewegung“ auf das Gericht noch tausend Mark mehr von dem eigenen Bruder herausgepresst, als dir zustand, und nun stehst du doch da ohne eine heile Hose auf dem Hintern, und für dein zerschlagenes Nasenbein wird dir der Scheffelfuß heute nicht mehr das Sonntagsgeld noch einmal geben … Die ganze Welt schien plötzlich voller Hohn gegen Joachim. Er ging in die Scheune. Da stand sein Fahrrad – ohne brauchbaren Mantel, eine Pedale fehlte, der Rahmen war verbogen –, in einem Zustand, dass es nicht mehr in Ordnung zu bringen war. Joachim hatte, stark angeheitert, eine Hausecke mit dem Rad erwischt, und von da war er gegen einen Zaun geschleudert worden. Fünfzehn Mark hatte ihm der Schmied Brake für die Karre geben wollen und ihm gesagt: „Sie ist doch nicht viel mehr wert als altes Eisen.“
Joachim hatte damals zornig abgelehnt. Nun aber war er entschlossen, das Fahrrad auch um diesen Preis loszuschlagen. Er begab sich ins Haus, um sein Frühstück in Empfang zu nehmen, und begegnete seinem Dienstherrn. Scheffelfuß blickte ihn an, als erriete er, was in seinem Knecht vorging. Dann sagte er, in der ihm eigenen Art, Befehle auszuteilen: „Wenn du gefrühstückt hast, Joachim, dann komm zu mir rein, wir haben etwas miteinander auszumachen.“
Joachim fand in der Küche sein Frühstück vor und kaute es hinunter, nachdenklich vor sich hin grübelnd. Am gestrigen Abend war es wieder ziemlich laut zugegangen, entsann er sich, und vielleicht wollte Scheffelfuß dies nun zum Anlass nehmen, ihm, Joachim, kurzerhand zu sagen: Ich glaub, ’s ist besser, du suchst dir einen andern Herrn und ich einen anderen Knecht. Joachim erinnerte sich jetzt auch dessen, dass er am gestrigen Abend mit Alma, der Magd, die bei der Bedienung der Gäste geholfen, in Streit geraten war, dass er sie beschimpft hatte, weil sie es ablehnte, aus seinem Krug zu trinken. Wenn der Scheffelfuß etwa darauf die Rede bringen wollte, nun, dann würde er ihm sagen, dass Alma ihn durch ihre Widerhaarigkeit zuerst beleidigt hätte. Ach, die Alma war auch so ein Kapitel im Leben Joachims, über das er nicht so leicht hinwegkam. In seinen guten Zeiten hatte er geglaubt, sie sei ihm so sicher wie der Posten als Sturmführer, aber dann war auch diese Hoffnung zu Bruch gegangen, und aus Almas Zuneigung war unverhohlene Verachtung geworden, nach Joachims Meinung ganz ohne Grund. Ihm wurde aber doch ein wenig unbehaglich zumute, als er des gestrigen Auftritts gedachte. Möglich ist es also, dass ich wegen diesem Frauenzimmer noch eine gesalzene Suppe auszufressen hab, schlussfolgerte Joachim. Zudem fiel ihm jetzt ein, dass, während er, Joachim, in der Scheune war, Scheffelfuß den Stall aufgesucht haben konnte und die Striemen auf dem Rücken des Apfelschimmels entdeckt hatte. Joachim legte sich auch für diesen Fall eine handfeste Antwort zurecht. Er würde Scheffelfuß schon darauf aufmerksam machen, dass er als Knecht sehr gut wisse, wann ein Gaul ein paar Hiebe verdiene, dass der Joachim Lakner nicht nur Knecht sei, sondern in erster Linie SA-Mann, ja, und dass auch ein Scheffelfuß mit einem SA-Mann nicht so umspringen dürfe, wie er wolle, obwohl er Führer des Reichsnährstandes von Unterwalddorf sei. Scheffelfuß würde darauf vielleicht antworten: Ich habe vor dir als SA-Mann sogar großen Respekt, könnte er sagen, aber als Knecht bist du bei mir nicht auf dem richtigen Platz, und würde alles haarklein aufzählen, was ihm alles nicht passe, schon lange nicht gepasst habe – und das wird eine lange Liste werden. Abschließend – so grübelte Joachim – würde Scheffelfuß feststellen: Grad weil du SA-Mann bist, hab ich ein Auge zugedrückt, die ganze Zeit lang – aber jetzt kannst du gehen, Joachim. Das wäre dann die Rache für die Duldsamkeit, die er hatte aufbringen müssen in der Zeit, wo auch ein Scheffelfuß noch mit der SA rechnen musste.
Joachim spürte, wie seine Nase sich verstopfte. Immer, wenn ihn der Zorn packte, empfand er einen stechenden Schmerz in dem immer noch schrecklich empfindlichen Nasenbein, und es war ihm, als schlössen sich die Nasenlöcher. Ganz wild wurde er dann, weil diese Verstopfung sich auch beim Sprechen bemerkbar machte. Die Worte quetschten sich im Hals, und um sich zu befreien, schnaubte Joachim dann wie ein wildgewordenes Pferd. Auch jetzt war es wieder soweit. Er hatte keine heile Hose am Hintern, keinen Pfennig Lohn mehr zu fordern, und Scheffelfuß konnte sogar noch großmütig tun und etwa sagen: Deinen Lohn hast du ja im Voraus bekommen, und zurückzuzahlen brauchst du mir nichts. – Der pfeift auf ein paar lumpige Mark, wenn er zeigen kann, dass ihm niemand was dreinzureden hat, dieser Erzreaktionär, dieser rachsüchtige Protz, redete Joachim sich ein, der kann es nicht überwinden, dass er sich doch manchesmal hat ducken müssen … Ach, wenn unsereiner was zu sagen hätt … – Joachim würgte sein Frühstück hinunter, stöberte aus einem herumstehenden Aschenbecher einen Zigarrenstummel auf, steckte ihn in Brand und war nun gewappnet, Scheffelfuß gehörig seine Meinung zu sagen.
Er traf den Wirt im Gastzimmer am Ofentisch beim Frühstück an. Hausgemachte Sülze aß er mit Essig und Zwiebeln, und daneben stand die Kognakflasche. „Bin gleich fertig“, sagte Scheffelfuß und räumte dann sehr rasch seinen Teller aus. Dann goss er zwei Gläser voll Kognak und wandte sich zu Joachim: „Prost, Erbhofbauer!“
Joachim verstand vorerst nur, dass etwas ganz Besonderes geschehen sein musste, und da Scheffelfuß seinen Kognak austrank, tat Joachim dies auch. Was sollte das? Erbhofbauer? Joachim hatte wie jedermann in der letzten Zeit viel von einem Erbhofgesetz reden gehört, sich aber um all das wenig gekümmert, weil er kein Hofbesitzer war und die Sache ihn, seiner Meinung nach, nichts anging. Doch diese Begrüßung eben … Dahinter musste etwas stecken.
Joachim setzte sich Scheffelfuß gegenüber und fragte neugierig: „Wieso Erbhofbauer?“
Scheffelfuß rauchte gemächlich eine starke Brasilzigarre an, rülpste sich und klärte dann Joachim auf: „Ja, ja, es gehen große Dinge vor in der Welt!“, sagte er, im Tone eines Mannes, der eben alles rechtzeitig zu wissen hat und es auch weiß und es ganz in Ordnung findet, dass ein Joachim es immer noch früh genug erfährt. „Also, nach dem neuen Erbhofgesetz wird der älteste Sohn Hofbesitzer, ganz gleich, ob er jetzt auf dem Hof ist oder nicht. Das trifft auf alle Höfe von zwanzig Hektar an aufwärts zu, also auch für den Lakner-Hof. Die andern Geschwister sollen halt so anständigerweise abgefunden werden, dass sie sich eine andere Existenz schaffen können, aber Kapitalien dürfen aus dem Hof nicht mehr herausgezogen werden. Auch aufgeteilt dürfen diese Höfe nicht werden, jetzt nicht und auch später nicht, es sei denn, sie haben das entsprechende Ausmaß nach oben, so dass man eben zwei oder drei Erbhöfe daraus machen kann. Aber was dich anbetrifft, so gibt es zwischen dir und deinem Bruder Johann nichts aufzuteilen. Johann und seine Frau wird das ziemlich unverhofft und hart treffen, überhaupt – manch einen wird es hart treffen, aber es wird auch für die irgendwie gesorgt werden. Das Bauerntum soll wieder stärker Wurzel fassen und den Felsblock abgeben, auf dem das ,Dritte Reich‘ in der Zukunft ruht. Und was mich anbetrifft, so muss ich mich natürlich auch dem anpassen, denn du wirst jetzt deine Sachen zu richten haben, und deswegen muss ich mich nach einem anderen Knecht umschauen, und weil jetzt viel zu tun ist, muss ich das gleich tun … Also jetzt, denk ich, weißt du, woran du bist, oder falls du noch einen Zweifel hast …“ – Scheffelfuß griff nach der neuen Zeitung mit der dicken Überschrift „Blut und Boden“ –, „dann lies das durch.“ Damit verließ Scheffelfuß das Gastzimmer.
Joachim las. Er las sprunghaft und aufgeregt, denn er wollte nur Gewissheit darüber haben, ob ihm wirklich der Hof zufiel, den sein Bruder Johann vom Vater übernommen hatte. Und das stand in dieser Zeitung eindeutig und unbezweifelbar und war bereits Gesetz. Es war dann noch von der Bauernschaft als der „tragenden Säule des Dritten Reiches“ die Rede, von einem „denkwürdigen Tag einer denkwürdigen Epoche“, von einem „kühnen Griff geschichts- und volksgestaltender Kraft des Führers, auf dem Marsch des deutschen Volkes durch die Jahrtausende …“ Und in der Gewissheit, dass der Lakner-Hof sein eigen sei, saß Joachim noch eine ganze Weile wie festgebannt auf seinem Stuhl. Er streichelte die Zeitung und sonnte sich in den bombastischen Worten. Dann sprach er andächtig vor sich hin: „Der Führer hat mich also doch nicht vergessen!“
Als er aus dem Haus eilte, zum Hempel, verspürte er wieder die draufgängerische Hemmungslosigkeit vergangener Tage.
„Ist meine Hose fertig?“, fragte er den Schneider in forderndem Ton.
„Ist nicht fertig“, antwortete Hempel, ohne Joachim zum Sitzen einzuladen, und schlug Seifenschaum, um sich zu rasieren.
„Aber ich brauch sie heute unbedingt!“
„Und ich hab dir gesagt, dass ich für dich ohne Bezahlung nichts mehr mache.“
„Aber jetzt fehlt es mir doch nicht mehr an Geld … Du hast doch sicher auch gelesen von dem Erbhofgesetz … Brauchst doch jetzt keine Angst mehr zu haben.“
Hempel legte seinen Pinsel weg, holte vom Schneidertisch Joachims Hose, warf sie ihm über die Schulter und sagte feindselig: „Dass du dich noch damit brüstest, wieder einmal vom Unglück anderer Leute zu profitieren, das gefällt mir schon ganz und gar nicht, Joachim. Flick dir deine Hose selber.“
„Darüber brauch ich keine Vorschriften von dir", polterte Joachim los, drehte sich dann aber um und ging. Erst unterwegs dämmerte es ihm auf, dass Hempel ganz offenbar auf Johann anspielte, als er von dem „Unglück anderer Leute“ sprach, und obwohl Joachims Freude über die unerwartete Wendung alles andere überwog, blieb dieser Vorwurf doch in ihm haften. Ja, ja, an dummer Rederei darüber wird’s nicht fehlen, meinte er, und er wusste sehr wohl, warum. Der alte Lakner hätte es früher gern gesehen, wenn Joachim den Hof übernommen und Johann ein Handwerk, vielleicht Schneider oder Schuster, gelernt hätte, denn Johann hatte sich als Kind den Fuß so unglücklich gebrochen, dass er jetzt noch hinkte. Doch Joachim war wohl stark wie ein Bär, aber ohne jede Hemmungen im Geldausgeben, und er kommandierte lieber, als dass er arbeitete. Ein solcher Nachfolger hätte den Lakner-Hof bald zugrunde gewirtschaftet. Deshalb war es recht oft zum Streit zwischen Joachim und seinem Vater gekommen, bis der Sohn eines Tages schroff erklärt hatte: „Ich pfeif auf den Hof. Zahlt mir mein Erbteil heraus!“ So war es dann auch geschehen, und den Hof hatte Johann übernommen. Es war ihm nicht leicht geworden, Joachim dreitausendvierhundert Mark bar herauszuzahlen, aber er hatte es doch fertiggebracht, das Anwesen vor weiterer Verschuldung zu retten. Die Eltern arbeiteten in ihren alten Tagen noch tüchtig mit, und Johann hatte eine fleißige, umsichtige Frau. Ja, ja, dumme Redereien wird es genug geben, stellte Joachim aufs Neue fest, gleichsam als plage ihn das böse Gewissen, und um dieses böse Gewissen zu beschwichtigen, redete er sich ein: Aber dass unsereiner sein Leben für das ganze Vaterland eingesetzt hat, daran denken diese Lästermäuler nicht. Und dass der Führer schon weiß, auf wen er sich verlassen kann und wen er zum Erbhofbauern macht, daran denken sie auch nicht. Nur an sich denken sie, aber denen werd ich das Maul schon stopfen, wenn es sein muss! Er schnäuzte sich kräftig, weil ihm durch die Unhöflichkeit Hempels das schmerzhafte Kribbeln wieder in die Nase gefahren war. Dann bog er ins hintere Dorf ein und ging zu Brake, dem Schmied. Er traf diesen im Hof an.
„Also, das Fahrrad werd ich dir herbringen, weil ich jetzt doch nicht recht weiß, wohin damit“, sagte Joachim.
„Das Fahrrad? … Ach so … hast es dir überlegt?“
„Ja, wie die Sachen jetzt ausschaun, was soll ich da mit dir wegen ein paar Mark rumhandeln.“
Brake lächelte unter seinem schwarzen buschigen Schnurrbart nicht gerade feindselig, aber mitleidig, und er antwortete: „Weil ich dir nun das Angebot einmal gemacht hab, soll es halt dabei bleiben … Hast du schon mit deinem Bruder Johann und den Eltern gesprochen?“
Joachim hatte wohl im Stillen erwartet, dass die Leute im Dorf ihm die Hand drückten und ihm gratulierten. Stattdessen bedauerten sie seinen Bruder Johann und die Eltern. Nur Scheffelfuß hatte sich etwas anders benommen.
Oder auch nicht viel anders? Dem war vielleicht nur wichtig, Joachim loszuwerden. Ja, ja, das war es. Überall sah Joachim Feindseligkeit und Missgunst. Ihm lag schon auf der Zunge, dem Brake zu sagen: Ich denk, der Führer weiß besser, was fürs Volk gut ist, als manch einer, der so saudumm daherredt, aber gewiss hätte sich dann der Handel mit dem Fahrrad zerschlagen, und Joachim wusste nicht, wie anders er im Moment zu barem Geld kommen sollte. Deshalb erwiderte er in einem Tone, aus dem verständnisvolles Bedauern herausklingen sollte: „Mit dem Johann hab ich noch nicht gesprochen … Und … mir ist das selber nicht angenehm … Aber Gesetz ist nun einmal Gesetz, dafür trifft den einzelnen doch keine Schuld … Also das Rad bring ich her, und es bleibt bei fünfzehn Mark?“ – „Ja, es bleibt dabei“, antwortete Brake und betrachtete aufmerksam und hartnäckig ein vor ihm stehendes, frisch beschlagenes Wagengestell.
Joachim beeilte sich, das Fahrrad zu holen. Als er den Erlös in der Tasche hatte, sagte er unbeherrscht: „Dafür werde ich mir zur Feier des Tages was ganz Besonderes leisten.“
Er ging geradewegs in die Kolonialwaren- und Flaschenbierhandlung von Xaver Fischer und ließ sich eine Flasche Bier, eine Zigarre und eine Tafel Schokolade geben. Die Schokolade war für Alma bestimmt; dafür sollte sie ihm die Sonntagshose flicken und ein Hemd auswaschen. Ob die Alma ihm diese Gefälligkeit tun würde? Ob sie überhaupt …? Und ganz zwangsläufig kamen Joachim Gedanken über seine Zukunft. Als Erbhofbauer musste er möglichst bald ans Heiraten denken, und er war der Meinung, dass Alma sich als Bäuerin gar nicht schlecht machen würde. Sie konnte tüchtig zupacken und war auch sonst ein ganz stattliches und ansehnliches Weib. Ein bisschen rechthaberisch zwar, und deshalb war es eigentlich auch zwischen ihnen zum Bruch gekommen. Sie hatte ihm eines Tages angedroht: „Wenn du noch ein einziges Mal mit einem Rausch heimkommst, ist es für immer aus mit uns!“ Und als sie ihn kurz darauf wieder betrunken zwischen den Pferden gefunden hatte, war es auch aus. Seither beachtete sie ihn nicht mehr. Aber nun würde sie sich das schon überlegen, kalkulierte Joachim. An Vermögen brachte sie allerdings nicht viel mit, alles in allem vielleicht sechs- bis siebenhundert Mark, ein oder zwei Stand Betten und ein paar andere Möbelstücke, alles selbst Erspartes. Vor noch ganz kurzer Zeit hätte Joachim dies als eine ganz respektable Hochzeitszugabe betrachtet, aber nun stand er Alma gegenüber doch ganz anders da. Sicher würde sie ihm sein Aufbrausen am gestrigen Abend auch nicht mehr übel nehmen. Ach, es würde überhaupt so manche und so mancher die Augen und die Ohren nicht schlecht aufreißen.
„Zieh ab!“, sagte er zu Fischer im Tone eines Mannes, dem es nicht auf das Geld ankommt, und reichte dem Händler den Zehnmarkschein. „Wenn du ein Bier mittrinken willst, ist’s mir recht. Auch eine Zigarre kannst du dir anrauchen.“