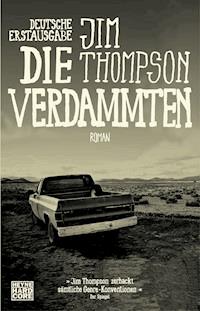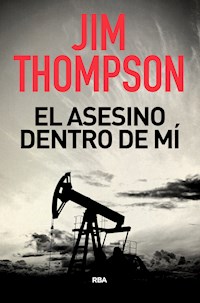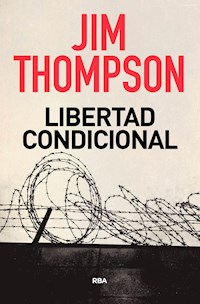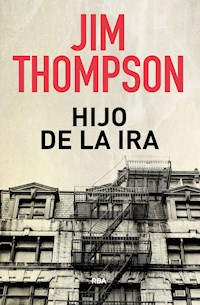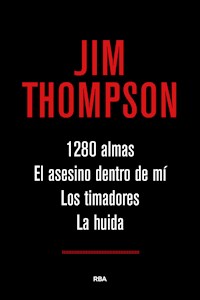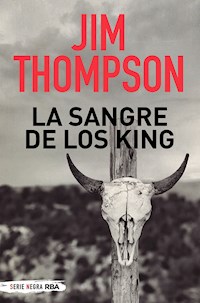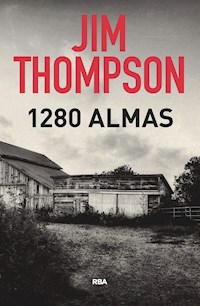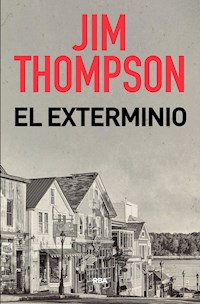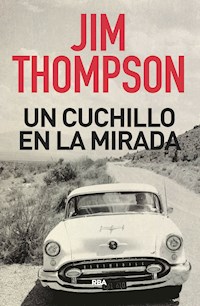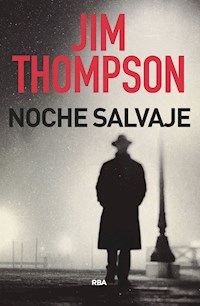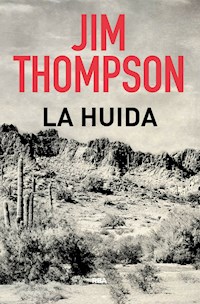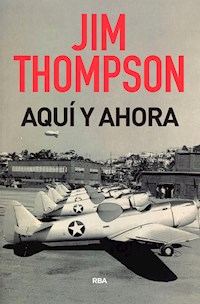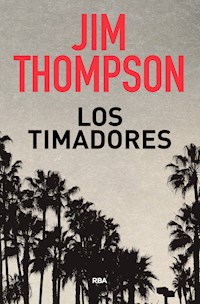9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich liebe euren Hass!
Seine Mutter ist eine weiße Prostituierte. Er ist Mulatte – weder schwarz noch weiß. Der achtzehnjährige Allen fühlt sich als Fremder in einer feindlichen Welt. Er weiß nicht, wo er hingehört, er weiß nur eins: Um seine Würde zu behalten, muss er bis zum Letzten kämpfen. Gegen seine Mutter, die ihn missbraucht, gegen seine Mitschüler, die ihn verachten. Nur die intelligente Josie steht auf Allens Seite. Doch Allen beschließt, alle zu Fall zu bringen: vor allem die, die ihn lieben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Zum Buch
Allen Smith ist Mulatte, weder schwarz noch weiß. Seine Mutter, die ohne sein Wissen als Edelprostituierte arbeitet, hat ihn als Kind missbraucht. Gleichzeitig verabscheut sie ihn. Allen, der seiner Mutter in einer abgründigen Hassliebe verbunden ist, hegt eine tiefe Abneigung gegen Frauen. Nach seinem Verweis aus der Militärschule zieht Allen mit seiner Mutter nach New York, um seinen Highschool-Abschluss zu machen. Sie wohnen in einer exklusiven Gegend nahe des East River, die meisten Nachbarn sind Weiße. Allen hasst diese Welt, und er hasst alle, die ihn erniedrigen.
Nur die intelligente Josie, schwarze Tochter eines weißen Cops, verliebt sich in Allen – trotz seiner abweisenden Haltung. Sie muss erfahren, dass Allens Hass vor niemandem haltzumachen scheint – besonders nicht vor denen, die ihm Gutes wollen. Es zeigt sich aber, dass Allen nicht der Menschenhasser ist, als der er auftritt; er will seine Mitmenschen nicht zerstören, sondern ihnen eine Lektion erteilen. Doch dann scheint Allens Welt zusammenzubrechen. Als er in einen Unfall verwickelt wird, bei dem ein Baby zu Tode kommt, gibt es nur einen Menschen, der seine Unschuld beweisen kann: Josies Vater …
Blind vor Wut ist der letzte Roman von Jim Thompson, der jetzt erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt.
Ebenfalls enthalten ist die in Deutschland bislang unveröffentlichte psychologische Novelle Ein Pferd in der Babywanne.
Zum Autor
Jim Thompson wurde 1906 in Anadarko, Oklahoma, als James Myers Thompson geboren. Er begann früh zu trinken und schlug sich als Glücksspieler, Sprengstoffexperte, Ölarbeiter und Alkoholschmuggler durch. Obwohl er bereits mit fünfzehn Jahren seine erste Kriminalgeschichte verkaufte, konnte er erst seit Beginn der Fünfzigerjahre vom Schreiben leben. Für Hollywood verfasste er zahlreiche Drehbücher, unter anderem für so namhafte Regisseure wie Stanley Kubrick. Thompson gilt als zentraler Vertreter des Noir-Genres. Er starb 1977 in Los Angeles, seine Asche wurde im Pazifischen Ozean verstreut.
JIM THOMPSON
Blind vor Wut
ROMAN
Aus dem Amerikanischenvon Peter Torberg
Mit einem Vorwortvon Ed Gorman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die amerikanische AusgabeCHILD OF RAGEerschien 2008 bei Centipede Press, Lakewood, Colorado
Vollständige deutsche Erstausgabe 12/2012Copyright © 1972 by Jim ThompsonCopyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Ulf MüllerUmschlaggestaltung: Melville Brand Design, München,unter Verwendung des Original-Artworks von © Harry O. MorrisSatz: C. Schaber Datentechnik, WelsISBN: 978-3-641-08604-6V002www.heyne-hardcore.de
Vorwort
Von Ed Gorman
Seit einer Weile schon ist die Lebensgeschichte von James Myers Thompson Bestandteil der amerikanischen Kultur. Er wurde am 27. September 1906 in Anadarko, Oklahoma, geboren. Zwischen diesem Zeitpunkt und seinem Tod am 7. April 1977 in Los Angeles führte er, trotz Frau und Familie, eine Art von Leben, wie man es bei vielen Alkoholikern findet – lange Phasen der Depression, fast mittellos, dazwischen ausgedehnte Aufenthalte in Entzugskliniken.
Dass er überhaupt schrieb, ist Beweis für seinen Drang, Worte aufs Papier setzen zu wollen. Noch überraschender ist zudem, dass er einen Großteil der abgegriffenen Metaphern seiner Zeit verwendete und sie in Literatur verwandelte.
»Niemand«, so der bekannte Schriftsteller R. V. Cassill unter Bezug auf Ikonen wie Hammett, Chandler oder Horace McCoy, »niemand hat je ein Buch geschrieben, das auch nur annähernd an Thompson herankam.« Cassills Aufsatz über Thompson trug den Titel »Furcht, Reinigung und das Licht des Sophokles«. Thompson wurde originellerweise auch als »Groschenheft-Dostojewski« bezeichnet.
In seinem Aufsatz kommt Cassill zu dem Schluss, dass kein anderer amerikanischer Autor die dunkle Seite des amerikanischen Lebens derart beschrieben hat wie Thompson selbst.
Thompsons ersten Arbeiten waren hauptsächlich für die True-Crime-Magazine bestimmt, die damals zu den populärsten Monatsheften gehörten. Sein eigenes Leben und eine journalistische Ausbildung bereiteten ihn auf die Bücher vor, die er später verfasste. Seine ersten beiden Romane, Jetzt und auf Erden (1942; 2011 erstmals auf Deutsch bei Heyne erschienen) und Heed the Thunder (1946), waren düstere Geschichten, die eher dem Mainstream zuneigten, nicht den Einflüssen der Kriminalliteratur. Sie brachten Thompson zwar Anerkennung, aber weder Geld noch Ruhm.
In den Fünfzigern gab es allerdings durchaus bemerkenswerte Ereignisse für Thompson. Anthony Boucher feierte ihn in der New York Times, und der junge Stanley Kubrick heuerte ihn an, um sowohl an The Killing (1956; dt. Die Rechnung ging nicht auf) als auch an Paths of Glory (1956; dt. Wege zum Ruhm) mitzuarbeiten.
Wenn Thompson nichts anderes getan hätte, als uns in seinen Werken auf eine weitere Führung durch die menschliche Hölle mitzunehmen, dann würden wir kein Wort über ihn verlieren. Dutzende von Autoren haben uns in den Vierzigern und Fünfzigern auf solche Touren mitgenommen.
Doch denkt man daran, dass Jonathan Swift sein Lieblingsschriftsteller war, dann fangen wir an zu begreifen, wie originell und hinterhältig seine besten Werke waren.
Hier geht es nicht um die Serienkiller und Irren aus den üblichen Schundheftchen. Thompsons Helden spielen oftmals die Rolle des Unterlegenen, um so ihr wahres Ich vor den vermeintlich Stärkeren zu verbergen – dies ist ihre Stärke.
Thompsons Bücher handeln im weitesten Sinne von Moral. Wie Dashiell Hammett es ausdrückte, sieht Thompson sehr deutlich, dass alles, was die Menschen sagen, nur sehr wenig mit dem zu tun hat, was sie tun. Ganz offenkundig dient die Verkleidung als Dummkopf – das Sich-Verbergen in Gestalt des Narren – nur dazu, die »Überlegenen« zu verhöhnen, was diese meistens gar nicht erkennen.
Der zweite Vorteil einer solchen Strategie liegt darin, dem Opfer (dem »Stärkeren«) eine Falle zu stellen. Ohne zu wissen, mit wem – oder womit – sie es zu tun haben, sind sie ganz den Täuschungen des »Schwächeren« ausgesetzt. Dieser weiß genau, was er tut; sie hingegen haben nicht die leiseste Ahnung. Viele von Thompsons Hauptfiguren sind gnadenlose Jäger.
Blind vor Wut weicht von den vertrauten Pfaden Thompsons ab. Ein verwirrter, verwirrender Roman. Wie viele Kritiker bemerkten, beschloss Thompson offenbar, dass sein Background und sein scharfer Blick für die politischen Bewegungen ihn dazu prädestinierten, eine Untersuchung der afroamerikanischen Bewegung der Sechziger und Siebziger zu schreiben. Das Buch ist in höchstem Maße politisch unkorrekt und gewiss nicht für die Schwachen bestimmt, auch wenn Thompson dies offensichtlich als Satire meinte.
Blind vor Wut ist, gelinde gesagt, nicht gerade der Erfolg geworden, auf den Thompson immer gehofft hatte. Mit all dem Rassismus, den Andeutungen von Inzest, Irrsinn, Schwulenfeindlichkeit und mehreren Formen sexueller Perversion ist dies wohl Thompsons am wenigsten gelesener, aber am meisten diskutierter Roman.
Kein ernsthafter Leser Thompsons kann allerdings ohne dieses Buch auskommen. Blind vor Wut nimmt einen besonderen Platz in Jim Thompsons Werk ein. Es ist das faszinierende Experiment eines Mannes, der voller Unruhe in eine neue Richtung gehen will – koste es, was es wolle.
Ed Gorman, geboren 1941, ist ein legendärer amerikanischer Thriller- und Mystery-Autor, der zahlreiche Preise gewann. Als Co-Autor von Dean Koontz schrieb er Frankenstein: Die Kreatur, den zweiten Teil der Frankenstein-Serie, erschienen im Wilhelm Heyne Verlag.
1.
Ich hatte Mutter nicht begleitet, als sie die Wohnung mietete (natürlich nicht!). Die Leute hatten mich kurz gesehen, als wir einzogen, aber ich schätze, sie hielten mich für irgendeinen Burschen, den Mutter angeheuert hatte, um ihr zu helfen. Die Wahrheit ging ihnen erst am nächsten Morgen auf, als wir zusammen zu der Schule gingen, in der ich angemeldet werden sollte.
Unser Apartment lag in einem sogenannten »Garten«-Wohnkomplex am East River. Garten hieß, dass zwischen den einzelnen Gebäuden Grünflächen lagen. Als wir den Weg zwischen den Häusern hindurch nahmen, achtete Mutter sorgsam darauf, dass alle, die uns vielleicht beobachteten (was wohl der Großteil der anderen Mieter gewesen sein durfte), meinen wahren Status erkannten. Sie schnatterte und lachte mich auf ihre aufgekratzte Art an. Ab und zu drückte sie mir die Hand oder legte mir kurz den Arm um die Schultern und presste mich an sich.
»Ist das nicht hübsch hier, Allen?«, fragte sie fröhlich. »Ich bin sicher, wir werden hier sehr glücklich werden, meinst du nicht?«
»Hübsch. Sicher«, antwortete ich.
»Wie bitte, Schätzchen?«
Ich sagte, ich hätte ihre beiden Fragen damit beantwortet: Es sei ein hübsches Fleckchen, und ich sei mir sicher, dass wir beide hier glücklich werden würden.
Sie senkte die Stimme ein wenig und schaute besorgt. »Dies könnte der Beginn eines wundervollen neuen Lebens für dich sein, Allen. Du wirst es doch versuchen, oder? Du machst doch deiner Mutter keinen Ärger mehr?«
»Ja und nein«, antwortete ich.
»Wie bitte?«
»Ja, ich werde es versuchen. Nein, ich mache meiner Mutter keinen Ärger mehr.«
»Mal sehen. Ist dein Termin beim Psychiater nächste Woche oder diese?«
»Nächste. Montagnachmittag.«
Wieder sah sie mich besorgt an. »Du bist heute Morgen nicht sehr gesprächig, Allen. Macht dir etwas Sorgen?«
»Ach, ich frage mich nur«, antwortete ich.
»Was denn?«
»Warum musstest du einen Schwarzen heiraten …«
Das fröhliche kleine Lächeln verschwand von ihrem Gesicht. »Ach, Allen«, sagte sie nur.
»Und wenn es schon sein musste, warum konntest du dir dann nicht einen nehmen, der etwas hellere Haut hatte?«
Wir gingen am Fluss entlang zur Schule. In der Ferne hinter Hell Gate malte die Morgensonne die Skyline Manhattans in atemberaubenden Pastelltönen.
»Allen«, sagte sie. »Du hast doch versprochen, mir keinen Ärger mehr zu machen.«
»Ich mache dir keinen Ärger«, erwiderte ich. »Die Umstände tun das. Und die Umstände kontrollierst du.«
»Was soll das denn heißen?«
»Denk drüber nach«, sagte ich. »Denk dran, ich komme heute und jeden weiteren Abend ein paar Stunden vor dir nach Haus …«
»Und?«
»Ist ’ne ziemlich schicke Gegend, in die wir hier gezogen sind. Nur Weiße, obere Mittelschicht. Überall werden Sicherheitsleute sein. Was, glaubst du, wird passieren, wenn ein pechschwarzer Bengel auftaucht und in eine der Wohnungen will?«
»Du hast ein Recht, hier zu sein, Allen! Genau wie alle anderen!«
»Aber klar doch«, entgegnete ich.
Sie seufzte und sah sich nach einem Schlepper um, der den Fluss hinunterfuhr. Ein paar Bootsleute lehnten an der Reling, gafften Mutter an – und fragten sich wahrscheinlich, was sie mit diesem Negerlümmel zu schaffen hatte. Jemand an Bord, vielleicht der Kapitän, ließ die Schiffssirene heulen wie einen Wolf.
Mutter lachte und winkte. Ich machte eine lange Nase. Wieder seufzte sie und zögerte; dann zog sie mich auf eine der Bänke am Flussufer.
»Mach dir keine Sorgen, Allen«, sagte sie leise. »Die Hausverwaltung wird alles tun, damit es keine Schwierigkeiten gibt. Ich habe mich ein wenig mit ihnen unterhalten, bevor ich die Wohnung gemietet habe. Ein offenes, klärendes Gespräch. Die Hausverwaltung steht in letzter Zeit unter ziemlichem Druck vonseiten der Wohnungsbaubehörden. Deshalb …«
»Ich versteh schon«, unterbrach ich sie. »Ich bin Beweisstück A, stimmt’s? Der Beweis, dass sie Schwarze nicht diskriminieren. Vielleicht könnte ich ihnen ja ein paar Piepen dafür abknöpfen, dass ich hier wohne.«
Sie sah in ihren Schoß hinunter und zerknüllte ihr Taschentuch. »Ich wollte es dir eigentlich gar nicht sagen«, erklärte sie. »Mir fiel keine taktvolle Erklärung ein, irgendetwas, das dich nicht beleidigt hätte, also wollte ich gar nichts sagen. Aber als ich merkte, welche Sorgen du dir machst …«
»Die Irrungen und Wirrungen der Mutterschaft«, sagte ich. »Es bricht mir das Herz!«
»Allen«, meinte sie. »Sag mir einfach nur, was ich tun soll. Sag es mir, und ich tu’s!«
»Nein, tust du nicht«, entgegnete ich.
»Doch, wirklich! Ich werde alles tun, um dich glücklich zu machen.«
»Na gut«, sagte ich. »Dann kehr den Geburtsprozess um. Schick mich wieder dorthin zurück, wo ich hergekommen bin.«
Auf ihrem Gesicht jagte ein Gefühlsausdruck den nächsten. Sie sprang auf und ging weiter am Fluss entlang zur Schule. Ich musste laufen, um sie einzuholen.
»Hör mal«, sagte ich. »Wozu die ganze Aufregung? Ich habe nichts getan. Ich habe versprochen, dass ich keinen Ärger mache, und den mache ich auch nicht.«
»So wie heute Morgen, ja? Du bist mal wieder so fröhlich und höflich wie nur was!«
»Tut mir leid«, sagte ich. »Entschuldigung. Ich war nur nervös und aufgeregt, und …«
»Schon gut«, unterbrach sie mich. »Schon gut!«
Was bedeutete, dass nichts gut war. Und sie anzuflehen hätte auch nichts gebracht. Nichts hätte etwas gebracht – nicht mal, mich anständig zu benehmen, wie sie ständig von mir verlangte. Was immer ich tat oder nicht tat, andauernd kriegte ich dafür einen Tritt in den Hintern. Und das war schon immer so …
Ich gab ihr natürlich nicht die Schuld dafür.
Ich an ihrer Stelle hätte es auch gehasst, eine gut aussehende weiße Braut, die das Pech hatte, ein strubbelköpfiges schwarzes Kind mit sich herumschleppen zu müssen.
Ich hätte es gehasst.
2.
Nehmen Sie ein beliebiges größeres Ziegelsteingebäude. Irgendein altes, schlecht entworfenes dreistöckiges Haus. Stellen Sie es auf spärliches Grasland von ungefähr der Fläche eines Häuserblocks. Beschmieren Sie die von Gießfehlern schimmernden Fensterscheiben. Ölen Sie die ungewischten und nur halb gefegten Fußböden ein. Stopfen Sie doppelt so viele Schüler hinein wie vorgesehen. Das Ergebnis: eine Schule in New York City. Praktisch jede Schule in New York City.
Diese eine Schule.
Ein Tresen quer durch das Vorzimmer des Schuldirektors trennte den Empfangs- vom Arbeitsbereich. Eine junge Frau von etwa achtzehn Jahren – hellbraune Haut, glatte, schwarzbraune Haare – schrieb an dem Tisch auf der anderen Seite des Tresens auf der Schreibmaschine. Ich blieb ein paar Schritte zurück, als meine Mutter auf die Barriere zuging und ihren Namen und den Grund ihres Kommens nannte.
Die junge Frau lächelte sie an – und was für ein hübsches Lächeln.
»Eine Neuanmeldung? Ach, dafür brauchen Sie nicht zum Direktor. Das kann ich …«
»Wie heißen Sie?«, wollte meine Mutter wissen.
»Warum, ähm – Josie – Josephine, Ma’am. Josephine Blair.«
»Und glauben Sie nicht, Miss Josie Josephine Blair, dass ich besser weiß als Sie, was für meinen Sohn nötig ist?«
»N-nun, also, ja, Ma’am. Aber …«
»Danke«, sagte meine Mutter. »Vielen, vielen Dank!« Und damit schritt sie durch die Schwingtür im Tresen und trat ins Büro des Direktors, bevor Josie Blair auch nur einmal mit ihren großen, schönen Augen blinzeln konnte. Ich wollte Mutter folgen, doch plötzlich war die junge Frau hellwach.
»Ja, bitte?«, fragte sie und baute sich vor mir auf. »Kann ich was für dich tun?«
»Ich bin der neue Schüler«, antwortete ich. »Allen Smith.« Dann setzte ich noch anständigerweise hinzu, damit sie verstand: »Der Sohn von Mrs. Mary Smith. Der Lady, die gerade so viel Staub aufgewirbelt hat, als sie da reingegangen ist.«
»Schluss jetzt!« Josie stampfte mit dem Fuß auf. »Was genau hast du … du …«
Ihr versagte die Stimme. Trotz meiner schwarzen Haut, meines wolligen Schopfs erkannte sie die Ähnlichkeit zu meiner Mutter.
»Es tut mir so leid«, sagte sie. »Ich hab nicht, ähm, gewusst …«
»Vergiss es«, erwiderte ich. »Ich such nur nach dem Scheißhaus.«
Ich fragte sie, ob ich mir ein Stück Kreide ausleihen könnte, weil ich doch so gern schmutzige Bildchen an Klowände malen würde. Josie starrte mich immer noch an und versuchte, ihre Fassung wiederzuerlangen, als Mutter rief: »Allen!« Also ging ich ins Büro des Direktors.
Sein Name, also der des Direktors, lautete Velie. Ich schätzte ihn auf Mitte dreißig, etwa so alt wie Mutter, und so, wie er gebaut war, hätte er auch als Spielertrainer im Football durchgehen können. Ich konnte sehen, dass Mutter ihn schon in der Gesäßtasche hatte, bildlich gesprochen. Was, um die Wahrheit zu sagen, der Stelle ziemlich nahe kam, an der er jetzt wohl ganz gern gewesen wäre.
Mutter hatte das Zeug dazu, verstehen Sie, was ich meine? Sie war bis obenhin voll davon. Der arme alte Papa hatte sich in Korea den Arsch wegschießen lassen, aber vorher hatte er sich noch einen hübschen Hintern geangelt.
Natürlich gibt es noch andere Frauen, die genauso viel vorzuweisen hatten wie Mutter, mit ähnlich schönen Gesichtern und Körpermaßen. Allerdings hatte ich noch keine gesehen, die so gut darin war, das alles auch angemessen zu verpacken. Ein Blick auf das Kostüm von Saks Fifth Avenue – heruntergesetzt auf $ 399,99. Ein Blick auf diesen Hauch von einem Hattie-Carnegie-Hut – etwas ganz Besonderes, $ 140. Ein Blick auf die handbestickte Bluse von I. Magnin – nur$ 112,50. Ein Blick auf …
Direktor Velie riskierte einen Blick. Denselben, den er offenbar riskiert hatte, als er sie das erste Mal zu Gesicht bekam. Er besah sich all die netten Dinge und die hübsche Verpackung drumherum und entschied, dass es sich um Güter handelte, die seine kühnsten Vorstellungen übertrafen. Er entschied auch, dass sie vielleicht zu haben sei. Was ganz verständlich war.
Eine Frau, die es mit einem Schwarzen treibt, hat es offenkundig ziemlich nötig.
Eine Frau, die es mit einem Schwarzen treibt, wird einen Weißen erst recht ranlassen.
»Also gut!«, sagte Velie, der es endlich schaffte, seine Augen von ihr zu nehmen und mich anzulächeln. »Ich bin sehr froh, dass du dich unserer Schule anschließt, Allen.«
»Danke, Sir«, erwiderte ich.
»Deine Mutter hat mir eine Abschrift deiner Noten von der Militärakademie gezeigt. Sehr gut, Allen. Sehr, sehr gut.«
»Danke …«
»Mr. Velie«, unterbrach ihn Mutter. »Habe ich eigentlich meine Privatnummer auf die Karte geschrieben, die ich Ihnen gegeben habe? Ach da, ich sehe schon. Nun, Sie können mich jederzeit nach sechs Uhr abends anrufen. Und während der Geschäftszeiten erreichen Sie mich natürlich im Büro. Sollte ich beschäftigt sein, hinterlassen Sie einfach Ihre Nummer, und ich rufe umgehend zurück.«
Velie nickte und lächelte. »Danke, Mrs. Smith. Ich werde …« Er unterbrach sich und fuhr sich zögernd mit der Zunge über die Lippen. »Sie anrufen?«, fragte er.
»Ja. Wegen Allen. Nur für den Fall, dass sie ein Problem mit ihm haben.«
»Problem? Ich verstehe nicht ganz, ähm …«
»Allen stiehlt manchmal«, erklärte Mutter. »Er lügt außerdem; er ist ein überaus einfallsreicher und überzeugender Lügner. Und wenn er wütend ist, kann er sehr ausfallend werden. Nicht nur das, sondern …«
Sie führte den Teil mit dem »Nicht nur das« nicht weiter aus. Das konnte sie nicht. Es hatte nie einen Beweis dafür gegeben. Nur Indizien, und die hatten nicht gereicht, damit die Polizei hätte einschreiten können.
Velie hatte sich umgedreht und sah zum Fenster hinaus. Wahrscheinlich schaute er gerade zu, wie der Hintern seiner Träume vor seinen Augen davonflatterte.
»Mrs. Smith«, murmelte er. »Wir sind hier wirklich nicht darauf eingerichtet, uns mit Problemfällen auseinanderzusetzen.«
»Allen ist in der letzten Klasse, Mr. Velie. Und da er in nicht mal einem Jahr seinen Abschluss machen wird – in etwa sieben Monaten, um genau zu sein …«
»Ich weiß. Aber ich finde nicht …«
»Ich bin mir sicher, Sie haben auch noch andere Schüler, die stehlen, Mr. Velie. Andere, die lügen und ab und zu unflätige Wörter in den Mund nehmen. Ich glaube, dass Eltern am besten mit der Schule kooperieren, wenn sie ihrem Kind vollkommen objektiv gegenüberstehen, deshalb habe ich Ihnen ja alles gesagt. Ich kann nicht glauben, dass sie mich oder meinen Sohn dafür bestrafen wollen, dass ich Ihnen die Wahrheit über ihn gesagt habe, statt sie Ihnen zu verheimlichen.«
Das konnte Velie selbst nicht glauben. Man durfte doch sicherlich die Ehrlichkeit nicht bestrafen und die Verschlagenheit auch noch belohnen. Wo kämen wir da denn hin, nicht wahr?
Und dann war da noch dieser saftige Hintern, der sich mitten im Flug umdrehte und wieder zum Fenster zurückgeflattert kam.
»Nun, da ist viel Wahres an dem, was Sie sagen, Mrs. Smith«, meinte Velie wissend, womit er zum Ausdruck brachte, dass da ziemlich viel in der handbestickten Bluse von I. Magnin steckte. »Ich bin allerdings noch nicht ganz sicher, ob es nicht doch besser wäre, wenn Allen auf eine Privatschule ginge, aber …«
»Einige sehr gute Psychiater sehen das anders«, widersprach Mutter. »Allen wird sein eigenes Leben führen müssen, das Leben eines Schwarzen in einer weißen Gesellschaft, in einer Umgebung ohne Schutz. In der Gesellschaft an sich, meine ich, nicht in einem geschützten Teil davon. Die Psychiater sind der Ansicht, dass seine Anpassung am besten gelingen wird, je früher er mit dieser Gesellschaft ins Reine kommt.«
Velie nickte, wirkte aber leicht bedrückt. Es ist grausam, einem Mann gegenüber von Psychiatrie zu sprechen, der gerade von einem Hintern träumt.
»Aber Mr. Velie!« Mutter warf ihm einen aufreizenden Blick zu. »Sie sind doch sicher nicht einer von denen, oder?«
»Ähm – von welchen, Mrs. Smith?«
»Sie wissen schon. Einer von denen, die schon bei der Erwähnung des Wortes Psychiatrie blass werden!« Sie lachte heiter. »Das kann ich nicht glauben. Sie doch nicht. Nicht der Direktor einer großen Highschool!«
Tja …
Velie erklärte, das sei ganz und gar nicht der Fall. Weit gefehlt, usw. Tatsächlich glaube er sehr fest an die Psychiatrie, usw. Er nahm einen Stundenplan aus seiner Schreibtischschublade, schrieb meinen Namen und weitere Hintergrundinformationen darauf, dazu Mutters Name, Beruf und so fort. Dann vertiefte er sich in ein Themen- und Klassenbuch und listete Zeit und Art meiner Fächer auf.
»Also«, sagte er und sah auf seine Uhr. »Die erste Stunde ist in etwa fünf Minuten zu Ende. Wenn du jetzt sofort anfangen möchtest, Allen …«
Ich sagte: »Ja, Sir.«, und stand auf. Mutter blieb sitzen.
»Nun lauf schon los, Schatz. Ich unterhalte mich noch einen Augenblick mit Mr. Velie, wenn ich darf.«
»Aber selbstverständlich«, erklärte Velie. »Allen, gib deinen Stundenplan der jungen Dame da draußen – sie heißt Josie …«
»Danke, Sir. Und auf Wiedersehen, liebste Mutter«, sagte ich.
Ich beugte mich über sie und gab ihr einen satten Kuss auf den Mund. Sie wich natürlich ruckartig zurück, warf ihr Gewicht nach hinten, und ich machte eine kleine Bewegung mit dem Fuß gegen die Stuhlbeine. Ich zog am Stuhl, während sie sich nach hinten lehnte.
Mutter stieß einen spitzen Schrei aus und machte fast einen Rückwärtssalto. Ihr Rock flog hoch, ihre Bluse löste sich aus dem Bund und gab Velie einen schnellen freien Blick auf alles, was sie vom Arsch bis zum Appendix zu bieten hatte.
Ich richtete sie im letzten Augenblick auf und murmelte Entschuldigungen. Mutter war viel zu sehr damit beschäftigt, sich die Kleidung wieder herzurichten, um aufzustehen und mich umzubringen, was sie zweifellos noch vorhatte, also floh ich lieber heil und am Stück ins Vorderzimmer.
Dort gab ich Josie Blair meinen Plan und setzte ein leicht entschuldigendes Lächeln auf.
»Bitte verzeih meine rüde Ausdrucksweise vorhin«, sagte ich. »Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, aber das war sicher keine Art einer netten jungen Dame wie dir gegenüber.«
»Meine Schuld«, sagte sie herzlich. »Ich kann dir nicht verdenken, dass du wütend bist.«
»Nein, nein«, entgegnete ich. »Das war ganz allein meine Schuld. Ein Wort von dir, und ich gehe vor dir auf die Knie und küsse dir die Füße.«
Sie schaute mich nervös und fragend an. Ich verbeugte mich und machte eine ausladende Handbewegung hin zum Tresen. »Wenn du so freundlich wärst und mir zeigen könntest, wo meine erste Stunde stattfindet …«
»Oh, ähm, aber ja. Natürlich.«
Ich ging schnell vor und hielt die Schwingtür weit auf, damit sie mir vorausgehen konnte. Josie lächelte zum Dank ein wenig, ging hindurch, und ich …
Na, Sie können sich ja denken, was ich gemacht habe.
Die Tür traf sie so hart am Hintern, dass es sie fast aus den Schuhen warf. Sie gab ein schockiertes, schmerzvolles »Uff« von sich und stolperte voran gegen die Wand. Ich schob sie schnell auf den Gang hinaus, damit Mutter und Velie nichts mitbekamen, und gab einen solchen Schwall von Entschuldigungen von mir, dass ich es fast selbst geglaubt hätte.
»Das war ja furchtbar«, sagte ich und beklopfte ihr den Hintern, als wollte ich ihn abstauben. »Sie ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Im einen Augenblick hielt ich sie noch fest, und im nächsten – ich hoffe, du bist nicht verletzt. Ich würde mir niemals verzeihen, wenn ich dir wehgetan hätte …!«
Und so weiter und so weiter, und dabei machte ich ein Gesicht, als würde ich gleich losflennen. Ich kann eine ziemliche Schau abziehen, wenn ich will (fragen Sie Mutter!). Also war Josie Blair bald überzeugt und schaffte es sogar, trotz Tränen in den Augen ein Lächeln aufzusetzen.
»So was kommt schon mal vor«, sagte sie. »Vergessen wir es einfach, hm?«
»Du bist zu gütig«, meinte ich. »Ich sollte auf die Knie gehen und dir die Knöchel küssen. Dir tun doch bestimmt die Knöchel weh, oder? Wenn man so nach vorn stolpert.«
»Wir sollten uns besser beeilen«, erwiderte sie und marschierte los den Gang entlang. »Du kommst sonst zu spät zu deiner ersten Stunde.«
»Lieber zu spät kommen, als dich leiden sehen«, beharrte ich. »Wo tut es dir denn weh? Sag es mir, und ich gehe auf die Knie und …«
»Wir sind im selben Klassenzimmer, wie ich sehe«, meinte sie, als sie einen Blick auf meinen Plan warf. »Miss Critchetts Raum. Du wirst sie bestimmt mögen, Allen.«
»Im selben Klassenzimmer?«, fragte ich. »Du gehst also hier zur Schule?«
»Ja. Ich arbeite nur ein paar Stunden im Büro.«
»Und wann beschubst du?«
»Also, ich – was?« Sie starrte mich wütend an und blieb stehen. »Was hast du da gerade gesagt?«
»Wann du schrubbst, meinst du das?«
»Das hast du nicht gesagt! Jetzt hör mal zu, Mr. Allen Smith. Ich habe mir ja eine Menge von dir gefallen lassen und viel Verständnis für dich gehabt. Aber falls du auch nur eine Sekunde lang glaubst, ich …«
»Warte!«, unterbrach ich sie. »Warte mal, Josie! Ich wollte dir nur ein Kompliment machen. Ich hab nur geraten, ich meinte damit, ob du Geige spielst. Nur geraten. Alle Geigerinnen, die ich bisher gesehen habe, hatten solche Hände wie du, wohlgeformt, mit wunderschön schmalen Fingern, also hab ich gedacht, du schrubbst die Geige. Und selbst wenn nicht, dachte ich, das wäre doch nett, so etwas zu sagen.«
Sie sah mich streng und mit zusammengekniffenem Mund an. Ich erwiderte den Blick ernst, besorgt, verwirrt. Ein unschuldiges Kind, das für sein dargebotenes Geschenk eine Ohrfeige kassiert hat.
»Nun«, sagte sie voller Argwohn. »Also.«
»Ich glaube, ich finde den Weg jetzt allein«, fuhr ich fort. »Ich scheine andauernd das Falsche zu tun und zu sagen, ganz gleich, wie sehr ich mich anstrenge. Wenn du mir jetzt einfach nur meinen Stundenplan gibst …«
Das überzeugte sie. Josie lächelte plötzlich, wenn auch ein wenig zweifelnd, und meinte, wir seien wohl beide ein wenig genervt.
Ich nickte steif und ließ sie spüren, dass sie mich tief verletzt hatte. Wir gingen die Treppe in den ersten Stock hinauf, und Josie erklärte, sie würde zwar keine Geige spielen, hätte es aber immer tun wollen. Ich schwieg weiter – war zu verletzt, um zu sprechen, Sie verstehen –, und sie fragte schüchtern, ob ich denn ein Instrument spielen würde.
»Flöte«, antwortete ich. »Ich spiele auf der Flöte, solange ich denken kann.«
»Das ist aber nett. Du musst ziemlich gut darin sein.«
»Bin ich auch. Ich kann beidhändig spielen.«
»Das ist ganz schön ungewöhnlich, oder? Spielst du in einem Orchester?«
»Nein, ich glaube, das würde mir nicht gefallen«, antwortete ich. »Manche machen das, ich weiß, aber ich bin gern mit mir allein. Ich geh einfach ins gute alte Badezimmer und schließe ab. Und dann …«
»Du schmutziger, widerlicher Mistkerl«, sagte Josie mit leiser, gepresster Stimme. »Man sollte dir den Mund auswaschen.«
»Mund?«, entgegnete ich. »Meine Mutter sagt immer nur, ich soll mir die Hände waschen.«
Josie wollte etwas erwidern, verschluckte sich an den Worten, stotterte. Ich grinste sie an, während sie vor einer Tür stehen blieb. Sie machte eine ruckartige Bewegung mit dem Kopf.
»Das ist dein Klassenzimmer«, erklärte sie. »Und ich hoffe, du – ich hoffe …«
»Du seifst mich ein?«, fragte ich und legte mir eine Hand hinters Ohr. »Das würde ich auch wirklich gern mal tun, Schätzchen, dich einseifen.«
Josie machte auf dem Absatz kehrt und ging davon. Dann wurde sie langsamer und blieb stehen. Sie drehte sich um und kam zu mir zurück.
»Du willst doch nur, dass ich dich bei Mr. Velie melde, stimmt’s?«, fragte sie. »Du willst aus der Schule geschmissen werden.«
»Geh und scheiß dir in den Hut!«, erwiderte ich.
»Es ist hart, eine weiße Mutter zu haben, stimmt’s? Das macht einem das Leben sehr schwer, wenn ein Elternteil so jemand ist wie deine Mutter.«
Ja, es sei hart, antwortete ich. Sie würde ja nicht glauben, wie viel ich für Unterhosen ausgeben müsse. Als Josie nichts erwiderte, sondern mich einfach nur mit stillem Mitgefühl ansah, sagte ich ihr, sie solle sofort damit aufhören, um Gottes willen.
»Wage es ja nicht, mich zu bemitleiden, du blöde Niggerin! Du kannst dein Mitleid nehmen und es dir sonst wohin stopfen …«
Eine Glocke schrillte laut und übertönte meine Stimme. Zeit, die Räume zu wechseln. Die Türen sprangen auf, Kinder strömten auf die Gänge hinaus, und Josie Blair verschwand zwischen ihnen. Sie ging wohl zurück an die Arbeit oder zu dem, was sie sonst um diese Tageszeit machte.
Ich hatte also keine Gelegenheit mehr, ihr zu sagen, wie leid es mir tat.
Ich hatte keine Gelegenheit mehr, mich auf sie zu stürzen, ihr den Ausdruck gütigen Verständnisses aus dem Gesicht zu prügeln und ihr die hassenswert mitfühlenden Augen auszureißen.
3.
Auf den Gängen oder in den Klassenräumen, in die ich einen Blick werfen konnte, sah ich nur wenige Schwarze. Vielleicht einen unter fünfzig Weißen. Nicht dass mich das sonderlich gekümmert hätte, wissen Sie? Das soll nur eine Information sein. Es würde mich nicht die Bohne kümmern, wenn jeder schwarze Scheißer im Lande an blutenden Hämorrhoiden krepieren würde.
Ich stand ein wenig abseits von der Tür zum Klassenzimmer und sah zu, wie die anderen Schüler den Raum betraten. Schließlich waren alle da, wie es aussah, und alle waren sie weiß.
Ich beugte mich vor und band mir die Schuhe neu. Dann richtete ich mich wieder auf und betrachtete meinen Stundenplan. Zumindest tat ich so. Ich fragte mich, wo ich mich verstecken konnte, wenn ich die Stunde schwänzte, und was ich machen sollte, wenn die nächste Klasse auch rein weiß wäre. Was, wenn sie alle weiß sind? Mir fiel die Militärakademie wieder ein – dabei hatte ich alles nur Erdenkliche unternommen, um sie zu vergessen –, und mir wurde richtig übel.
Mutter hatte auf der Akademie dieselbe Nummer durchgezogen, die sie auch schon andernorts gebracht hatte. Sie ließ mich einschreiben, bevor die Lehrer einen Blick auf mich werfen konnten. Die Akademie war in Maryland gewesen (Mutter arbeitete zu der Zeit in Washington). Es gab da irgendeine Absprache mit dem Verteidigungsministerium, wodurch die Akademie in den Genuss eines saftigen Zuschusses durch den Staat kam. Das und die Tatsache, dass Mutter gut mit ein paar Kongressabgeordneten und Senatoren konnte …
Spaß? Da können Sie wetten. Ein Schwarzer auf fünfzehnhundert Weiße – der nette alte General (i. R.) nannte das den Stolz und die Hoffnung des Südens. In der Messe hatte ich meinen eigenen Tisch. Ich schlief in meinem eigenen Zimmer, nicht im Schlafsaal. Ich hatte in der Turnhalle meine eigene Dusche mit meinem Namen drauf. Ich war aus »körperlichen Gründen« vom Exerzieren befreit, sonst hätte ich wohl meinen eigenen Exerzierplatz gekriegt.
Ich hatte gute Noten – die habe ich immer, ganz egal wo –, aber ich musste nichts dafür tun. In den neun Monaten dort wurde ich nicht ein einziges Mal aufgerufen, und ich wurde auf die Ehrenrolle jener Schüler gesetzt, die vom schriftlichen Examen befreit waren.
… Wieder schrillte die Glocke. Die Nachzügler eilten in letzter Minute in die Klassenzimmer. Überall im Gang klappten die Türen zu. Ich stand noch immer da und fragte mich, was zum Teufel ich machen sollte.
Dann hörte ich ein leises Schlurfen in der Nähe. Das weckte meine Aufmerksamkeit. Ich sah auf, schaute mich um, und da stand dieser dürre Schwarze, der mich nervös angrinste. Er war etwa siebzehn und sah gar nicht übel aus. Wenigstens war er nicht so ein Wollkopf wie ich. Er trug einen glänzenden blauen Anzug, der ihm vielleicht zwei Nummern zu klein war. Die Hosen endeten knapp über den Knöcheln, und auch die Jackenschöße waren ein paar Zentimeter zu kurz.
»Wie geht’s?«, fragte er.
»Wie geht’s?«, antwortete ich.
»Willst du da rein?«, wollte er wissen und nickte in Richtung der Tür zur Geometrie-Klasse.
»Und du?«, fragte ich zurück.
»Na ja, bin noch nicht drin gewesen.«
»Dann bringen wir’s mal hinter uns«, sagte ich.
Gerade als die Lehrerin die Tür schließen wollte, gingen wir hinein. Sie kontrollierte unsere Stundenpläne und sah uns dann stirnrunzelnd an. Es sei bereits die dritte Schulwoche, betonte sie. Warum wir erst jetzt in die Klasse kommen würden?
»Du, Gerald … Gerald Franklin«, sagte sie und sah den dürren Burschen an. »Wo bist du gewesen?«
»Ich?«, erwiderte er. »Meinen Sie mich, Ma’am?« Er rollte mit den Augen und setzte ein maulaffiges Schwarzengesicht auf. »Also, mal sehn. Tja, wo war ich noch gleich?«
Die Klasse brüllte vor Lachen. Ich hätte den Mistkerl erschlagen können! Die Lehrerin meinte, er werde die Ausfallstunden nachholen müssen, und sagte, er solle sich setzen. Der Bursche schlurfte nach hinten, und eine Welle von Gelächter folgte ihm, weil er weiter auf blöde machte.
»Und nun zu dir, Allen … Allen Smith …« Die Lehrerin drehte sich zu mir um. »Wo bist du gewesen?«
»Ich, Miss Joan … Miss Joan Carter?«, fragte ich zurück.
»Ja, du! Ich will wissen – ach«, sagte sie, und ihre Stimme wurde freundlicher, nachdem sie einen zweiten Blick auf meinen Stundenplan geworfen hatte. »Tut mir leid, Allen. Du bist neu, wie ich sehe.«
»Nee, Sir, Ma’am, nee, Ma’am, niemals!«, verkündete ich. »Ich bin noch ganz der Alte. Is einfach nur ’ne andere Schule.«
Wieder Gelächter in der Klasse, aber nicht so wie beim ersten Mal. Da war eine gewisse peinliche Berührtheit, eine Zurückhaltung. Mrs. Carter runzelte die Stirn, damit die Schüler Ruhe gaben, dann fragte sie mich, wo ich zur Schule gegangen sei. Ich antwortete, das sei im guten alten Süden gewesen, jawoll Ma’am, aber sicher. Sie zögerte und fragte mich dann, ob ich schon ebene Geometrie durchgenommen hätte.
»Eben, Ma’am?« Ich kratzte mich am Kopf und gab ein lautes, glückliches Onkel-Tom-Lachen von mir. »Eben nicht, Ma’am, im Gegenteil! Kam mir eher furchtbar holprig vor, aber wirklich!«
Die Klasse prustete aus vollem Halse los, alle Peinlichkeit war verflogen. Selbst Mrs. Carter musste lächeln, was ihrem Gesicht noch um die hundert Falten mehr bescherte.
»Also, Allen«, murmelte sie. »Ich bin mir nicht sicher, ob du, ähm – welchen Geometrietext habt ihr denn in deiner letzten Schule benutzt?«
»Text, Ma’am? Ach, das Buch meinen Sie, wo wir drin gelernt haben«, sagte ich und nickte zu dem Buch auf ihrem Pult. »Schätz mal, dasselbe wie das da, Ma’am. Sieht jedenfalls ganz so aus.«
»Ich fürchte nicht«, meinte sie freundlich. »Das Buch dort benutzen wir gar nicht hier im Kurs. Das ist Trigonometrie.«
»Trigo-was, Ma’am?«, fragte ich. »Nicht so wichtig«, sagte sie mit immer sanfterer Stimme. »Ich fürchte, hier liegt ein Irrtum vor, Allen. Verstehst du, das hier ist ein Kurs in Raumgeometrie. Und du kannst hier nur teilnehmen, wenn du vorher ebene Geometrie hattest …«
»Hab ich auch gehabt, Ma’am. Ehrlich«, sagte ich. »Ich hab ’ne Menge von all dem Mathemarithmetikzeugs gemacht. Ja, Ma’am, und das auch wirklich gut. Die alte Lehrermiss hat gemeint, die Bücher sind zu leicht für mich, also hab ich mir meine eigenen Aufgaben ausgedacht.«
Mrs. Carter nickte verständnisvoll. »Das freut mich sehr, Allen. Ich bin sicher, du hast immer dein Bestes gegeben, und …«
»Ich zeig’s Ihnen«, erklärte ich. »Ich rechne Ihnen mal jetzt gleich eine Aufgabe von mir vor.«
Noch bevor sie mich aufhalten konnte, stand ich mit einem Stück Kreide in der Hand an der Tafel:
»Gegeben sei ein Kegel aus einer Nickellegierung mit einem Molybdän-Anteil von 38 Prozent. Der Umfang des Kegels beträgt an der Basis 76,5324979 Zoll mit einer Toleranz von 2,2 Zoll auf 10000 Zoll. Die Abmessung an der Spitze ist genau null, natürlich ohne Toleranz. Wie groß sind bei einem Gesamtkegelvolumen von 1012 Kubikzoll, das wir Reibungswiderstandsbereich nennen können, und einer Geschwindigkeit von 5000 Meilen pro Stunde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre das Verhältnis von Reibwiderstand, in Wärmeeinheiten angegeben, und der zurückgelegten Entfernung sowie das Verhältnis des Temperaturunterschieds zwischen Spitze und Basis?«
Ich füllte die eine Hälfte der Tafel und ging dann zur zweiten Hälfte über. Ich redete schnell und schrieb genauso schnell, wie ich redete.
Wäre meine Stimme nicht gewesen, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Und ich bezweifle sogar, dass sich irgendjemand gerührt hätte, wenn man eine Bombe ins Zimmer geworfen hätte.
Heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das Problem so wiedergebe, wie ich es damals getan habe. Wahrscheinlich nicht. Allerdings versteht sich von selbst, dass ich es nicht erfunden habe.
Jahre zuvor war ich in Chicago oder Cleveland oder Los Angeles oder sonstwo beim Stöbern in der öffentlichen Bibliothek auf eine Doktorarbeit in Mathematik gestoßen. Das Problem war eins von mehreren in dieser Doktorarbeit, und aus irgendeinem Grund ist es bei mir hängen geblieben. Ich habe zwar kein fotografisches Gedächtnis, aber gewisse Dinge graben sich tief bei mir ein. Anders kann ich das nicht erklären. Je mehr ich mich bemühe, sie zu vergessen, umso deutlicher erinnere ich mich an sie.
So eine Art negativer Fertigkeit. Man tut es, indem man versucht, es nicht zu tun. Probieren Sie doch zum Beispiel, sagen wir mal, nicht an das Empire State Building zu denken oder nicht an die Brooklyn Bridge. Probieren Sie es. Okay? Sehen Sie, was passiert?
Ich bin gut in Mathematik, aber nicht gut genug, um diese besondere Fragestellung vollständig zu verstehen. Ich hatte sie nur aus meinem Gedächtnis hervorgekramt und sie an die Tafel geschrieben. Um damit anzugeben. Um es ihnen zu zeigen.
Als ich fertig war, hatte ich die gesamte Tafel gefüllt, und die Stunde war fast vorüber. Ich legte die Kreide weg und staubte mir die Hände ab. Ich wollte Zeit schinden, denn nun kam ich mir wie ein Volltrottel vor und wollte mich unter gar keinen Umständen umdrehen.
»Das war sehr gut, Allen …«, sagte Mrs. Carter mit trockener Stimme. »Ich bin mir sicher, dass wir alle noch sehr viel von dir lernen können, oder nicht, Klasse?«
Füße scharrten. Ein kleines, sehr schwaches Händeklatschen.
Gott sei Dank klingelte in diesem Augenblick die Pausenglocke, und ich konnte flüchten.
4.
Die nächste und letzte Stunde des Vormittags war englische Literatur. Neben Franklin, dem »komischen Nigger« aus der Matheklasse, waren noch zwei weitere Schwarze da, Bruder und Schwester.
Beide waren schick angezogen. Ihre Haut war fast so dunkel wie meine, aber sie waren keine Wollköpfe wie ich. Sie hatten Haare auf dem Kopf, richtige Haare, keine Perücken, und zwar so viele davon, wie sie nur tragen konnten. Die Haare des Mädchens reichten bis über ihre Schultern, seine bis an den Kragen.
Ich verstehe nicht, warum Schwarze so einen gottverdammten Riesenwirbel um ihre Haare machen. Die meisten jedenfalls. Und wenn sie sie nicht auf dem Kopf haben, dann eben im Gesicht. Ein beschissener kleiner Schnurrbart, so dürr, dass er aussieht wie eine zerschmelzende Raupe, oder ein Ziegenbart aus vielleicht dreieinhalb Haaren. In letzter Zeit ist mir dann noch die Sache mit den Sonnenbrillen aufgefallen – man trägt Sonnenbrille. Brille und Haare, das gehört anscheinend zusammen.
Gib irgendeinem Hungerleider aus Harlem eine billige Sonnenbrille aus dem Ramschladen und ein paar Haare, und schon hält er sich für den Größten. Mehr braucht er nicht – eine Sonnenbrille und Haare –, und schon ist er Mr. Großkotz.
Kein Wunder, dass die Menschen über die Schwarzen lachen und auf sie herabsehen.
Diese blöden Angebertrottel machen uns allen nur das Leben schwer. Diese Geschwister, von denen ich gerade sprach, hatten keine Sonnenbrillen auf, weil sie was Besseres waren, und das ließen sie einen auch sofort spüren. Kaum war ich aus dem Englischraum heraus, hängte sich der Bursche, Steve Hadley, auch schon an mich. Er stellte sich und seine Schwester vor und meinte, wir sollten doch zusammen zu Mittag essen. Als wir dann in der Cafeteria saßen, hatte ich bereits erfahren, dass ihr Vater Arzt war und die beiden, neben vielen anderen Dingen, schon von meinem Matheauftritt gehört hatten.
Ich schätze, ich muss ein wenig verwirrt geschaut haben – vielleicht auch etwas verärgert. Der Kerl lachte und meinte, ich würde es ihnen hoffentlich nicht übel nehmen, aber seine Schwester Lizbeth und er seien nun mal neugierig auf ihn gewesen.
»Ich sag dir, wie es ist, Al«, erklärte er ganz offen, »Liz und ich waren hier irgendwie einsam. Wir ham …«
»Wir haben, nicht ham«, unterbrach ihn Lizbeth streng. »Du weißt doch, was Vater über solche Dinge sagt.«
»Wir haben«, verbesserte sich Steve, »nach jemandem gesucht, der zu uns passt, verstehst du? Liz ist zufällig Josie Blair begegnet, gleich nachdem du mit deiner Mutter heute Morgen beim Direktor warst, und Josie und Liz, na ja, die sind nicht wirklich Freundinnen. Aber Josie ist ganz süß, eckt nicht gern an, und wenn Liz etwas herausfinden will, dann findet sie es auch heraus. Wir hatten uns also schon halbwegs entschieden, dass du zu unserer Gesellschaftsschicht gehörst, und, ähm …«
Ihr verlogenen kleinen Einschleimer, dachte ich. Junge, werd ich es euch zeigen!
Ich nickte ernst. Dann sagte ich, mit jemandem Freundschaft zu schließen, sei ein ziemlich weitreichender Schritt, also sollten wir lieber noch eine Weile darüber sprechen, bevor sie sich endgültig entschlössen. »Schließlich gibt es hier doch eine ganze Reihe anderer Nigger. Ihr beide findet sicherlich jemanden, der noch besser zu euch passt.«
»Nein.« Steve schüttelte den Kopf. »Wir haben nichts mit Niggern zu schaffen. Und außerdem ist das genau das treffende Wort für die, Al, selbst wenn wir es nicht gern in den Mund nehmen. Es gibt Schwarze wie uns, und dann gibt es Nigger. So wie es Juden und Itzigs gibt und, ähm …«
»Katholiken und Fischfresser?«
»Richtig, richtig! Und …«
»Deutsche und Krauts? Italiener und Spaghettis? Mexikaner und Fettlocken? Puerto Ricaner und …«
»Steve«, ging Lizbeth dazwischen, »holst du mir bitte noch eine Milch?«
»Aber natürlich«, meinte Steve. Er ging hinüber und stellte sich an der Essenstheke in die Schlange. Ich dachte, Lizbeth würde seine Abwesenheit dazu verwenden, mich abzukanzeln, aber das tat sie natürlich nicht. Einschleimer kanzeln nicht die Leute ab, bei denen sie sich einschleimen. Stattdessen fragte sie mich, wie mir denn die Militärschule gefallen habe.
»Oh, ich habe sie geliebt!«, antwortete ich. »Wie auch anders? Die beste Einrichtung dieser Art im ganzen Land – so sagt man –, und ich war der einzige Schwarze dort.«
Lizbeth nickte verträumt und stützte ihr Kinn in ihre Hand. »Großartig! Was für eine großartige Gelegenheit! Dad würde seine Augenzähne dafür geben, Steve an eine solche Schule zu bringen.«
»Was ist denn mit Steve?«
»Was soll mit ihm sein? Er denkt natürlich ebenso. In dieser Welt muss man so einiges schlucken, was einem nicht gefällt. Dad hatte viel zu schlucken, bevor er Arzt werden konnte.«
»Das glaube ich«, sagte ich. »Aber nun ist er Arzt, und er muss nicht mehr so viel einstecken, oder? Doktor Hadley hat’s geschafft.«
»Du weißt, dass es nicht so ist.« Lizbeth schüttelte den Kopf. »Aber stell dir mal vor, wie viel schlimmer es wäre, wenn er kein Arzt wäre. So muss man denken, Allen«, erklärte sie ernst. »Und so zu denken, das hat Dad Steve und mir beigebracht. Wenn es Wege gibt, die dir verbaut sind, nun, dann konzentrier dich eben auf die, die dir offen stehen. Und wenn du nicht die richtigen Freunde findest, Menschen, die dich weiterbringen, dann such dir besser gar keine.«
»Ich verstehe, was dein Vater meint«, sagte ich und kniff die Augen zusammen, um wach und wissend zu wirken. »Lass keinen Trick aus, weder gesellschaftlich noch beruflich, dann kannst du gar nicht anders, als ans Ziel zu kommen. Zumindest teilweise. Irgendwann.«
»Genau«, sagte Steve, der gerade mit der Milch zurückkam. »Ganz genau, Allen. Schwesterherz, hast du Al von all den großen Versammlungen erzählt, zu denen Dad geht? Einmal hat er sogar vor der AMA einen Vortrag gehalten!«
»Sieh mal an«, sagte ich.
Die Glocke läutete zum Ende der Pause.
Wir verließen die Cafeteria, und Steve erzählte mir, dass die meisten der anderen farbigen Schüler nicht aus der Gegend waren, sondern mit dem Bus zur Schule kamen. »Viele davon sind aus Harlem, kannst du dir das vorstellen?«
»Entsetzlich!«, sagte ich.
»Josie wohnt hier in der Gegend«, sagte Lizbeth. »Ihr Vater ist Hausverwalter auf Teilzeitbasis oder so etwas, und zu dem Job gehört eine Wohnung im Souterrain. Keine besonders schöne, nehme ich an, aber das weiß ich nicht genau. Ich mag Josie ganz gern. Eigentlich sogar sehr gern, wirklich. Aber ich stehe ihr sicher nicht nahe.«
Du Miststück, dachte ich. Du schleimiges kleines Miststück!
»Mal sehen«, meinte Steve. »Du wohnst in Fußnähe, stimmt’s, Al? Sicher tust du das. ’ne verdammt gute Adresse.«
»Du kennst sogar die Adresse«, sagte ich.
»Und wie ich die kenne. Dad hat versucht, dort eine Wohnung zu bekommen. Wir dachten, er würde es schaffen, weil sie eigentlich für Ärzte eine Ausnahme machen. Aber …« Er runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Ich nehme an, es hat was mit Mutter zu tun.«
»Womit denn sonst?«, meinte Lizbeth. Die Menschen bräuchten nur einen Blick auf sie zu werfen, und schon sei alles vorbei.
»Du weißt gar nicht, was für ein Glück du hast, eine solche Mutter zu haben, Allen. Jemand mit Stil und gutem Aussehen und Benehmen. Sie wird sicherlich überall wohnen können, wo sie möchte.«
»Zumindest solange sie weiß bleibt«, pflichtete ich ihr bei, »und mich im Hintergrund hält.«
»Na ja«, meinte Lizbeth und tat das Thema schulterzuckend ab. »Natürlich wohnen wir auch nicht schlecht. In Woodside. Nicht so gut wie du, aber akzeptabel.«
Steve fragte mich, ob ich ein Auto hätte. Nein, antwortete ich, das hätte ich nicht, und sofort boten sie mir an, mich in ihrem Wagen nach Hause zu fahren. Vielleicht könnten wir ja erst noch bei ihnen vorbeischauen und eine Coke trinken oder so? Ihr Vater und ihre Mutter, eine Krankenschwester, seien im Krankenhaus, also gäbe es nicht das übliche Problem mit störenden Eltern.
Ich willigte ein, und wir verabredeten uns für nach der Schule. Dann gingen die beiden die Treppe hoch zu ihrer nächsten Stunde, und ich lief durch den Gang im Erdgeschoss zu meiner.
Plötzlich fühlte ich mich blendend. Mir war nämlich aufgegangen, dass ich im Vergleich zu solchen lachhaften Losern wie den Hadleys ziemlich weit oben stand. Im Vergleich zu diesen Schleimern, diesen schnöseligen Pennern war ich ein König. Doch so schäbig sie auch waren – Himmel, was für ein schäbiges Pärchen! –, ich verachtete sie nicht länger, wollte es ihnen auch nicht mehr heimzahlen. Allein der Gedanke an das, was ich da hatte aushecken wollen, erschütterte mich nun ein wenig. Die Pläne, die ich mir für sie geschmiedet hatte.
Ich meine, warum, um alles in der Welt, wollte ich jemanden verletzen, der so erbärmlich stank, dass ich daneben nach Rosen duftete? Was konnte ich angesichts der beiden anderes fühlen als eine matte Traurigkeit?
Abgesehen davon bin ich gerecht, ich bin der gerechteste Mistkerl, den Sie jemals kennenlernen werden – nach meinen eigenen Maßstäben. Ich behandle niemanden ungerecht, es sei denn, er verdient es – meiner Meinung nach. Steve und Lizbeth Hadley hatten ihre Strafe schon bekommen. Von ihnen selbst und von ihrem Arschloch von Vater, dem Doktor.
Wie gesagt, ich war bester Laune. Ich war tolerant, sprudelte schier über vor guter Laune und gutem Willen. Dann kam ich an Mr. Velies Büro vorbei, nickte und lächelte ihn an, weil er in der Tür stand. Er sah den Gang entlang, als hielte er nach jemandem Ausschau. Was er tatsächlich tat, wie sich herausstellte.
Nach mir.
Seine Hand schloss sich auf vertraute Weise um meinen Arm. Eine Weise, die ich schon tausendmal gespürt hatte und die mich mit Furcht und Hass zugleich erfüllte. Er sprach mich mit einem alten, vertrauten Ton in der Stimme an, und Hass und Furcht glühten und flackerten in mir auf.
Er zog mich durch den Durchgang in der Theke und an Josie Blairs leerem Schreibtisch vorbei – warum war ich so froh, dass sie nicht da war und mich sah? – in sein Büro.
Er schloss die Tür und befahl mir, mich zu setzen. Warum, fragte ich, was sei denn das Problem, oder etwas in der Art. Er gab mir keine Antwort darauf, sondern wies nur streng auf einen Stuhl. Wieder fragte ich ihn, worum es denn ginge, brachte den Satz aber nicht zu Ende.
Mr. Velie packte mich bei den Schultern und drückte mich hinunter auf den Stuhl.
So fest, dass mir die Wirbelsäule schmerzte.
5.
Mr. Velie setzte sich so dicht vor mir auf die Tischkante, dass seine Knie gegen meine stießen. Leise hörte ich es schrillen, die Glocke drei Minuten vor Beginn der nächsten Stunde, und ich glaubte zu hören, wie draußen jemand ins Vorzimmer trat. Velie ließ seinen Fuß ein wenig schwingen, und seine Schuhspitze traf mich am Schienbein. Ich riss mein Bein nach hinten, ließ es dann aber, wo es war. Ich unterdrückte den Reflex, es erneut zurückzuziehen. Wieder trat er mir gegens Schienbein, dann wieder. Und wieder und wieder. Vielleicht ein Dutzend Mal. Ich rührte mich nicht.
Ich hätte mich auch nicht gerührt, wenn er mir in die Eier getreten hätte.
Schließlich gab er es auf und rutschte ein wenig auf dem Schreibtisch zurück.
»Weißt du, was deine Mutter zu mir gesagt hat, Allen? Nachdem du heute Morgen gegangen bist? Sie hat gesagt …«
»Ja«, antwortete ich.
»Sie hat gesagt – was?«
»Sie hat Ihnen gesagt, dass Sie mich sehr, sehr streng behandeln müssen, damit ich mich anständig benehme. Dass ich Freundlichkeit oder Rücksichtnahme als Schwäche auslegen würde. Sie hat Ihnen außerdem die vom Gesetz vorgeschriebene schriftliche Erlaubnis erteilt, mich zu züchtigen, falls Sie das für nötig halten.«
»Nun, ähm …« Das nahm ihm ein wenig die Luft aus den Segeln. Was wohl daran lag, dass ich die Worte meiner Mutter haargenau wiedergegeben hatte. »Du erinnerst dich, dass ich eigentlich dagegen war, dich hier unter welchen Umständen auch immer aufzunehmen, Allen. Ich hatte den Eindruck, dass du auf eine Privatschule gehörst, und ich …«
»Ich weiß«, unterbrach ich ihn. »Deshalb hat sich Mutter ihren Satz von wegen hart bleiben und körperliche Züchtigung und so ja für den Schluss aufgespart, nachdem sie wusste, dass sie Sie am Haken hatte. Das macht sie immer so. Erst lockt sie den Fisch mit ihrem leckeren Köder und verspricht unausgesprochen mehr, und dann rückt sie mit den letzten Informationen über mich heraus.«
Ich solle nicht so über meine Mutter reden, fauchte er. Meine Mutter sei eine anständige, ehrliche Frau, die nur mein Bestes wolle!
»Und ich habe was ganz Fürchterliches getan«, fuhr ich fort und nickte. »Ich habe ihr einen Abschiedskuss gegeben. Vor Ihren Augen. Ein Nigger küsst eine weiße Frau vor den Augen eines weißen Mannes. Ich wette, da hätten Sie mir am liebsten die Fresse eingeschlagen, habe ich recht?«
»Darum geht es hier nicht!« Mr. Velie wurde rot. »Wechsle nicht das Thema, junger Mann! Wenn du dich nur nicht so bemitleiden würdest, du – ich … ich habe absolut keine rassischen Vorurteile. Ich habe viele Freunde, Kollegen, die Schwarze sind, und ich …«