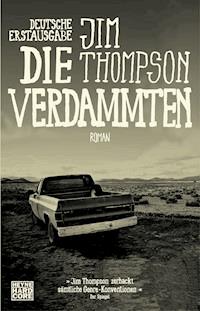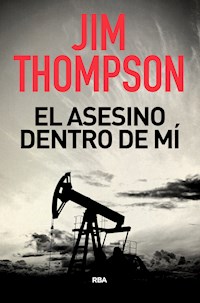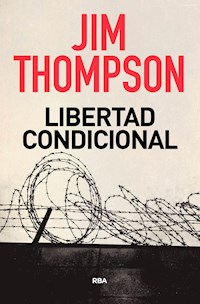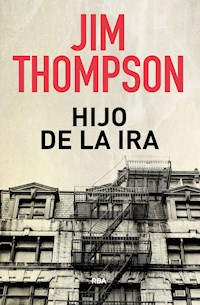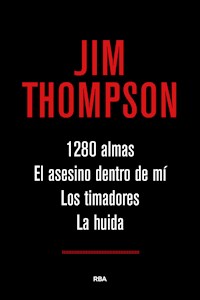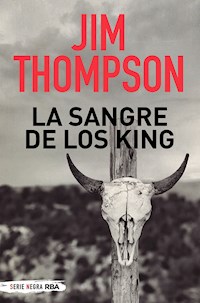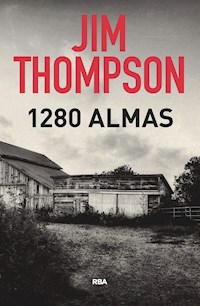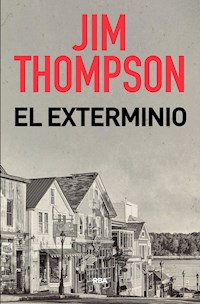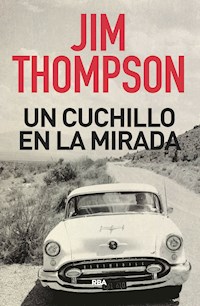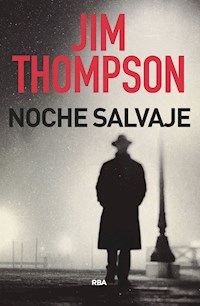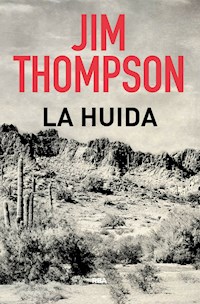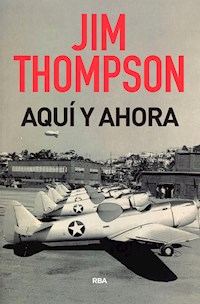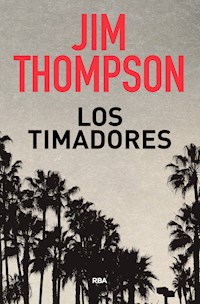4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Willkommen in Verdon, Nebraska ... Lincoln Fargo ist der Patriarch des Fargo-Clans, einer dekadenten Familie, die auf ihrem Landsitz in einer selbstgeschaffenen Welt des Abgründigen lebt. Fargo blickt auf ein Leben in Sünde zurück, seine gottesfürchtige Frau Pearl steigert sich in den Wahn, den Familienbesitz an Gott zu verkaufen, während ihr Sohn Grant immer weiter zerfällt. Doch dies ist nur die Oberfläche der Verkommenheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
Willkommen in Verdon, Nebraska … Lincoln Fargo ist der Patriarch des Fargo-Clans, einer vollkommen dekadenten Familie, die auf ihrem Landsitz in einer selbst geschaffenen Welt des Abgründigen lebt. Lincoln Fargo blickt auf ein Leben in Sünde zurück, seine gottesfürchtige Frau Pearl steigert sich in den Wahn, den Familienbesitz an Gott zu verkaufen, während ihr Sohn Grant in der Liebe zu seiner zerbrechlichen Cousine seinem großen Vorbild Edgar Allan Poe nacheifert. Doch dies ist nur die Oberfläche der Verkommenheit. Der Fargo-Clan verbirgt ein finsteres Geheimnis – ein Geheimnis, das die Familie schließlich in die unvermeidbare höllische Katastrophe reißen wird …
Zum Autor
Jim Thompson wurde 1906 in Anadarko, Oklahoma, als James Myers Thompson geboren. Er begann früh zu trinken und schlug sich als Glücksspieler, Sprengstoffexperte, Ölarbeiter und Alkoholschmuggler durch. Obwohl er bereits mit fünfzehn Jahren seine erste Kriminalgeschichte verkaufte, konnte er erst seit Beginn der fünfziger Jahre vom Schreiben leben. Für Hollywood verfasste er zahlreiche Drehbücher, u. a. für so namhafte Regisseure wie Stanley Kubrick. Thompson gilt als zentraler Vertreter des Noir-Genres. Er starb 1977 in Los Angeles, seine Asche wurde im Pazifischen Ozean verstreut.
Lieferbare Titel
Jetzt und auf Erden – In die finstere Nacht – Blind vor Wut – Die Verdammten – Südlich vom Himmel
Jim Thompson
Fürchte den Donner
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Franz Dobler
Mit einem Vorwort von James Ellroy und einem Nachwort von Thomas Wörtche
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die amerikanische Ausgabe Heed the Thunder erschien 1994 bei First Vintage Crime/Black Lizard Edition, New York
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie unser halbjährlich erscheinendes CORE-Magazin mit Themen rund um das Hardcore-Universum. Weitere News unter facebook.com/heyne.hardcore
Vollständige deutsche Erstausgabe 01/2016
Copyright © 1943 by Jim Thompson
Copyright renewed 1973 by Jim Thompson
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Thomas Brill
Vorwort © 1991 by James Ellroy
Nachwort © 2015 by Thomas Wörtche
Umschlaggestaltung: Melville Brand Design, München, unter Verwendung eines Motivs von © Getty Images/Jan Stromme
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-15955-9
www.heyne-hardcore.de
Vorwort
Von James Ellroy
Sozialer Realismus/Seifenoper an der Grenze zu Horror – Jim Thompsons zweiter Roman, Heed the Thunder, ist herausragend als Vermächtnis für Punkt eins und als heißer Vorbote für Punkt zwei. Mehr als irgendein anderer zeigt er seine Wurzeln – sowohl geografisch als auch literarisch – und macht den Prozess deutlich, wie Thompson sich damals mit seiner unstillbaren Begierde, zu weit zu gehen, infiziert hat.
Verdon, Nebraska, um 1910 – Thompson nennt das Jahr nie genau –, aber die ersten Automobile tauchen auf, ein Luxus, den die meisten der Verlierer-Truppe aus Fürchte den Donner nie kennenlernen. Lincoln Fargo – alt, Soldat der Union im Bürgerkrieg, sitzt als Patriarch im Zentrum der Story – sein Clan ist ein schreiender, quengelnder, zupackender Haufen – entfernte Verwandte heiraten untereinander und breiten sich über Verdon aus, und der Leser vergisst somit nie, dass es zu einem Inzest kommen könnte, wann immer ein Mann mit einer Frau flirtet. Inzest kommt vor – unter Cousins ersten Grades –, aber das Buch wurde 1946 veröffentlicht und erreichte leider nie den Bekanntheitsgrad von White-Trash-Epen wie Gottes kleiner Acker. Inzest kommt vor, Mord kommt vor; Menschen kommen, gehen, bleiben immer dieselben oder ändern sich für immer – bestehen bleibt nur das gesegnete Land – fruchtbar, unveränderlich – es ernährt die Stolzen, die Frevler, die Schwachen, die Starken, die Betrüger, die Besoffenen, die Schlauen, die Tölpel, hauptsächlich die komplett Neurotischen.
Stellen Sie sich das Bild so vor: Thompson flirtet mit dem Horror; es war ihm nicht erlaubt, oder er wusste nicht, wie er um den Horror einen Roman konstruieren könnte – vielleicht wollte ihm sein Verleger diese Freiheit nicht lassen. Er war jung, vielleicht von Dreiser und Sinclair Lewis beeinflusst – er wollte auf Lewis’ Die-Scheinheiligkeit-im-Cornbelt-Nummer noch eins draufsetzen, allerdings mit etwas, das Lewis nie versucht hat – tiefer Sympathie für seine Charaktere. Fürchte den Donner kam 1946 in die Buchläden; ein Buch, das weitgehend ein Produkt der Depressionszeit ist: Politiker sind korrupt, die Eisenbahn überrollt den kleinen Mann, und der Clown, der dir kürzlich eine Dreschmaschine verkaufte, hat dir fehlerhaftes Material angedreht, an dem du noch lange abzahlen wirst, nachdem es hinüber ist. Das Bild: sozialer Realismus à la Steinbeck; Thompsons ehrgeiziger Plan, ein Epos zu schaffen, das seine eigene Zeit und seinen Ort widerspiegelt – ohne jedoch vollständig damit verhaftet zu sein –, was die Tatsache bezeugt, dass er die Story nicht in der Depressionszeit angesiedelt hat – er vermeidet geschickt einen historischen Kontext, der die Leser von den menschlichen Konflikten ablenken könnte.
Und obwohl sich die Einführung der Personen und der Aufbau der Szenerie furchtbar dahinzieht, wenn sich die verlorenen/verdammten, ehrbar und unehrenhaft überlebenden Fargos auf ihren Weg in die Verdammnis/Erlösung machen – tanzen sie Boogie, weil …
Thompson damit eine Gothic-Kulisse aufgebaut hat, die dann bereit dafür ist, um den HORROR abzufeuern. Ein Wanderprediger bringt Farmer dazu, ihm ihren Besitz zu überschreiben; Pearl Fargo stellt den Scheck auf Gott aus und löst damit eine Kette von Ereignissen aus – Schicksale verwickeln sich, angestoßen von religiösen Machenschaften – enden in HORROR. (Der Prediger wird geteert, gefedert und aus der Stadt gejagt – diese ehrbaren Bauern – der junge Schreiber Thompson bringt seinen Arsch in Sicherheit – während ich mir gewünscht hätte, dass dieser Typ dort länger herumhängt und Leute fertigmacht.)
Einer Fargo-Tochter, die Lehrerin ist, wird von einem dummen polnischen Jungen etwas Übles nachgerufen; ein Fargo-Schwiegersohn nimmt Rache – die Konsequenzen sind HORROR und überlagern das gesamte Ende des Buchs.
Einem Mann wird mitgeteilt, er habe Syphilis – eine Szene, die gespielt wird, um pikareskes Gelächter hervorzurufen – der HORROR lauert im Unausgesprochenen – er stirbt nicht oder wird vollkommen verrückt – seine von Würmern zerfressene Seele wird nur immer kleiner und kleinlicher.
Ted und Gus Fargo – raue, gutherzige Jungs – springen auf den Zug und landen in Texas. Eine nicht besonders heftige Auseinandersetzung bringt sie für lange Zeit ins Gefängnis.
HORROR.
Horror – sind die überzeugendsten Stellen in diesem Buch.
Horror – erzeugen die am geschicktesten manipulierten Charaktere von Fürchte den Donner.
Horror – Thompson untersucht sein Gebiet, sucht nach seiner Stimme, vielleicht noch nicht ganz davon überzeugt, dass sie ihn dorthin bringen kann, wo er hinwill, hinmuss …
Horror.
Abgesehen vom Horror – Fürchte den Donner ist nach fünfzig Jahren immer noch einfach herausragend. Es ist das erste Buch von Thompson, das ich gelesen habe – jetzt will ich mehr lesen, den Mann dabei beobachten, wie er sich als Schriftsteller entwickelt. Fürchte den Donner – dieser Hybrid – Ma und Pa Kettle treffen Steinbeck und Dostojewski auf irgendeiner Reise durch Amerika, die seine Biografen übersehen haben. Fürchte den Donner hat bis heute Bestand. Lassen Sie den Titel – nirgendwo sonst war er so gerechtfertigt – für sich selbst als Einführung sprechen. Der Donner sollte kommen, bald.
Für Lois und Elliott McDowell
»Ah, nimm das Geld und vergiss den Kredit …«
1.
Es war fünf Uhr, als der Zug in Verdon hielt, und die Stadt und das Tal lagen immer noch in der gräulichen Finsternis kurz vor der Dämmerung. Entlang der Hügelkuppe der Sandhills schlängelten sich die Spitzen der ersten Sonnenstrahlen vorsichtig über die Heuwiesen herein, tauchten zitternd in den eisigen Calamus, schossen durch Viehzäune zurück, sausten an Dreckmatsch und Gräben vorbei; das fruchtbare Tal aber schlief ungestört weiter, dunkel, genüsslich. Es klammerte sich an die Nacht, als wollte es bis zum letzten Moment gütige und riesige Kraft für die gewaltigen Mühen des Tages schöpfen; und die trüben Lichter des Zugs hatten der Nacht nichts entgegenzusetzen, sie waren zufrieden mit dem Bereich, für den sie zuständig waren. Der lange Bahnsteig war eine große Fläche aus braunen Brettern, die von Alter, Dürre und Regen mitgenommen waren.
Als Mrs. Dillon aus dem Zug stieg, zog sie ihren Ellenbogen vorsichtig von der angebotenen Hand des Zugführers weg. Das war nicht ausschließlich ihrer Prüderie geschuldet (obwohl sie aufgrund ihrer Erziehung geneigt war zu glauben, dass eine Frau, die ohne Begleitung reiste, gar nicht vorsichtig genug sein konnte), sondern hatte vor allem damit zu tun, dass sie den Zugführer nicht ausstehen konnte und er ihr Angst einjagte. Sie sprach sich selbst Mut zu, dass sie sich gegen jeden Mann behaupten könnte – und gegen zwei von seiner Sorte –, trotzdem spürte sie Furcht und Abneigung. Es waren die Angst und die Abscheu einer stolzen Person, die von ihm mehr verlangt hatte, als er bieten konnte. Sie hätte, um einen ihrer Lieblingsausdrücke zu benutzen, dem Zugtypen am liebsten die Haare vom Kopf gerissen.
Weil sie sich ihm also entziehen wollte, und zum Teil auch, weil es dunkel war, setzte sie ihren Fuß nicht genau auf den Schemel, der beim Aussteigen behilflich sein sollte. Sie fiel nach vorn auf den Bahnsteig und drehte dabei instinktiv ihren Körper herum, um ihren Sohn, den sie im Arm hielt, nicht zu zerquetschen. Er landete auf ihrem Bauch, rollte über ihr Gesicht und ihren mit Straußenfedern geschmückten Hut und wachte, auf den Knien, heulend auf. Mit einer heftigen Handbewegung zerrte sie ihre Röcke und Unterröcke ordentlich nach unten und war wieder auf den Beinen, ehe der Zugführer bei ihr war.
Sie bückte sich, presste den Jungen einmal kurz an ihren Busen und schüttelte ihn dann heftig. »Dir geht’s gut, oder? Dann hör schon mit dem Gebrüll auf.« Während sie ihren Hut zurechtrückte, stieß sie ihn mit der anderen Hand an. »Tut dir irgendwas weh? Halt jetzt die Klappe! Zeig mir, wo du dir wehgetan hast.«
Der Zugführer räusperte sich. »Also, Lady. Wie wäre es, wenn wir beide unsere Angelegenheit klären, damit der Zug weiterfahren kann?«
»Was?« Mrs. Dillon drehte sich wütend zu ihm um. »Hören Sie auf, mich zu belästigen! Ich bin schon halb krank, weil Sie mir die ganze Fahrt auf die Nerven gehen. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen!«
»Sie sagen, dass Ihr Ehemann eine Anwaltskanzlei in Oklahoma City hat?«
»Genau das habe ich gesagt!«, sagte Mrs. Dillon. »Robert A. Dillon, Rechtsanwalt.« Sie betonte jede Silbe der Berufsbezeichnung, voller Sehnsucht, obwohl sie Angst hatte.
»Aber dort ist er zurzeit nicht?«
»Nein, ist er nicht! Auch das habe ich Ihnen gesagt! Und ich erkläre Ihnen noch einmal, ich weiß nicht, wo er ist, und … und es interessiert mich nicht!«
»Gut, lassen wir das«, sagte der Zugführer, der im Licht seiner Laterne etwas in ein Notizbuch schrieb. »Wen besuchen Sie hier?«
»Das geht Sie nichts an!«
»Die Eltern, hm?« Der Zugführer schrieb weiter. »Und Sie bleiben dabei, dass dieses große Kerlchen erst fünf Jahre alt ist, dass er noch nicht mal ganz fünf ist?«
»Habe ich Ihnen schon hundertmal gesagt. Ich werd’s nicht nochmal tun.«
»Also gut« – er klappte sein Notizbuch mit einem Knall zusammen –, »Sie werden sehen, dass man die Eisenbahngesellschaft nicht betrügen kann, Lady. Es ist am besten, wenn man’s gar nicht erst versucht. Sie hören von uns.«
Mrs. Dillon starrte ihn an, bebend vor Wut. »Oh, werde ich das?«, fragte sie plötzlich herausfordernd.
»Das werden Sie. Sie können nicht …«
»Sagen Sie mir nicht, was ich tun kann und was nicht! Mein Sohn Robert und ich sind gerade beim Aussteigen aus Ihrem Zug gestürzt. Die Stufe war glatt, jawohl, und ich wette, dass ein Arzt so einige Verletzungen bei uns feststellen würde, und ich hätte gute Lust, um …«
»Jetzt mal langsam«, protestierte der Zugführer. »Diese Stufe ist nicht glatt. Außerdem hat niemand gesehen, wie Sie …«
»Ich werde ’ne Menge Leute auftreiben, die bezeugen können, dass sie’s gesehen haben!« Mrs. Dillon war jetzt fast am Brüllen. »Meine Familie hat diese Stadt praktisch aufgebaut. Ich und meine … meine Familie und ihre Freunde haben die Stadt da hinten gegründet, wo der Bahnhof sein sollte, anstatt eine halbe Meile weiter hier draußen. Jawohl, sie haben Tausende von Dollars für Grundstücke hingeblättert und sich in diesem Getreidefeld niedergelassen. Und sie bezahlen so viel Frachtgeld an Ihre räuberische Eisenbahn, dass es sich in der Hälfte aller Fälle für sie überhaupt nicht lohnt, ihr Zeug irgendwohin zu verfrachten. Und …«
»Ist ja gut, Lady, schon gut.« Der Zugführer schwenkte müde seine Laterne. »Dann sagen wir unentschieden.«
Er wusste sogar besser als sie, was passierte, wenn in diesem Streckenabschnitt einer, der auf dem Land hier lebte, gegen die Eisenbahn vor Gericht zog. Für sie zählte nur der Clan, und sie waren untereinander verheiratet; und selbst wenn sie sich gerade gegenseitig bekämpften, würden sie damit aufhören, um gemeinsam gegen die Eisenbahn vorzugehen. Es war immer ein wertvolles Holstein-Rind, das überfahren worden war, und es war immer ein Feld mit hochwertigen Saatgut-Pflanzen, das wegen der Funken aus dem Schornstein eines Zugs abgebrannt war. Nicht dass die Eisenbahn machtlos war; sie hatte sich mit wachsender Größe nur zu weit von ihren Wurzeln entfernt. Sie hatte sich auf Kosten von anderen mit Baugrund und Subventionen und Subunternehmerverträgen gesundgestoßen, hatte dann den einen Bereich hängen lassen, einen anderen gestärkt, und dann diesem damit gedroht, es könnte ihm genauso übel ergehen wie dem ersteren. Und selbst jetzt hatte die Eisenbahn reichlich zu fressen, stopfte weitaus mehr in sich rein, als es ihre Ausgaben erforderten – ihre legitimen Ausgaben. Aber ihre Freunde, oder eher Diener, saßen in den großen Städten und Hauptstädten. Dort grünten die Zweige. Während die ungeschützten und angenagten Wurzeln starben, aus reiner Bosheit oder weil sie nur widerwillig gegossen wurden.
Mrs. Dillon sah zu, wie der Zug ruckte, vor Anstrengung ächzte und langsam abfuhr. Sie war sich der Tatsache nicht im Geringsten bewusst, dass sie Geschichte geschrieben hatte und das Symbol für eine Ära war, die man, vielleicht unabsichtlich, fast immer falsch interpretieren würde. Dreißig Jahre später, sogar schon fünfzehn Jahre später, in der Depressionszeit der frühen Zwanzigerjahre, als Leitartikelschreiber und Politiker dem unbeugsamen Individualismus der alten Zeiten nachweinten – womit sie genau genommen predigten, der Regierung zu misstrauen, und zur Anarchie aufriefen –, würde Mrs. Dillon immer noch nicht erkennen, welche Rolle sie dabei gespielt hatte, und wenn doch, dann hätte es sie nicht groß gekümmert.
Die Dinge, die ihr bestechend klar und scharf in Erinnerung bleiben sollten, waren die Dämmerung, die sich über den Fluss ausbreitete, wie Farbe, die auf eine Leinwand aufgetragen wird; die grünen Getreidefelder, die mit ihren Trieben knackten und knisterten; das gedämpfte, traurige Muhen von erwachenden Rindern; ihre Jugend und ihre Zuversicht im Angesicht des Desasters; ihr Junge, ihr Junge, ihr Junge …
Sie tätschelte ihn jetzt wieder liebevoll, spuckte in ihre Hand, schmierte die Spucke in die widerspenstige Haartolle an seinem Hinterkopf und drohte ihm, sie würde ihm die Haut bei lebendigem Leib abziehen.
»Was hast du denn herumzubrüllen?«, herrschte sie ihn an. »Ich schwör dir, ich versohl dir den Arsch, wenn du nicht die Klappe hältst. Was ist denn mit Mamas kleinem Liebling los?«
»W-wo ist Papa?«
»Woher soll ich … vielleicht musste er sich mit einem Mann treffen. Er wird bald wieder bei uns sein, und wenn du kein braver Junge bist, werde ich ihm das erzählen.«
»Wird er dann im Haus von Grandpa Fargo sein?«
»Oh, das vermute ich mal. Werden wir sehen.«
Der Junge fing wieder zu heulen an. »D-du hast g-gesagt, dass Pa-papi bei Grandpa sein wird! D-du hast g-gesagt …«
»Ja, verflixt und zugenäht, ich sagte, wir werden sehen!«, schrie Mrs. Dillon. »Und jetzt halt die Klappe, oder er wird dich hören und weglaufen!«
»M-mach ich.« Der Junge zitterte und rieb sich die Augen.
»Musst du auf die Toilette?«
»M-hm.«
»Hab ich’s mir doch gedacht!«, sagte Mrs. Dillon. »Immer wenn du mit deinem Affentanz anfängst, sollte mir klar sein, was nicht stimmt.«
Sie wandte sich von ihrem Bastkoffer und dem Ausblick auf die Leinwand ab, packte den Jungen an der Hand und führte ihn den knapp zwanzig Meter – teure und unnötige Meter – langen Bahnsteig hinunter. Inzwischen stieg die Nacht auf wie Nebel, und darunter ballte sich ein ständig höher werdender Wall von Tageslicht.
Am Ende des Bahnsteigs deutete Mrs. Dillon nach unten, auf einen schmalen, von Unkraut überwucherten Pfad, der durch einen Graben zu einem trüben, roten Häuschen auf der anderen Seite führte. Die Tür stand offen, und der stechende, nicht unangenehme Geruch von Limonen drang sogar durch die frische Morgenluft.
»Da ist es«, sagte Mrs. Dillon. »Du gehst jetzt da rüber.«
Der Junge kicherte ungläubig. »Wäh, das ist aber kein Badezimmer.«
»Das ist tatsächlich keineswegs ein Badezimmer.«
»Aber wo ist denn das Badezimmer?«
»Ich wollte sagen, es ist auch ein Badezimmer«, sagte Mrs. Dillon. »Sie nennen es das stille Örtchen. Es ist die einzige Art von Badezimmer, die sie hier auf dem Land kennen.«
»Wäh«, sagte der Junge, sah ihr forschend ins Gesicht und dann wieder auf das Häuschen. Es sah aus wie eines dieser Häuser, die er mit seinem Vater immer aus Karten aufgebaut hatte. »Bist du auf ein stilles Örtchen gegangen, als du ein kleiner Junge warst?«
»Bin ich immer«, sagte Mrs. Dillon voller Überzeugung.
Robert trat unsicher auf der Stelle und umklammerte sich. »Du musst mit mir gehen«, wimmerte er.
»Nein, ich werde nicht mit dir gehen. Ich würde mir meine Röcke in diesem Unkraut so nass machen, dass sie nie wieder trocken werden. Du gehst da rüber, und ich warte genau hier.«
»Du gehst nicht weg?«
»Wo sollte ich denn hingehen, um Himmels willen? Auf einen Telefonmast klettern?«
Robert kicherte, seine Mutter gab ihm einen leichten Stoß, und er betrat den Pfad nach unten. Als er nach mehreren Pausen und wütenden Aufforderungen weiterzugehen den Graben erreichte, konnte er erkennen, dass das Häuschen leer war, und ab da schritt er tapfer voran. Er ging rein und schaute sich um. Der einzige Einrichtungsgegenstand in diesem Bau war etwas, das wie eine Truhe mit zwei Löchern aussah und an der gegenüberliegenden Wand stand. Er näherte sich dem Ding langsam und schaute schnüffelnd in einen schwarzen Schlund hinunter. Dann schob er sein Gesicht näher an das kleinere der beiden Löcher, das für Frauen bestimmt war, und studierte es eine Weile mit größtem Interesse.
Stirnrunzelnd – falls man bei einem knapp siebenjährigen Kind von gerunzelter Stirn sprechen kann – ging er zur Tür zurück.
»Da unten ist irgendwas«, rief er. »Es ist nicht gespült.«
»Es wurde nicht gespült«, verbesserte ihn Mrs. Dillon.
»Weiß ich, dass es nicht wurde.«
»Robert!«, zischte Mrs. Dillon. »Wenn du nicht aufhörst, mich zu ärgern – wenn ich zu dir rüberkommen muss …!«
»Aber es ist nicht … es ist voll.«
»Ist es nicht!« Mrs. Dillon brüllte schon fast. »Da ist immer noch genügend Platz!«
»Ja, aber was machen die denn damit?«
»Ich weiß es nicht!«, schrie Mrs. Dillon und seufzte. »Schon gut, ja, ich weiß es. Die Chinamänner kommen herauf und holen es ab.«
»Oh«, sagte ihr Sohn.
In ihrer Aussage war genug Wahres enthalten, von dem er schon gehört hatte, dass er damit zufrieden war. Er konnte nicht verstehen, warum die Chinamänner eine dermaßen stinkende Arbeit übernahmen oder wie sie es schafften, durch die Erde heraufzukommen, um das zu erledigen. Aber genauso wenig konnte er verstehen, wie es möglich war, dass sie auf der anderen Seite der Erde mit dem Kopf nach unten herumliefen, was sie ja zweifellos taten.
»Aber dann« – er zögerte – »tauchen sie ja vielleicht auf und packen mich.«
»Ich schwöre dir, dass sie dich wieder zurückbringen würden, wenn sie’s tun würden!«, antwortete seine Mutter. »Aber sie tun das nicht. Sie sind so spät nicht mehr draußen. Und jetzt mach endlich!«
Und Robert machte. Angenehm aufgeschreckt von der plötzlichen Nähe der Chinamänner und von der Idee belustigt, er könnte einen Nachzügler anpissen, erledigte er das, was von ihm erwartet wurde, und drehte sich um, um den Ort zu verlassen. Was er jedoch nicht sofort machte, natürlich. Sein schwacher Punkt, der seinen Grund im Moment vielleicht in einer körperlichen Schwäche hatte (das Bedürfnis, sich auszuruhen und zugleich eine Entschuldigung dafür zu haben), war, dass er seiner Neugier freien Lauf ließ, sobald sie geweckt wurde.
Er entdeckte einen zerknitterten Katalog, der an einem Nagel an der Wand hing. Er nahm ihn herunter, trug ihn zur Tür, hielt ihn hoch und forderte eine Erklärung, warum man ihn hier angebracht hatte.
»Robert! Du kommst jetzt sofort wieder rüber!«
»Aber wozu ist das denn?«
»Das ist … das ist, um es zu lesen!«
»Na gut«, sagte der Junge, »dann sollte ich es vielleicht besser mal ein bisschen lesen.«
Er öffnete das dicke Buch umständlich und fing an, sich durch die Seiten zu blättern, auf der Suche nach Abbildungen, die ihm helfen würden, den Text zu verstehen. Er war ein dünner, blasser, unbeholfener Junge mit einem großen Kopf und sandfarbenen Haaren. Er trug einen, wie man es damals nannte, Buster-Brown-Anzug: ein Matrosenhemd mit einem großen herabfallenden Kragen und eine knielange, weit ausgestellte Hose, die an der Taille mit einem Ring großer weißer Knöpfe befestigt war. Auf dem Kopf hatte er einen breitkrempigen braunen Seemannshut, der von einem Gummiband unter dem Kinn festgehalten wurde und um den Kopfteil herum und an der Rückseite mit Bändern geschmückt war. An den Füßen trug er braun gestreifte, wadenlange Strümpfe und solide Slipper aus Leder.
Er hatte diese Tracht nur akzeptiert, nachdem ihm Mrs. Dillon mehrmals versichert hatte, dass es die gängige Uniform der Armee der Vereinigten Staaten wäre. Sie hatte ihn in der vergeblichen Hoffnung so ausstaffiert, die Kontrolleure im Zug über sein wahres Alter hinwegtäuschen zu können.
Es war ihre Veranlagung zu strengster Sparsamkeit, die sie auf die Idee gebracht hatte, es damit zu versuchen, aber als sie ihn jetzt ansah, schossen ihr Tränen in die Augen, weil er so ahnungslos und voller Vertrauen war und zugleich so albern aussah. Was für eine Schande, das Vertrauen eines Kindes so zu missbrauchen! Dafür gab es keine Entschuldigung. Das werde ich, dachte sie, nie wieder tun.
Sie kniff ihre Augen zusammen und bedeckte sie einen Moment lang mit der Hand. Und als sie sie wieder öffnete, stand er direkt vor ihr und lächelte stolz zu ihr hoch.
»Die Chinamänner haben mich nicht gekriegt, Mama. Ich bin ganz allein da reingegangen, und ich hatte überhaupt keine Angst.«
»Natürlich hattest du keine Angst! Du bist doch Mamas großer tapferer Junge, stimmt’s?«
»M-hm. Gehen wir jetzt rüber zum Haus von Grandpa Fargo?«
»Ja, mein Schatz.«
»Und ist Papa da?«
»Ich fürchte, nein, Schätzchen.«
»Aber du hast gesagt, er ist da! Du hast gesagt, dass Papa da ist! Du weißt, dass du’s gesagt hast! Du hast gesagt …«
»Das stimmt«, sagte Mrs. Dillon, »vielleicht ist er ja da. Wir werden sehen.«
2.
Lincoln Fargo war im Alter zwischen zwölf und siebzehn in die Armee der Union eingetreten. Er war eine Waise und in einer Zeit geboren, in der die Lebensdaten von Menschen nur ungenau verzeichnet wurden, und deshalb wusste er nicht, wie alt er war – und es spielte auch keine Rolle. Er pflegte zu sagen – in Anspielung auf einen Ausspruch des Mannes, nach dem sie ihm seinen Namen gegeben hatten –, dass er alt genug war.
Er war vor allem deshalb zur Armee gegangen, weil er dafür bezahlt wurde (er war für den Sohn eines reichen Farmers eingesprungen und hatte dafür zweihundert Dollar bekommen); und zweitens, weil es der richtigen, der patriotischen Sache diente. Aber vielleicht hatten ihn auch beide Aspekte zu gleichen Teilen dazu bewegt. Er war so stolz auf seine Reputation wie jeder andere Mann, und er war nur so käuflich, wie es nötig war. Aber als Junge, der keine andere Zukunft hatte als die, die er sich selbst aufbaute, musste er es womöglich ein wenig mehr sein als andere.
Er war in der Armee geblieben, weil er nicht wusste, wie man ausstieg. Und obwohl er das Beste daraus gemacht hatte und dann als Full Sergeant entlassen wurde, hatte er seitdem nur noch eine sehr schlechte Meinung von Kriegen. In seinem Innersten war er davon überzeugt, dass er betrogen worden war.
Mit beträchtlichem Abstand, und umso schärfer, je genauer er darüber nachgedacht hatte, war ihm klar geworden, dass ein Mann nicht mehr Freiheit bekam, als er sich selbst erarbeitete. Manchmal bekam er nicht mal so viel, es sei denn, er hatte Glück; mit Sicherheit jedoch war der Versuch nutzlos, sie ihm einfach zu schenken. Die Muskeln, die man bekam, wenn man sich seine Freiheit erkämpfte, benötigte man, um sie zu behalten, und wer sie nicht hatte, würde nicht lange frei bleiben. Es gab jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Sache zu betrachten. Angenommen, dein Nachbar hat einen Hund in seinem Keller eingesperrt, und du willst ihn dazu bringen, ihn freizulassen. Es kommt zum Kampf, ihr werdet beide getötet und habt das Haus bis auf die Grundmauern zerstört. Der Hund ist jetzt frei, aber war es das wert? Und hätte er es nicht wahrscheinlich selbst herausgeschafft, oder hätte sich der Nachbar nicht ohnehin bald erweichen lassen?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!