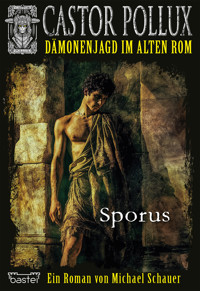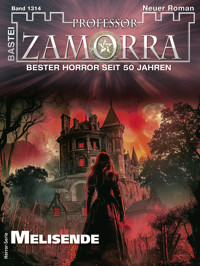2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Schmerzen waren so unerträglich, dass Daria wünschte, erneut in Bewusstlosigkeit zu sinken oder gar vom Tod in die Arme geschlossen zu werden. Weder das eine noch das andere geschah. Schließlich schleppte sie sich unter Qualen und mit letzter Kraft in die nahen Wälder, wo sie in eine lähmende Starre verfiel. Ihre Anführerin und ihre Schwestern waren tot, den verfluchten Waffen des Bezwingers und seines Gefährten zum Opfer gefallen. Nur ihr war es gelungen, schwer verletzt dem Inferno zu entkommen. Während Daria dort lag, gelangte sie zu einer Erkenntnis: Sie hatte überlebt, um Vergeltung zu nehmen. Das war ihre Bestimmung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelseite
Das Erbe der Genoveva
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Impressum
Das Erbe der Genoveva
von Michael Schauer
Die Schmerzen waren so unerträglich, dass Daria wünschte, erneut in Bewusstlosigkeit zu sinken oder gar vom Tod in die Arme geschlossen zu werden. Weder das eine noch das andere geschah. Schließlich schleppte sie sich unter Qualen und mit letzter Kraft in die nahen Wälder, wo sie in eine lähmende Starre verfiel.
Ihre Anführerin und ihre Schwestern waren tot, den verfluchten Waffen des Bezwingers und seines Gefährten zum Opfer gefallen. Nur ihr war es gelungen, schwer verletzt dem Inferno zu entkommen.
Während Daria dort lag, gelangte sie zu einer Erkenntnis: Sie hatte überlebt, um Vergeltung zu nehmen. Das war ihre Bestimmung.
Bonifazius saß in seinem riesigen Sessel, der direkt aus dem schwarzen Fels gehauen war. Sein privates Gemach befand sich in einer weitläufigen Höhle mit feucht glänzenden Wänden. Dutzende in den Stein eingelassene, schädelgroße und phosphoreszierende Kristalle tauchten den Raum in ein düsteres violettes Licht. Dünne Nebelschwaden waberten knöchelhoch durch die Höhle.
Hoch über ihm unter der Decke schwebte Zafir, sein persönliches Orakel, ein Gebilde aus tausenden blau funkelnden Lichtpunkten. Der Anblick erinnerte ihn an den nächtlichen Sternenhimmel der menschlichen Welt. In unregelmäßigen Abständen tauschten die Punkte in rasender Geschwindigkeit ihre Positionen, bevor sie bis zum nächsten Wechsel verharrten. Dies spielte sich stets in völliger Lautlosigkeit ab.
Nur selten zog sich der oberste Richter in diese vollkommene Stille zurück. Seit einigen Monaten jedoch neigte er zur Grübelei und hielt sich weit häufiger hier auf als üblich. Es gab so vieles, worüber er nachdenken musste. Stundenlang kreisten seine Gedanken um sein jüngstes Gespräch mit dem Fährmann, seinem alten Gefährten. Ihm allein hatte er anvertrauen können, was ihn umtrieb, seitdem die Finsteren die Schlacht auf dem Feld der Helden verloren hatten.
Die dunklen Götter Mogum und Teren hatten ihren Bruder Elat verraten und damit die Niederlage besiegelt.1 Auch wenn der Fährmann in diesem Punkt eine andere Meinung vertrat, Bonifazius war fest davon überzeugt. Letztlich kam es darauf nicht an. Die Götter hatten einen der ihren hintergangen und so das Reich geschwächt. Dies war eine Tatsache.
Und was war passiert? Kaum hatte es Vakaenos geschafft, einen neuen Riss in den Schutzschirm zu schlagen, war es dem Bezwinger gelungen, in seine Welt zu fliehen. Sehr wahrscheinlich mithilfe von Jupiter und seinen elenden Spießgesellen. Damit hätten sie gegen den Pakt verstoßen, jedoch kümmerte es scheinbar niemanden.
Obwohl seit der Schlacht viel Zeit vergangen war, brannte Bonifazius’ Zorn unvermindert. Wie griechisches Feuer, das nur noch höher loderte, wenn man es mit Wasser zu löschen versuchte.
Wenn Mogum und Teren nicht davor zurückschreckten, ihren Bruder zu opfern, machten sie vor nichts Halt. Das bedeutete, dass sie auch ihn ohne Zögern fallenlassen würden, sollten es die Umstände eines Tages erfordern. Zumindest aus ihrer Sicht.
Es war vor allem diese Möglichkeit, die ihm nicht enden wollendes Kopfzerbrechen bereitete. Sein Status, seine ganze Macht war ihm von den Göttern verliehen worden. Wie sicher konnte er sich all dem noch sein? Unter den ihm untergebenen Richtern gab es einige, die nur darauf lauerten, seinen Platz einzunehmen, dessen war er sich wohl bewusst. Vielleicht waren sie gerade in diesem Moment dabei, Ränke gegen ihn zu schmieden.
Elat hatte den Fehler begangen, Mogum und Teren zu vertrauen, und deshalb lag er jetzt in einem tiefen Schlaf auf dem Friedhof der Ewigen. Sollte es jemandem gelingen, ihn aus seinem Grab zu befreien, würde er sich seinem Retter für alle Zeiten zu Dank verpflichtet sehen – nachdem er sich an seinen Brüdern gerächt hatte.
Falls Bonifazius dieser Jemand war, hätte er damit seine Position auf immer gefestigt.
Du wandelst auf einem gefährlichen Pfad.
Er konnte die mahnenden Worte des Fährmanns so deutlich hören, als stünde dieser direkt neben ihm. Sollten die verbliebenen Götter erahnen, mit welchen Gedanken er sich befasste, wäre seine Existenz augenblicklich besiegelt.
Die meisten Finsteren – zumindest jene, die überhaupt von diesem Ort Kenntnis hatten – waren der Ansicht, dass eine Verbannung auf den Friedhof der Ewigen unwiderruflich sei, sofern sie nicht von den Göttern selbst rückgängig gemacht wurde. Bonifazius wusste, dass sie sich irrten. Er kannte viele Geheimnisse, die sich anderen nie enthüllen würden.
Um Elat zu erwecken, musste ein Opfer gebracht werden. Natürlich nicht irgendeines. Kein glückloser Druide wie Marton, der für die Auferstehung des Zerstörers sein nutzloses Leben hatte lassen müssen. Nein, hierfür war ein ganz besonderes Geschöpf notwendig.
Ein Zwitter, halb Mensch, halb Finsterer. Zwei Welten, vereint in einem Körper. Eine einzigartige Monstrosität. Cassia war eine Halbdämonin gewesen, die von Ballurat dazu gemacht worden war, bevor sie in Ungnade fiel. Dergleichen zählte nicht. Der Zwitter musste als solcher geboren sein.
Soweit Bonifazius bekannt war, hatte bislang nur ein einziges Wesen dieser Art existiert, und das lag Ewigkeiten zurück. Wie man sich erzählte, war der Zwitter eines Tages spurlos verschwunden. Vermutlich von den Göttern beseitigt, denen er nicht geheuer war.
Seit einigen Monaten erhielt er von Zafir Zeichen, die darauf hindeuteten, dass die Geburt eines neuen Zwitters bevorstand. Sicher konnte er da nicht sein. Das Orakel war nie eindeutig, seine kargen Hinweise ließen stets weiten Raum für Interpretationen. Bonifazius hatte Zafir von seinem Vorgänger geerbt und die wahre Funktion des Orakels bis heute nicht entschlüsseln können. Womöglich würde ihm das nie gelingen.
In dieser speziellen Angelegenheit hoffte er, die Zeichen richtig zu deuten. Die Ankunft eines Zwitters würde einem Fingerzeig gleichkommen, seinen Gedankenspielen Taten folgen zu lassen. Beinahe schien es, als ob Elat selbst ihm auf diesem Weg den Befehl gab, ihn zu befreien.
Bonifazius hob so ruckartig den Kopf, dass der kleine Schädel auf der Krempe seines Huts ein klackerndes Geräusch erzeugte. Das plötzliche Gefühl hatte ihn nicht getäuscht. Die Lichtpunkte waren erneut in Bewegung geraten, deutlich schneller als sonst. Sie sausten mit so hoher Geschwindigkeit in alle Richtungen, dass er sie nur als blaue Lichtstreifen wahrnahm.
Unvermittelt stoppten Dutzende von ihnen und wechselten ihre Farbe zu einem durchdringenden Rot. Sie zeichneten ein Bild, das er rasch zu erfassen versuchte, bevor es wieder verschwand. Ein Lächeln kerbte sich um seinen lippenlosen Mund, als er die Stadtmauern Roms erkannte, des Zentrums der verhassten Menschenwelt. In ihrem Innern leuchtete der Umriss einer offenkundig schwangeren Frau. Vor ihrem Bauch bildeten die Punkte ein leuchtendes Zeichen, ein Dreieck mit abgeflachten Ecken, in dessen Mitte drei weitere Punkte auf einer schrägen Linie aneinandergereiht flackerten.
Neue Punkte kamen hinzu und fügten sich zu Zeichen aus einer uralten Sprache zusammen. Bonifazius las – und war überrascht. Höchst interessant.
Im nächsten Moment nahmen die Punkte ihre ursprüngliche Farbe an, sodass nichts mehr zu erkennen war außer einem Meer von Lichtern. Die Erscheinung war vorüber.
Bonifazius schloss die Augen und schickte einen stummen Ruf nach Kalanda aus, der nur wenig später die Höhle betrat. Wie stets trug sein spindeldürrer Diener eine zerschlissene schwarze Kutte. Die Kapuze hatte er in den Nacken geschoben, damit Bonifazius einen unverhüllten Blick auf seinen gelblichen, völlig kahlen Schädel und die längliche, von Falten durchzogene Fratze hatte, deren Zentrum eine hakenartige Nase entsprang. Die brauenlosen, tief in den Schatten liegenden Augen glühten in einem düsteren Gelb. Kalanda öffnete den Mund und entblößte aschgraue, nadelspitze Zähne. Statt Ohren hatte er auf beiden Seiten seines Schädels je zwei kreisrunde schwarze Löcher. Unablässig rann ein Faden schleimigen Speichels aus seinem linken Mundwinkel.
Niemand wusste, dass Kalanda für Bonifazius arbeitete. In seinen frühen Tagen als Richter hatte er den niederen Dämon davor bewahrt, im See der vergessenen Seelen zu landen. Aus purer Niedertracht hatte Kalanda eine Jägerin getötet, wofür er ein solches Urteil durchaus verdient hätte. Bonifazius hatte ihn verschont, weil ihm sein Instinkt sagte, dass ihm dieses verschlagene Wesen noch gute Dienste leisten konnte.
Er hatte sich nicht getäuscht. Kalanda vergalt ihm seine Rettung mit bedingungsloser Loyalität und Treue. Nicht zuletzt den wertvollen Informationen, die er auf verschlungenen Wegen zu beschaffen wusste, hatte Bonifazius seinen raschen Aufstieg zu verdanken.
Einzig und allein ihn konnte er mit dem Auftrag betrauen. Niemand sonst durfte davon erfahren.
»Du hast mich gerufen, Herr?«, fragte Kalanda mit seiner charakteristisch heiseren Stimme.
»Ich habe eine neue Mission für dich. Du wirst nach Rom gehen.«
»Nach Rom, Herr?« Seine kalten Augen fixierten das unter der weiten Kapuze verborgene Gesicht des Richters.
»Die Zeichen sagen, dass bald ein neuer Zwitter geboren wird.«
»Ein Zwitter? Bist du sicher, Herr? Es muss Jahrtausende her sein, dass dergleichen zum letzten Mal geschehen ist.«
»Stellst du etwa meine Worte infrage?«
Kalanda zuckte zusammen wie unter einem Peitschenhieb. »Selbstverständlich nicht. Verzeih, Herr.«
»Finde die Mutter und bring sie zu mir. Ich würde des Kindes gerne habhaft werden, noch bevor es zur Welt kommt.«
»Darf ich mich mit der Mutter vergnügen, wenn sie geworfen hat?«
Bonifazius verzog missbilligend das Gesicht. Kalandas seltsame Faszination für menschliche Frauen war ihm ebenso fremd wie unverständlich. Zumal sein Diener deren Welt noch nie betreten hatte und entsprechend keinem dieser Weiber je begegnet war. Aber was schadete es schon?
»Einverstanden. Sie soll deine Belohnung sein. Nach der Geburt darfst du mit ihr verfahren, wie es dir beliebt.«
»Ich nehme an, dass wie meist niemand etwas davon wissen darf?«
»So ist es. Sollten die Götter davon erfahren, kostet es mich meinen Kopf, und deinen ebenso. Und noch etwas: Der Bezwinger könnte sich wieder in Rom aufhalten. Seinem Schwert hast du nichts entgegenzusetzen. Die Mutter des Zwitters stammt zudem aus seinem Umfeld und könnte bewaffnet sein. Eine offene Konfrontation rate ich dir deshalb zu vermeiden. Sei auf der Hut, Kalanda. Deine Mission ist ebenso bedeutsam wie gefahrvoll.«
»Natürlich, Herr. Du kannst dich auf mich verlassen.«
Mit diesen Worten zog er sich die Kapuze über den Schädel, drehte sich um und eilte davon. Augenblicke später war Bonifazius wieder allein. Abermals legte er den Kopf in den Nacken, doch Zafir hatte ihm nichts mehr zu sagen.
Zweifel beschlichen ihn, ob er das Richtige tat. Ob das Risiko nicht zu groß war.
Verärgert schüttelte er den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben. Das Auftauchen des Zwitters zu diesem Zeitpunkt konnte unmöglich ein Zufall sein. Es war vorherbestimmt. Ein Gott würde erwachen und ihn, Bonifazius, an seine Seite berufen. Nie zuvor hatte ein Finsterer die Möglichkeit gehabt, eine solche Machtfülle zu erlangen.
Das war es wert. O ja, das war es.
Nach einigen Tagen, an denen sich Daria kaum hatte rühren können, war eine alte Frau aufgetaucht, hatte sie an den Fußknöcheln gepackt und unter Ächzen und Keuchen in ihre Hütte gezerrt, wo sie auf ein karges Bett mit einer Matratze aus muffig riechendem Stroh gelegt worden war. Die Alte, deren Name Mabula lautete, hatte sie in den kommenden Wochen mit einer abscheulich schmeckenden Brühe gefüttert. Außerdem hatte sie die Wunde, die Daria von dem Streifschuss mit dem weißen Pfeil davongetragen hatte, mit einem Schlamm aus Kräutern und feuchter Erde behandelt.
Nach einiger Zeit hatte die Starre begonnen, sich zu lösen. Trotzdem hatte es Monate gedauert, bis Daria so weit zu Kräften gekommen war, dass sie sich von ihrem Lager erheben konnte. Auch danach fühlte sie sich schwach und elend.
Ihre Retterin hatte sich als überaus schweigsam erwiesen. Ihren wenigen Gesprächen entnahm Daria, dass sie einst selbst eine Genovevanerin gewesen war, die sich in die Einsamkeit des Waldes zurückgezogen hatte. Näheres ließ sich Mabula nicht entlocken. Jedoch bestärkte sie Daria mit Eifer in ihrem Wunsch, nach Rom zu gehen und sich an den Mördern ihrer Schwestern zu rächen.
Es vergingen fast zwei Jahre, bevor sie sich dazu in der Lage sah. Erst dann war ihre Wunde endgültig verheilt, wobei eine hässliche Narbe zurückblieb, die an eine Verbrennung erinnerte.
Oft dachte sie in dieser Zeit daran zurück, wie sie überlebt hatte. Von unerträglichen Schmerzen gequält, hatte sie sich unter einer Brücke versteckt, bis der Bezwinger und sein Freund abgezogen waren. Danach hatte sie sich aufgerappelt und war in die Wälder geflüchtet, wo sie ihre Kräfte endgültig verlassen hatten. Auf ihrer Flucht war sie an dem unförmigen schwarzen Klumpen vorbeigekommen, der von ihrer Anführerin geblieben war. In seiner Nähe hatte sie ein Funkeln im Gras bemerkt. Den Splitter des Galar hatte sie sofort erkannt und an sich genommen.
Ihre Trauer um Genoveva kannte keine Grenzen. Sie war es gewesen, die ihr den Weg aus diesem Elend zeigte, das sich Leben nannte. Eine einfache Frau wie Daria hatte nicht viel zu erwarten, außer einen Mann zu heiraten, sein Haus zu hüten, seine Kinder zu gebären und ihm zu Willen zu sein, wann immer er es verlangte.
Diese Vorstellung war ihr unerträglich vorgekommen, nur gab es keinen Ausweg. Sicher, sie hätte ihr Dorf verlassen können, doch wohin hätte sie gehen sollen? Ihre Zukunft war vorherbestimmt, bis Genoveva auftauchte und sie einlud, sich ihr anzuschließen.
Daria war voller Hoffnung gewesen. Einer Hoffnung, die sich nur wenig später zerschlagen hatte, durch die Schuld dieser Römer. Ihre Todesschreie würden wie süße Musik in ihren Ohren klingen.
Ihr Plan lautete, dem Orden in Rom ein neues Leben einzuhauchen. Sie würde die zweite Genoveva sein, dabei jedoch mit größerer Vorsicht vorgehen. Die alte Anführerin hatte erst Lutetia und dann ganz Gallien erobern wollen, und das mit einer winzigen Armee von nur acht Hexen. Daria wollte weit mehr Anhängerinnen um sich scharen, bevor sie zum Sturm auf Rom blies.
Noch waren ihre Hexenkräfte nicht zurückgekehrt, aber eines Tages hatte sie gespürt, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Deshalb traf sie die Entscheidung, nach Rom aufzubrechen.
Der Abschied von Mabula war kurz ausgefallen. Die alte Frau wünschte ihr mit dürren Worten Glück und schloss dann die Tür ihrer Hütte. Daria wusste, dass sie sich nie wiedersehen würden.
Seitdem war einige Zeit vergangen. Sie hatte viele Meilen zurückgelegt und ihre Heimat hinter sich gelassen. Während sie nun stoisch einen Fuß vor den anderen setzte, warf sie ihrer Begleiterin einen Seitenblick zu. Sie hatten sich in Gallien in einem Dorf kennengelernt und festgestellt, dass sie dasselbe Ziel hatten, nämlich Rom. Auf Darias Vorschlag hin hatten sie sich zusammengetan und gemeinsam eine Küstenstadt erreicht, in der sie sich nach Ostia, dem römischen Hafen, eingeschifft hatten. Nun trennten sie nur noch wenige Meilen von ihrem Ziel.
Die Frau, die sich Cassia nannte, war ihr ein Rätsel geblieben, und daran würde sich wohl auch nichts mehr ändern. Ähnlich wie Mabula hüllte sie sich meist in Schweigen. Wie Daria herausbekommen hatte, war Rom ihre Heimat. Nach einem Aufenthalt auf Korsika – den Grund dafür kannte Daria wiederum nicht – war sie eine ganze Weile herumgereist, bevor sie sich zur Heimkehr entschieden hatte.
Sie war abgemagert und machte einen heruntergekommenen Eindruck. Ihr Gewand hing mehr oder minder in Fetzen an ihr, das schulterlange Haar war struppig und hatte jeden Glanz verloren. Umso ungewöhnlicher wirkte das lange Schwert, das in einer Scheide an ihrem Gürtel baumelte. Normalerweise lief eine Frau nicht mit einer solchen Waffe herum, weshalb sie mehr als einmal erstaunte Blicke auf sich zog. Jedoch wagte es niemand, sie darauf anzusprechen.
Was andere Menschen anbelangte, ging etwas Abweisendes, ja Bedrohliches von Cassia aus.
Im Gegensatz zu Daria besaß sie Geld und war bereit, es mit ihr zu teilen. Was sie in die Lage versetzte, Essen und Trinken nicht mühsam stehlen zu müssen sowie die Passage für das Schiff bezahlen zu können.
Auf welche Art und Weise Cassia für Nachschub in ihrem Geldbeutel sorgte, hatte Daria eines Nachts in der dunklen Gasse einer kleinen Stadt beobachten können. Zu dergleichen wäre sie niemals in der Lage gewesen. Das dumpfe Grunzen des grobschlächtigen Burschen, der sich an Cassia abarbeitete, klang ihr immer noch in den Ohren.
Einige Male hatte Daria darüber nachgedacht, ihre Begleiterin als erstes Mitglied des neuen Ordens zu gewinnen. Aus ihr selbst unerfindlichen Gründen hatte sie bislang gezögert, sie darauf anzusprechen. Womöglich, weil Cassia derart unnahbar wirkte.
Doch sie würden nicht auseinandergehen, ohne dass sie ihr das Angebot unterbreitet hatte.
Ein Rascheln riss sie aus ihren Gedanken. Daria hob den Blick. Vor ihnen waren zwei Männer auf den Pfad getreten und versperrten den Weg. Der Größere der beiden trug eine schmutzige Tunika, die diverse Löcher aufwies. Das schwarze Haar auf seinem kantigen Schädel war so dünn, dass die Kopfhaut hindurchschimmerte. Narben zierten seine Stirn und seine fleischigen Wangen, das linke Auge hatte er halb geschlossen, als könne er das Lid nicht richtig öffnen. In seiner rechten Hand hielt er eine mit Nägeln bewehrte Keule.
Sein Begleiter war einen Kopf kleiner und ähnelte ihm so sehr, dass es sich nur um Brüder handeln konnte. Auch er war mit einer verdreckten und löchrigen Tunika bekleidet. Sein Gesicht war unversehrt, dafür hatte er Brandnarben auf beiden Armen und am linken Bein. Bewaffnet war er mit einem Kurzschwert, dessen matte Klinge darauf schließen ließ, dass er die Waffe nicht eben mit besonderem Eifer pflegte.
Daria und Cassia blieben stehen. Die Männer grinsten sie an.
»Was sagst du dazu, Peterus?«, ergriff der Größere das Wort. »Gerade fürchtete ich noch, dass wir heute leer ausgehen, da tauchen die beiden Täubchen hier auf.«
»Die Götter sind mit uns, Mikus. Die zwei kommen zur rechten Zeit.«
Daria spürte Nervosität in sich aufsteigen. Diese Waffen konnten sie zwar nicht so leicht verletzen wie einen gewöhnlichen Menschen, dennoch war sie keineswegs unverwundbar. Die mit Nägeln beschlagene Keule machte einen ebenso furchterregenden Eindruck wie ihr Besitzer.
Sie zwang sich zur Ruhe. Wie wollte sie einen Orden führen, wenn sie beim Anblick von zwei lumpigen Banditen in Panik ausbrach? Zwar hatte sie in den vergangenen Tagen gespürt, dass sich ihre Hexenkräfte langsam erholten, so wie es sich angedeutet hatte. Dennoch war sie weiterhin geschwächt. Schweiß trat auf ihre Stirn, als sie ihre Muskeln anspannte und versuchte, sich zu konzentrieren und ihre Kräfte zu aktivieren.
Ein metallisches Kratzen drang an ihre Ohren. Sie sah zur Seite. Cassia hatte ihr Schwert gezogen. Erstaunt bemerkte Daria, dass die zwei Fuß lange Klinge grünlich schimmerte und in einer Doppelspitze endete. Auf dem Metall waren fremdartige Zeichen eingeritzt.
Die Banditen begannen zu lachen, doch das Gelächter klang dünn und unsicher. Mit Gegenwehr hatten sie wohl nicht gerechnet. Gleichzeitig hoben sie ihre Waffen. Der Keulenmann leckte sich über die Lippen. Sein Kumpan richtete die Spitze seines Gladius auf Cassia.
»Lass das Ding fallen, bevor du dich schneidest«, befahl er und grinste. »Du machst es nur schlimmer, kleine Hure.«
Wortlos setzte sich Cassia in Bewegung.