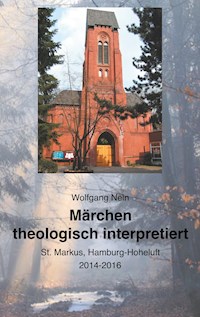Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Das Ja zum Leben und zum Menschen
- Sprache: Deutsch
Besonders im lutherischen Gottesdienst spielt die Predigt eine bedeutsame Rolle. Die Predigt ist zwar nicht nur für den Kopf bestimmt. Sie soll auch zu Herzen gehen. Aber sie wendet sich schwerpunktmäßig doch vor allem an den Verstand. Sie will helfen zu verstehen, was der Bibeltext aussagt, was er uns zu geben hat, was er mit unserem Leben zu tun hat und was er von uns will. Die Predigt will dem Predigthörer zu ein wenig mehr Eigenständigkeit verhelfen. Sie will ihm Material an die Hand geben, eigenständig nachzudenken über das, was im Gottesdienst sonst noch geschieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wunderbar menschlich
20. Januar 1985
2. Sonntag nach Epiphanias
Johannes 2,1-11
Das Wort will Wirklichkeit werden
10. Februar 1985
Sexagesimae
(2. Sonntag vor der Passionszeit)
Lukas 8,4-15
Unglaubliche Geduld – letzter Versuch!?
2. März 1985
Reminiszere
(2. Sonntag in der Passionszeit)
Markus 12,1-12
Frei werden vom Tod, bevor wir sterben
24. März 1985
Judika
(5. Sonntag der Passionszeit)
Hebräer 5,7-9
Fußwaschung als Geste des Dienens
4. April 1985
Gründonnerstag
Johannes 13,1-15
Gestorben – und dennoch lebt er noch heute
7. April 1985
Ostermorgen
Markus 16,1-8
Abschied in die ewige Gegenwart
16. Mai 1985
Himmelfahrt
Lukas 24,(44-49)50-52
Abschied – Aussicht mit Verheißung und Bedrohung
19. Mai 1985
Exaudi
(6. Sonntag nach Ostern)
St. Pauli
Johannes 15,26-16,4
Der Heilige Geist und die weltweite Kirche
26. Mai 1985
Pfingstsonntag
Johannes 14,23-27
Glauben können – unverfügbar wie die Geburt?
2. Juni 1985
Trinitatis
Johannes 3,1-8(9-15)
Kritik an sozialer Ausgrenzung
23. Juni 1985
3. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 15,1-7(8-10)
Wir haben einen Auftrag
14. Juli 1985
6. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 28,16-20
Das Leben als Aufgabe verantwortungsvoll führen
4. August 1985
9. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 25,14-30
Christlicher Glaube und politische Mitverantwortung
11. August 1985
10. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 19,41-48
Selbstgerechtigkeit und aufrichtige Reue
18. August 1985
11. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 18,9-14
Prioritäten im Widerstreit
15. September 1985
15. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 6,24-35
Zu neuem Leben erwecken: Heilung und Heil
22. September 1985
16. Sonntag nach Trinitatis
Hauptkirche St. Katharinen
Johannes 11,1-7.17-27
Jesus – jüdische Herkunft, weltweiter Auftrag
29. September 1985
17. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 15,21-28
Schutz der Frau bei Ehescheidung
20. Oktober 1985
20. Sonntag nach Trinitatis
Markus 10,2-9
Gebet und Buße sind Ausdruck menschlicher Würde
20. November 1985
Buß- und Bettag
Römer 7,18-19
Die Menschenliebe Gottes – Geschenk und Auftrag
25. Dezember 1985
1. Weihnachtstag
Titus 3,4-7
Leben – ein Qualitätsbegriff
5. Januar 1986
2. Sonntag nach Weihnachten
1. Johannes 5,11-13
Das Wort Gottes – ein zweischneidiges Schwert
2. Februar 1986
Sexagesimae
(2. Sonntag vor der Passionszeit)
Hebräer 4,12-13
Jesus beendet den Opferkult
16. Februar 1986
Invokavit
(1. Sonntag der Passionszeit)
Hebräer 4,14-16
Jesus Christus – Priester, Opfer, Erlöser
16. März 1986
Judika
(5. Sonntag der Passionszeit)
Hebräer 5,7-10
Auferstehung aus dem Tod im täglichen Leben
30. März 1986
Ostersonntag
1. Korinther 15,1-11
Kirche - ein Haus für das Mehr an Leben
6. April 1986
Quasimodogeniti
(1. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
1. Petrus 2,5
Gott ist für alle da
8. Juni 1986
2. Sonntag nach Trinitatis
Epheser 2,17-22
Lebensweisheit und Torheit des Glaubens
29. Juni 1986
5. Sonntag nach Trinitatis
1. Korinther 1,18-25
Programm für den Gemeindeaufbau
13. Juli 1986
7. Sonntag nach Trinitatis
Apostelgeschichte 2,41a.42-47
Sein Bestes geben und auf Nachsicht vertrauen
27. Juli 1986
9. Sonntag nach Trinitatis
Philipper 3,7-11
Kraft den Ohnmächtigen
7. September 1986
15. Sonntag nach Trinitatis
Petrus 5,5c-11
Praktische Lösung für theologische Probleme
28. September 1986
18. Sonntag nach Trinitatis
Römer 14,17-19
Was will Gott von uns?
12. Oktober 1986
20. Sonntag nach Trinitatis
1. Thessalonicher 4,1-8
Respekt vor dem Andersdenkenden!
9. November 1986
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Römer 14,7-9
Als Christ die Gesellschaft mitgestalten
16. November 1986
Volkstrauertag
(Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres)
Römer 8,18-25
Krise – Bedrohung und Chance
7. Dezember 1986
2. Advent
Matthäus 24,1-14
Eine wunderbare Nacht
24. Dezember 1986
Heiligabend
Lukas 2,1-10
Göttlicher Heilsplan für eine unheilvolle Welt
28. Dezember 1986
1. Sonntag nach Weihnachten
Matthäus 2,13-18(19-23)
Bibelstellen
Vorwort
Besonders im lutherischen Gottesdienst spielt die Predigt eine bedeutsame Rolle. Die Predigt ist zwar nicht nur für den Kopf bestimmt – sie soll auch zu Herzen gehen –, aber sie wendet sich schwerpunktmäßig doch vor allem an den Verstand. Sie will helfen zu verstehen, was der Bibeltext aussagt, was er uns zu geben hat, was er mit unserem Leben zu tun hat und was er von uns will. Die Predigt will dem Predigthörer zu ein wenig mehr Eigenständigkeit verhelfen. Der Gottesdienstbesucher soll sich durch das liturgische Geschehen im Gottesdienst nicht komplett vereinnahmen lassen. Er soll eine gewisse kritische Distanz wahren dürfen. Die Predigt will ihm Material an die Hand geben, eigenständig nachzudenken über das, was im Gottesdienst sonst noch geschieht.
Im Gottesdienst geht es um unser ganzes Dasein, um unser Leben im umfassendsten Sinne. Manches lässt sich mit Worten allein nicht zum Ausdruck bringen. Die Musik zum Beispiel kann vieles vermitteln, was schwer in Worte zu fassen ist. Von Johann Sebastian Bach wird sogar gesagt, seine Musik sei wie ein fünftes Evangelium. Aber auch die anderen liturgischen Elemente, gesungen oder gesprochen, und die biblischen Lesungen und die Gebete – sie alle versuchen, dem Gestalt zu geben, was unseren Verstand übersteigt.
Aber ganz ohne Verstand wollen wir nicht und sollten wir nicht einen Gottesdienst feiern. Zumindest sollten wir uns immer wieder dessen vergegenwärtigen und dies zu unterscheiden üben, was verstehbar und was unbegreiflich ist.
Die biblischen Texte zum Beispiel enthalten beides – theologisch formuliert: Gotteswort und Menschenwort. Sie sind Menschenwort, weil sie von Menschen verfasst sind und in vielfacher Hinsicht das Menschliche und allzu Menschliche, das kulturell- und zeitbedingte widerspiegeln. Sie sind aber auch Gotteswort, weil sie von all dem Hintergründigen und Geheimnisvollen handeln, das unserer Erfahrungswelt zugrunde liegt, und uns Botschaften vermittelt, die sich am ehesten mit himmlisch und göttlich bezeichnen lassen.
Die Predigt hat auch diese beiden Seiten: Sie ist Menschenwort und Gotteswort zugleich, mal mehr das eine, mal mehr das andere. Vielleicht ist sie meist mehr Menschenwort. Es kommt letztlich auch sehr auf die Hörerinnen und Hörer an: was und wie sie die Predigt aufnehmen. Gleiches gilt auch für den Bibeltext selbst. Die Predigt ist ein Angebot, eine Hilfestellung. Sie will dem Glaubenden und dem christlich Interessierten helfen, am gottesdienstlichen Geschehen mit Herz und Verstand teilzunehmen.
Predigten – auch die Predigten dieses Buches – sind sehr unterschiedlich. Mal enthalten sie viele Informationen – historisch- und literarkritische Informationen über den Bibeltext zum Beispiel, oder sie sind mehr meditativ oder mehr seelsorgerlich oder gesellschaftskritisch oder theologisch. In jedem Fall sind sie als Angebot und Hilfestellung zu verstehen. Sie richten sich an den mündigen Gottesdienstbesucher. Sie sind Teil einer Kommunikation, in der der Prediger auch seine eigenen Einsichten und Glaubensüberzeugungen und Empfindungen erkennbar macht, ohne damit andere bedrängen zu wollen. Viel Freude beim Lesen!
Wolfgang Nein, Oktober 2017
Wunderbar menschlich
20. Januar 1985
2. Sonntag nach Epiphanias
Johannes 2,1-11
Der Abschnitt über die Hochzeit zu Kana steht noch im Zusammenhang mit dem Epiphaniasfest. Es geht um die Offenbarung Gottes in dem Menschen Jesus. Und es geht – vom Menschen her betrachtet – um den Glauben an diesen Jesus als den von Gott Gesandten, also um den Glauben an Jesus als den Christus.
Bevor ich auf dieses Doppelthema von Offenbarung und Glaube zu sprechen komme, möchte ich auf den besonderen Charakter dieser Wundergeschichte hinweisen. Die Verwandlung von Wasser in Wein ist ja nicht gerade die Art von Wundern, die wir von Jesus gewohnt sind. Es ist überhaupt bemerkenswert, dass Jesus sich hier zusammen mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern auf einer Hochzeit befindet, einer fröhlichen und – man kann wohl hinzufügen – „ausgelassenen“ Feier. Denn immerhin hatten die Gäste schon so viel getrunken, dass ihnen der Wein inzwischen ausgegangen war.
Es muss gar nicht so sein, dass wir hier einen historischen Bericht vor uns haben. Die Frage, ob Jesus wirklich auf einer solchen Hochzeit zugegen war, können wir getrost zurückstellen. Bemerkenswert ist, dass Johannes sich nicht scheut, eine solche Geschichte über Jesus zu überliefern und damit Gefahr zu laufen, bei denen Anstoß zu erregen, die Jesus gern nur in seriösen Situationen auftreten sehen möchten.
Anstößig mag diese Geschichte auch denen erscheinen, die sich auf die griechische Mythologie verstehen und denen bekannt ist, dass der griechische Gott des Weines, Dionysos, sich gerade durch dieses Wunder als göttliches Wesen zu erkennen gab, dass er Wasser in Wein verwandelte. Möglicherweise ist aus dem Dionysoskult dieses Motiv zu den Christen gedrungen und hat ihren Bericht über die Wunder Jesu beeinflusst. Diese möglichen Zusammenhänge haben jedenfalls Johannes nicht davon abgehalten, diese Wundererzählung in sein Evangelium aufzunehmen. So kann nun jeder von uns, der an einer fröhlichen Hochzeitsfeier teilnimmt und dabei gern ein paar Gläser guten Weines trinkt, dies in dem Bewusstsein tun, dass Jesus selbst sich nicht zu schade gewesen ist, einmal auf diese Ebene des rein Menschlichen hinabzusteigen.
Nun sollten wir diese Szene aber nicht weiter missbrauchen – etwa durch den genüsslichen Hinweis darauf, dass Jesus hier die Hochzeitsgesellschaft mit immerhin etwa 600 Litern Wein versorgt hat. Damit würden wir ihr einen Zweck unterschieben, der ihr nicht zu eigen ist.
Es geht hier nicht um die Bejahung einer weltlichen Festlichkeit. Wir können nur sagen: Die weltliche Festlichkeit erscheint Johannes nicht als unangemessener Kontext, um das zum Ausdruck zu bringen, worum es ihm eigentlich geht. Es geht ihm um dieses: um die Offenbarung Gottes in Christus. Oder wie es im Text heißt: „Jesus offenbarte mit dem, was er auf der Hochzeit tat, seine Herrlichkeit.“
Nun müssen wir noch genauer hinschauen, was da steht. Johannes schreibt: „Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat.“ Nehmen wir erst einmal das Wort „Zeichen“. Damit ist doch Folgendes gesagt: Wir sollen das Geschehen nicht nur vordergründig verstehen, nicht nur wörtlich nehmen als das, was da steht, sondern wir sollen das äußere Geschehen hinterfragen; denn es weist über sich hinaus. Das Wunder ist ein äußeres Zeichen für eine hintergründige Aussage. Diese hintergründige Aussage muss uns vor allem interessieren.
Wenn es hier heißt: „Es war das erste Zeichen, das Jesus tat“, dann dürfen wir wohl auch die anderen Zeichen, und d. h. die anderen wundersamen Geschehnisse heranziehen, um uns den hintergründigen Sinngehalt erschließen zu lassen. Um hier nur vier der anderen Zeichen zu nennen: die Heilung des seit achtunddreißig Jahren gelähmten Mannes am Teich von Bethesda, die Heilung des Blindgeborenen, die Speisung der Fünftausend und eine Totenauferweckung, die Auferweckung des Lazarus. Diese anderen Zeichen haben durchaus etwas Verbindendes: Sie sind auf eine menschliche Notlage bezogen. Es ist wichtig, sich das einmal vor Augen zu führen.
Die Wunder Jesu sind nicht dadurch etwas Besonderes, dass sie ein bloß spektakuläres Geschehen darstellen. Jesus biegt nicht auf magische Weise grade Löffel krumm oder zaubert Tiere aus dem schwarzen Hut hervor. Bei den über ihn berichteten Wundern handelt es sich um die wundersame Verwandlung menschlichen Leids in Freude. Es ist dieses wunderbare Ziel und Ergebnis seiner Wundertätigkeit, die ihn als göttliche Gestalt auszeichnet, nicht das Magisch-Zauberhafte des Hergangs.
Nun werden wir demgegenüber fragen müssen, wie es sich denn mit der Verwandlung von Wasser in Wein verhält. Hier handelt es sich ja nicht gerade um die Beendigung einer menschlichen Notlage, wenn man das Verzichtenmüssen auf den weiteren Sinnengenuss nicht schon als Not bezeichnen möchte. Aber hier wird doch in sehr symbolträchtiger Weise eine Aussage von zutiefst menschlicher Bedeutung gemacht.
Jesus behebt den Mangel an Wein, indem er die Hochzeitsgäste überreich mit Wein beschenkt und noch dazu mit solchem der besten Qualität und in zuvorkommender Weise, d. h. ohne dass sie es von ihm erwartet hätten oder hätten erwarten können. Die Hochzeitsgäste können ganz unerwartet aus dem Vollen schöpfen. Diese unerwartete und in unserem Leben so seltene Möglichkeit wird ihnen durch die Gegenwart Jesu beschert. Sie können aus dem Vollen schöpfen.
Natürlich geht es hier nicht speziell um den Wein. Vielmehr steht der Wein für all das, was uns durch Jesus als dem Christus überreich zuteilwird. Er steht für den Reichtum der Güte und Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Durch Christus eröffnet sich uns die unerschöpfliche Quelle der Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir empfangen, was wir brauchen, ja, viel mehr als das. Wo in unserem Leben so manches knapp bemessen ist und wir so oft Mangel leiden und wir uns redlich bemühen müssen, um das Notwendigste zur Verfügung zu haben, da fällt uns hier in dem Verhalten Christi der Reichtum Gottes zu.
Es gibt auch unter Menschen Reichtum, und es gibt Menschen, die aus dem Vollen schöpfen können, weil sie selbst reich sind. Und doch ist das in der Regel etwas anderes als das, was wir in unserer Geschichte erfahren. Denn da ist einer reich nicht für sich selbst, sondern um anderer willen, die Mangel leiden.
Jesus bedient sich nicht selbst. Er behält seinen Reichtum nicht für sich. Er nutzt die ihm gegebenen Möglichkeiten nicht zu seinem eigenen Wohlergehen. Er verschenkt sich selbst und macht andere reich. Das ist das eigentliche Wunder, das er vollbringt.
Dass dies ein Wunder ist, spüren wir in aller Deutlichkeit dann, wenn an uns der Anspruch ergeht, einem Mangel abzuhelfen, dem Mangel z. B. an lebensnotwendigen Nahrungsmitteln in den Hungerländern Afrikas. Wir werden dann an uns selbst spüren, wie genau wir kalkulieren, wie wir errechnen, welche Spende wir uns leisten können, und wie weh es uns tut abzugeben, auch wenn wir reichlich haben, und wie viele Gründe uns einfallen, mit unseren Gaben eher zurückhaltend zu sein.
Ich sage dies nicht moralisierend, sondern als reine Feststellung des Unterschiedes zwischen unserer menschlich-allzumenschlichen Art und der göttlichen Art Jesu. In dem Wunder des Geschenkes überreicher Fülle bis schließlich hin zur Selbstentäußerung offenbart sich das göttliche Wesen Jesu. Was uns von der Hochzeit zu Kana berichtet wird, führt uns zeichenhaft dieses Wesen Jesu vor Augen.
Nun die andere Frage: die nach dem Glauben. Für wen wird das Verhalten Jesu zur Offenbarung? Wir haben beim Lesen der Geschichte den Eindruck, dass der Hochzeitsgesellschaft im Großen und Ganzen nicht klar wird, worum es geht. Wir lesen von der erstaunten Reaktion des Tafelmeisters, davon, dass die Diener immerhin wussten, wer veranlasst hatte, dass die Krüge mit Wasser gefüllt werden sollten, der sich dann in Wein verwandelte. Aber was den Glauben angeht, lesen wir im letzten Vers ganz lapidar: „Und seine Jünger glaubten an ihn.“
Es ist nur eine kleine Schar, für die das Verhalten Jesu zur Offenbarung seines göttlichen Wesens wird. Manche nehmen den Hergang gar nicht zur Kenntnis. Manche staunen, aber denken nicht darüber nach. Manche wissen mehr, aber es rührt sie nicht an. Und andere werden durch das Geschehen im Innersten so getroffen, dass sie nicht mehr dieselben bleiben.
Johannes hat dies in seinem Evangelium besonders herausgestellt. Ja, man kann sagen, es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Evangelium, dass es nur einige sind, die zum Glauben an Christus kommen, einige wenige, und dass der großen Mehrzahl Jesus nichts Gutes bedeutet. Zwar hat Jesus viel Wunderbares getan, was zeichenhaft auf seine göttliche Art hinwies. Und er hat das auch in seinen Reden dargetan, aber im Großen und Ganzen sind weder seine Worte noch seine Taten verstanden worden.
Wir können dies wohl aus unserer eigenen Erfahrung als eine Tatsache bestätigen: Es gibt keinen sicheren Weg zum Glauben. Es gibt keine Worte und keine Taten, die uns zwangsläufig in den Glauben hineinführen und eine unausweichliche Überzeugungskraft hätten. Jedes Wort und jede Tat kann auch so ausgelegt werden, dass daraus etwas Nichtssagendes, Bedeutungsloses wird. Darum dürfen wir wohl vom Wunder des Glaubens sprechen. Dass Christus für einige Menschen in der Weise zur Offenbarung geworden ist, dass sie mit ihrem Leben darauf antworten, das ist etwas Wunderbares im doppelten Sinne des Wortes: Es ist ein Wunder und es ist schön.
Glauben heißt: Das Göttliche an Jesus erkennen, es für sich selbst in Anspruch nehmen und es weitergeben, sodass andere daran Anteil haben können.
Die Hochzeitsgäste haben nichts erkannt und sie haben nichts weitergeben können. Sie haben sich schlicht bedient. Die Jünger dagegen sind, so dürfen wir wohl sagen, zu anderen Menschen geworden. Sie haben aus der Fülle der göttlichen Liebe weitergegeben und haben hier und da selbst neue Wunder zustande gebracht.
Wenn es auch keinen sicheren Weg zum Glauben gibt, so ist doch dies gewiss: Der Glaube an die Fülle der Güte, Barmherzigkeit und Gnade Gottes, wie in Jesus Christus offenbart, lebt von Zweierlei: dem Wort und dem zeichenhaften Handeln. Beides brauchen wir, um ein neues Leben im Sinne Jesu Christi führen zu können. Und beides ist von uns gefordert, wenn wir daran mitwirken wollen, anderen Menschen den Zugang zum Leben in Christus zu eröffnen.
Das Wort will Wirklichkeit werden
10. Februar 1985
Sexagesimae
(2. Sonntag vor der Passionszeit)
Lukas 8,4-15
In diesem bekannten Gleichnis wird das Wort Gottes mit der Saat verglichen, die ein Bauer ausstreut.
Damit wird hier vom Wort in einer ganz besonderen Weise geredet. Das Samenkorn ist ja ein Ding, aus dem etwas wachsen soll. Seine eigentliche Bedeutung hat es nicht in sich selbst, sondern in dem, was aus ihm wird.
Damit wird hier also vom Wort anders gesprochen als z. B. in der Dichtung. Die Worte eines Gedichtes können ihre Bedeutung in sich selbst haben. Wenn sie gut gewählt und gut gesetzt sind, dann haben wir unsere Freude an den Worten. Und darin kann sich ihr Zweck durchaus erschöpfen. Diesen ästhetischen Zweck hat das Wort Gottes nicht.
Es ist auch nicht zu einem anderen Zweck bestimmt, zu dem wir die Worte benutzen, nämlich zur Förderung unserer Erkenntnis. Worte sind ja durchaus auch Zeichen, Symbole, Chiffren für Gegenstände und Inhalte unserer Welt. Erst, indem wir diese Dinge in Worte fassen, können wir uns über sie verständigen, sie in unseren Gedanken hin und her bewegen. So dienen sie dann unserer Erkenntnis.
Auch in diesem Sinne ist das Wort Gotts nicht gemeint, weder im ästhetischen Sinne noch als Mittel der Erkenntnis.
Das Wort Gottes ist eben wie ein Samenkorn. Und das Samenkorn ist nicht dazu da, dass man sich an ihm erfreue; in der Regel sieht es ziemlich bedeutungslos und uninteressant aus. Es ist auch nicht dazu da, dass es mit anderen Samenkörnern verglichen, zu anderen in Beziehung gesetzt wird.
Nein, es soll das, was in ihm unsichtbar angelegt ist, entfalten. Das ist sein Zweck, dass daraus die Ähre werde, der Strauch, die Pflanze, der Baum. Und dieser neue Gegenstand ist etwas ganz anderes als das Samenkorn, aus dem es hervorgegangen ist.
So ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort selbst ist nur ein unscheinbares Zeichen. Nehmen wir das Wort Barmherzigkeit. Das sind ein paar Buchstaben. Sofern hiermit das Wort Gottes gemeint ist, soll es uns nicht bloß dazu dienen, dass wir uns an seinem schönen Klang erfreuen. Es soll uns auch nicht bloß dazu dienen, unser Denken anzuregen, dass wir also etwa herauszukriegen versuchten, welche Erscheinungen unserer Welt wohl mit diesem Begriff gemeint sein könnten.
Sofern Barmherzigkeit als Wort Gottes gemeint ist, drängt es – wie das Samenkorn – auf Entfaltung der in ihm angelegten Wirklichkeit.
Die Barmherzigkeit will nicht nur Wort sein. Sie will Wirklichkeit sein, lebendige Erfahrung. Genauso ist es mit den anderen Worten, die wir zum Wort Gottes zählen: Vergebung, Gnade, Liebe, Hilfe, Vertrauen, Hingabe. All diese Worte wollen nicht nur Worte sein, sondern Lebenswirklichkeit, sofern sie als Wort Gottes gemeint sind. Und dieses Wort Gottes ist Wirklichkeit geworden.
Der Evangelist Johannes hat das in unübertrefflicher Weise kurz und knapp so formuliert: „Das Wort ward Fleisch.“ Mit Fleisch meint er Jesus Christus. In diesem Menschen ist das Wort Gottes lebendige, anschaubare, erfahrbare Wirklichkeit geworden. Er hat in seiner Person, durch sein Verhalten und Handeln Barmherzigkeit, Vergebung, Liebe, Hingabe gelebt.
Uns ist nun das Wort Gottes in Form dieser Schrift gegeben, der Heiligen Schrift. Sie soll uns nicht bloß dazu dienen, dass wir uns an den in ihr enthaltenen schönen Gedanken und schönen Formulierungen erfreuen. Sie soll uns auch nicht nur zur Erkenntnis unserer Welt und der damaligen Lebens- und Anschauungsweisen dienen und uns nicht nur zum Nachdenken über uns selbst und unsere Welt anregen.
Das hierin enthaltene Wort Gottes soll wie ein Samenkorn in uns aufgehen und durch uns zu einer erfahrbaren Wirklichkeit werden, so, wie wir das eben von Jesus Christus gehört haben.
An dieser Stelle führt uns das Gleichnis vor Augen, wie es dem Wort Gottes ergehen kann. Und wir spüren: Es geht dabei darum, wie es bei uns aufgenommen wird, auf welchen Boden es dabei fällt. An vier Bildern wird von der Aufnahme des Wortes Gottes bei uns gesprochen.
Das erste Bild ist das vom Weg. Einige Samenkörner fallen auf den Weg. Da werden sie zertreten, und die Vögel fressen’s auf. Die Bilder bedürfen der Auslegung. Jesus sagt: „Die auf dem Weg sind die, die das Wort hören, aber dann kommt der Teufel und reißt es ihnen aus dem Herzen.“
Auch diese Auslegung müssen wir noch in unsere Gedanken übertragen. Der Weg ist ein festgetretener Boden, da kann die Saat nicht eindringen. Sie wird gleich an der Oberfläche zertreten und von den Vögeln wieder weggenommen. Was ist der Weg? Kann der Weg nicht die festgetretenen Pfade unserer Erziehung in Elternhaus und Schule und in unserer Gesellschaft meinen?
Das Wort Gottes ist ja nicht das Erste, was auf uns trifft. Wir sind schon vorgeprägt durch viele Einflüsse. Wir können das heute mit um so größerer Bestimmtheit sagen, als es an der frühkindlichen religiösen Erziehung fast vollständig fehlt. Bevor das Wort Gottes auf uns trifft, haben wir bereits gelernt, ohne es auszukommen. Und wir haben gelernt, uns mit den Anschauungen und Spielregeln zu arrangieren, die in unserer verweltlichten Gesellschaft üblich sind, Anschauungen und Spielregeln, die wir uns angeeignet haben, ohne dabei das Wort Gottes bewusst berücksichtigen zu müssen.
So sind wir in unserem Denken und Verhalten schon vorgeprägt. Die Pfade in uns sind schon ausgetreten und festgeworden. Wenn dann einmal das Wort Gottes auf uns trifft, im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht oder bei anderer Gelegenheit, kann es dann nicht tatsächlich so sein, dass es nicht mehr bei uns einzudringen vermag, weil wir schon festgelegt sind? Wir hören dann das Wort Gottes, aber nehmen es nicht auf. Und die Ansprüche, denen wir uns bisher gefügt haben, fegen es wieder weg. Es muss nicht so sein. Aber bei manchen von uns mag sich zu mancher Zeit dieser Vorgang ereignen.
Das Zweite ist das vom Felsen. Die Saat geht auf, aber geht auch schnell wieder ein, denn es fehlt an Feuchtigkeit. Jesus sagt: „Hier sind diejenigen gemeint, die das Wort Gottes hören und mit Freuden annehmen. Aber sie habe keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang, und in der Zeit der Anfechtung fallen sie wieder ab.“
Hier ist es schon schwieriger, dieses Bild mit einem Beispiel aus unserem Erfahrungsbereich auszulegen. Wo geschieht es unter uns, dass jemand mit einer gewissen Begeisterung das Wort Gottes aufnimmt? Wir könnten vielleicht am ehesten an Evangelisationsveranstaltungen denken oder auch an die Kirchentage, wo doch eine besondere Stimmung vorhanden ist. Da mag es manchen geben, der bisher mit dem Glauben an Christus nichts im Sinn gehabt hat, aber nun durch gute Prediger und eine günstige Atmosphäre entflammt wird. Die Probe kommt dann schon bei der Rückkehr in die Heimatgemeinde. Wie tief die Wurzeln des frisch aufgenommenen Wortes Gottes reichen, wird sich schon daran erweisen, ob die junge Pflanze des Glaubens dem Alltag der Kirchengemeinde standhält.
Das dritte Bild ist das mit den Dornen. Die Saat geht auf, aber die Dornen ersticken das Pflänzchen. Dazu sagt Jesus: „Was unter die Dornen gefallen ist, sind die, die das Wort Gottes hören, dann aber gehen sie hin und ersticken’s unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht.
Im Unterschied zum ersten Bild vom Weg, also von den vorprägenden Einflüssen unserer Erfahrungen und Gewohnheiten, ist hier nun mehr von den Einflüssen auf der Gefühls- und Erfahrungsebene abgestellt. Das wachsende Wort Gottes hat in uns gegen gewisse übermächtige Kräfte anzukämpfen. Da sind zu einen die negativen Erfahrungen, z. B. Enttäuschungen mit Mitmenschen, die uns immer wieder die Kraft nehmen, das Ja Gottes zu uns Menschen nachzusprechen. Da sind auch die Erfahrungen von Not und Leid, die uns an der Wirklichkeit der Liebe, Güte und Barmherzigkeit Gottes zweifeln lassen. Und da sind unsere eigenen persönlichen Sorgen, die uns im Zweifelsfall das Hemd näher sein lassen als die Jacke, und das heißt doch, dass wir die Liebe zum Nächsten hintangestellt sein lassen. Und da sind schließlich die Bedürfnisse, der mächtigste Trieb, es uns selbst wohl ergehen zu lassen, sei es auch auf Kosten anderer. Wie könnten die Reihe fortsetzen.
An vierter und letzter Stelle folgt nun das positive Bild vom fruchtbaren Acker. Jesus sagt: „Das aber auf dem guten Land, das sind die, die das Wort hören und in einem guten und reinen Herzen bewahren und in Geduld Frucht bringen.
Hören, bewahren und Frucht bringen. Das ist ein längerer Prozess des Reifens und ein ganzheitlicher Vorgang. Hier kommt etwas zur vollen Entfaltung. Wenn wir dieses Bild ernstnehmen, dann kann damit nicht nur gemeint sein, dass wir hier und da eine gute Tat tun – einmal zur Kirche gehen.
Wenn wir der gute Acker sein wollen, in dem das Wort Gottes zur vollen Entfaltung kommen soll, dann müssen wir wohl bereit sein, den größten Teil von uns dafür zur Verfügung zu stellen, so, wie das beim Acker in der Regel der Fall ist – das Feld ist groß. Ein ausgetretener Pfad hier, ein Stück Felsen dort und der eine oder andere dornige Strauch – das wird dem Wachsen auf dem weiten Feld keinen Abbruch tun.
Mit seinem Gleichnis meint Jesus vielleicht verschiedene Menschen. Die einen nehmen das Wort Gottes so auf, die anderen so. Aber er kann auch jeweils ein und denselben Menschen in seinen unterschiedlichen Phasen meinen. Sind wir nicht manchmal mehr solche Wegemenschen, wo wir uns an unseren Gewohnheiten festhalten und für alles Neue verschlossen bleiben? Und haben wir nicht auch Zeiten der Begeisterung, wo wir meinen, nun hätte uns der Glaube an Christus gepackt, wo wir bereit sind, unser Leben umzustellen – und dann trägt die Kraft doch nicht so weit?!
Und werden manchmal die guten Ansätze in uns durch unsere Sorgen und unsere allzu menschlichen Bedürfnisse nicht doch wieder erstickt?
Wir können auch der gute Acker sein, wenn er auch oftmals mehr ein Bild der Hoffnung als Realität sein mag. Jesus erzählt dieses Gleichnis gewiss nicht, um bloß eine Feststellung zu treffen. Er will uns auch aufzeigen, in welch unterschiedlicher Weise das Wort Gottes aufgenommen werden kann. Indem er dies aufzeigt, geht er wohl davon aus, dass seine Hörer nun in sich gehen, sich prüfen und das ihnen Mögliche tun, sich selbst zuzubereiten zu einem guten Land, auf dem das Wort Gottes zur vollen Entfaltung kommen, das heißt, die ganze Person ergreifen kann.
Unglaubliche Geduld – letzter Versuch!?
2. März 1985
Reminiszere
(2. Sonntag in der Passionszeit)
Markus 12,1-12
Lassen Sie mich noch einmal mit eigenen Worten die Geschichte erzählen, die uns heute als Predigttext aufgegeben ist:
Der Besitzer eines Weinbergs will außer Landes gehen. Wir kennen seine Motive nicht. Jedenfalls muss er seinen heimischen Weinberg verlassen. Er will ihn aber nicht gänzlich aufgeben. Er will ihn nicht verkaufen. Er verpachtet den Weinberg.
Als die Zeit der Ernte gekommen ist, schickt er einen seiner Mitarbeiter zu den Pächtern, um seinen Anteil an den Früchten, den Pachtzins, holen zu lassen. Die Pächter, statt ihrer Verpflichtung nachzukommen, schlagen den Mitarbeiter und schicken ihn mit leeren Händen fort. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass der Besitzer des Weinbergs sie nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Der ist ja auch weit weg, im Ausland. Große Entfernungen waren damals nicht so leicht zu überwinden.
Der Besitzer des Weinbergs unternimmt einen zweiten Versuch. Er schickt noch einmal einen Mitarbeiter zu den Pächtern. Doch auch dem ergeht es nicht besser. Er muss Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Ja, ihm wird sogar der Kopf blutig geschlagen. Die Pächter legen eine ziemliche Dreistigkeit an den Tag. Als der Besitzer des Weinbergs noch einen anderen schickt, bringen sie ihn sogar um. Sie scheinen ganz und gar keinen Respekt vor dem Besitzer des Weinbergs zu haben. Weder respektieren sie dessen Anspruch auf Zahlung der Pacht, noch trauen sie ihm zu, dass er seine Ansprüche doch irgendwie durchsetzen könne. Auch vor einer Bestrafung scheinen sie keine Angst zu haben.
Der Besitzer des Weinbergs schickt noch weitere Mitarbeiter. Das muss verwundern. Hat er so viele Mitarbeiter, dass er deren Leben leichtfertig aufs Spiel setzen könnte? Er muss nach den Erfahrungen doch fest damit rechnen, dass auch sie ihren Auftrag nicht werden erfüllen können. Ja, mit jedem weiteren Mitarbeiter muss sich eigentlich die Selbstsicherheit der Pächter verstärken. Jeder weitere Mitarbeiter ist geradezu ein Beweis dafür, dass die Dreistigkeit unbestraft bleibt. Offenbar, so müssen die Pächter denken, fehlen dem Besitzer des Weinbergs die Mittel, die Zahlung der Pacht zu erzwingen.
Als neutraler Betrachter kann man dem Weinbergbesitzer eine große Geduld mit seinen Pächtern bescheinigen, eine sehr große Geduld, eigentlich eine zu große Geduld. Denn immerhin riskiert er jedes Mal das Leben eines seiner Mitarbeiter. Völlig verblüffend und kaum noch zu verstehen ist, dass er schließlich seinen eigenen Sohn, seinen geliebten Sohn zu den Pächtern schickt, gewissermaßen als letzten Versuch. Kaum zu begreifen ist dieser Versuch, weil der Vater nun das Leben seines Sohnes aufs Spiel setzt.
Das Vertrauen, das er in die Pächter setzt, dass sie wenigstens, wenn nicht seine Mitarbeiter, nun doch wenigstens seinen Sohn respektieren werden, erscheint nach den Erfahrungen kaum gerechtfertigt. Woher nimmt der Weinbergbesitzer dieses über alle Maßen große Vertrauen? Ist er durch den bisherigen Schaden immer noch nicht klug geworden? Ist er so blind, dass er die Wirklichkeit nicht wahrnimmt? Ist er naiv? Kennt er die Menschen immer noch nicht? Will er sie nicht kennen? Er hätte doch, bevor er das Leben seines eigenen Sohnes riskiert, längst einmal zum Gegenschlag ausholen müssen und den Pächtern mit einer gehörigen Strafmaßnahme vor Augen führen müssen, dass sie mit ihrer Dreistigkeit nicht ungeschoren davonkommen würden.
Dass der Weinbergbesitzer die Mittel hat, seine Pächter zur Rechenschaft zu ziehen, deutet Jesus an, als er fragt, was passieren werde, wenn auch der Sohn umgebracht wird. Dann wird der Besitzer des Weinbergs kommen und die Pächter ums Leben bringen und den Weinberg anderen geben.
Wenn der Besitzer des Weinbergs diese Mittel hat, warum setzt er sie nicht nach der Untat an seinem letzten Mitarbeiter ein? Warum bringt er noch das Leben seines eigenen Sohnes in Gefahr?
Nun, das ist kaum zu begreifen. Wir können nur Folgendes zur Kenntnis nehmen: Der Weinbergbesitzer verzichtet auf die Anwendung von Gewalt. Er gibt – fast möchte man sagen: unbegreiflicherweise – die Hoffnung nicht auf, dass die Pächter doch noch von sich aus zur Besinnung kommen werden. Er scheint darauf zu hoffen, dass sein immer neuer Vertrauensbeweis die Pächter schließlich bei ihrer Ehre packt und sie sich sagen: „Wer uns so viel Vertrauen schenkt, den dürfen wir auf Dauer nicht enttäuschen.“ Der Weinbergbesitzer ist um dieser seiner Hoffnung willen bereit, Risiken einzugehen, die bis in die Intimsphäre hineinreichen, bis in den Bereich der Liebe zu seinem Sohn.
Überdenken wir noch einmal das sonderbare Verhalten des Weinbergbesitzers. Versetzen wir uns einmal in die Lage der beiden Parteien. Wären wir der Besitzer des Weinbergs, wie hätten wir auf derart ungehörige Pächter reagiert? Vermutlich hätten wir andere Maßnahmen ergriffen als die hier aufgezeichneten. Wir hätten vermutlich nach der ersten Zahlungsverweigerung der Pächter, spätestens nach der zweiten oder allerspätestens nach der dritten zu Zwangsmaßnahmen gegriffen, um unsere Ansprüche durchzusetzen. „Wer nicht hören will, muss fühlen!“ Warum hätten wir mit solchen Pächtern auch zimperlich umgehen sollen?! Schließlich scheuten diese Menschen aus reiner Selbstsucht nicht einmal vor Mord zurück.
Versetzen wir uns nun einmal in die Lage der Pächter. Stellen wir uns vor, wir wären diese selbstsüchtigen, habgierigen, gewalttätigen Gesellen. Wir würden wohl zunächst bei jeder Unrechtstat mit einer energischen Gegenmaßnahme des Weinbergbesitzers rechnen. Allerdings nach dem, wie wir ihn kennengelernt hatten, bevor er seine Reise ins Ausland antrat, nämlich als eine menschliche und großzügige Person, würden wir es auch für möglich halten, dass er es erst einmal im Guten versuchen würde, dass er versuchen würde, mit uns zu verhandeln, uns gut zuzureden. Gerade weil uns dieser Charakterzug des Weinbergbesitzers bekannt ist, haben wir überhaupt den Mut, uns so dreist zu verhalten.
Nachdem nun die ersten Mitarbeiter gekommen sind, ohne ihren Auftrag erfüllen zu können und immer noch kein Gegenschlag erfolgt ist, fühlen wir uns in unserer Einschätzung des Weinbergbesitzers bestätigt und zur Fortsetzung unseres vertragswidrigen Verhaltens ermutigt.
Da nun immer weitere Mitarbeiter kommen und die harte Gegenmaßnahme ausbleibt, werden sich unter uns Pächtern langsam jedoch unterschiedliche Reaktionen entwickeln. Die einen werden in ihrer Bösartigkeit noch übermütiger werden. Den anderen von uns wird langsam mulmig zumute werden, weil das Verhalten des Weinbergbesitzers so ungewöhnlich und damit unberechenbar ist.
Als schließlich der Sohn vor der Tür steht – ohne Begleitschutz, beteiligen sich zwar noch alle an dessen Ermordung. Aber im Grunde ist einigen die Sache jetzt schon zu heiß geworden. Dass ihre Untaten permanent ungestraft bleiben und der Weinbergbesitzer auch noch seinen eigenen Sohn opfert, statt einen Trupp Soldaten zu schicken, weckt bei ihnen das schlechte Gewissen. Das erfüllt sie mit einer inneren Unruhe, bringt sie zum Grübeln über alles, was bisher geschehen ist. Vielleicht führt dieses intensive Nachdenken bei dem einen oder anderen dann auch zu der Einsicht, dass dieser Weinbergbesitzer ein schier unendliches Vertrauen zu ihnen gehabt hat – trotz ihrer fortgesetzten Bösartigkeiten. Durch die Einsicht in ein solch unglaubliches Vertrauen mag sich der eine oder andere dazu herausgefordert fühlen, sein bisheriges Verhalten zu bereuen und sein künftiges zu ändern.
Jesus erzählt diese Geschichte als Gleichnis. Mit dem Weinbergbesitzer meint er Gott, mit den Pächtern vor allem die Hohepriester und Schriftgelehrten. Diese fühlen sich auch angesprochen. Mit den Mitarbeitern des Weinbergbesitzers meint er die vielen Boten Gottes, Mose und all die Propheten. Mit dem Sohn meint sich Jesus selbst. Er will mit dieser Geschichte sagen: Gott ist lange geduldig gewesen mit einem ungehorsamen