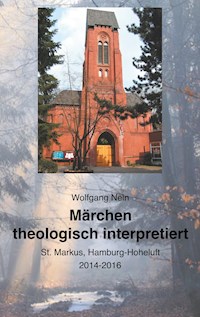Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der christliche Glaube ist geradezu unglaublich. Das Unglaubliche sind nicht so sehr die biblischen Berichte über die Auferstehung Jesu, auch nicht die Berichte über diverse Totenauferweckungen im Alten und Neuen Testament. Das Unglaubliche sind auch nicht vor allem die biblischen Darstellungen der Entstehung der Welt und Erschaffung des Menschen oder die vielen legendenhaften biblischen Wunderberichte - dass Jesus übers Wasser gegangen sei zum Beispiel. Das eigentlich geradezu Unglaubliche der christlichen Botschaft ist die überaus liebevolle Betrachtung des Menschen, und zwar des Menschen schlechthin. Beruht denn der christliche Glaube auf Illusionen bezüglich der Art des Menschen? Ganz gewiss nicht. Die christliche Botschaft lautet: "Wir sind geliebte Sünder." Wenn diese Botschaft allenthalben ernstgenommen und als Grundlage, Leitfaden und Ziel menschlichen Handelns genommen würde, dann würde es auf unserem Erdball sicherlich anders aussehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Moral, christliche Freiheit und Verantwortung
1. August 1976
7. Sonntag nach Trinitatis
1. Korinther 6,9-14.18-20
Kritik an anderen und Selbstkritik
29. August 1976
11. Sonntag nach Trinitatis
2. Samuel 12,1-10.13-15
Das Leichte und Schwere ist ungleich verteilt
12. September 1976
13. Sonntag nach Trinitatis
1. Mose 4,1-16a
Verkündigung
nicht von oben herab und von außen her
10. Oktober 1976
17. Sonntag nach Trinitatis
1. Korinther 9,16-23
Fixpunkt für ethische Ermahnungen: Jesus Christus
17. Oktober 1976
18. Sonntag nach Trinitatis
Kolosser 3,18-4,1
Mut zur Freiheit!
31. Oktober 1976
20. Sonntag nach Trinitatis
Reformationstag
Goldene Konfirmation
Galater 5,1-11
Die Kreuze auf den Gräbern mahnen uns alle
14. November 1976
Volkstrauertag
Gedenkfeiern für gefallene Soldaten
Matthäus 5,21-24
Schuldbekenntnis ist Ausdruck menschlicher Würde
17. November 1976
Buß- und Bettag
Jesaja 5,1-7
Die Geschichte ist kein Kreis, sondern eine Linie
28. November 1976
1. Advent
Jesaja 63,14-16;64,1-4
Tätige Buße:
Liebe zu Gott und den Menschen in Einklang bringen
12. Dezember 1976
3. Advent
Lukas 3,7-17
Mutmachende Begegnung mit dem ganz Anderen
24. Dezember 1976
Heiligabend
Lukas 2,4-7
Bescheiden, aber menschlich anspruchsvoll
24. Dezember 1976
Heiligabend
Lukas 2,7-14
Sich vom Vertrauen der Kinder anstecken lassen
24. Dezember 1976
Heiligabend
Lukas 2,10-14
Eine alte Sehnsucht erfüllt sich auf neue Weise
26. Dezember 1976
2. Weihnachtstag
Jesaja 11,1-5.10
Der breite und der schmale Weg
2. Januar 1977
Sonntag nach Neujahr
Matthäus 7,13-14
Fasten oder Feiern?
16. Januar 1977
2. Sonntag nach Epiphanias
Markus 2,18-22
Lepra ist heilbar – ein Auftrag für uns!
30. Januar 1977
Letzter Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 8,1-4
Wort und Tat gehören zusammen
13. Februar 1977
Sexagesimae
(2. Sonntag vor der Passionszeit)
Lukas 10,38-42
Glauben: Vertrauen darauf, dass Hilfe möglich ist
27. Februar 1977
Invokavit
(1. Sonntag in der Passionszeit)
Markus 9,14-29
Von Herzen füreinander da sein!?
13. März 1977
Okuli
(3. Sonntag in der Passionszeit)
Matthäus 20,20-28
Dem goldenen Kalb vertrauen?
27. März 1977
Judika
(5. Sonntag in der Passionszeit)
2. Mose 32,15-20
Wer liebt, leidet
3. April 1977
Palmsonntag
(6. Sonntag in der Passionszeit)
Emmauskirche
Johannes 17,1-8
Der Judas in uns?
6. April 1977
Passionsandacht
Matthäus 27,3-5
Von der Erfahrung des Todes zum Dienst am Leben
10. April 1977
Ostersonntag
Lukas 24,1-12
Auferstehung – Leben – nach dem Tode?
17. April 1977
Quasimodogeniti
(1. Sonntag nach Ostern)
Lukas 20,27-40
Wir leben nicht aus uns selbst heraus
1. Mai 1977
Jubilate
(3. Sonntag nach Ostern)
Lukas 10,17-20
Ermutigung zu Wahrhaftigkeit und Bescheidenheit
14. Mai 1977
Konfirmandenabendmahl
Lukas 22,19-20
Glauben erwerben im Vollzug des christlichen Lebens
15. Mai 1977
Rogate
(5. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
Markus 9,24
Die Suche im christlichen Glauben nicht aufgeben!
22. Mai 1977
Exaudi
(6. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
Matthäus 7,7-8
Über geistliche Unterschiede im Gespräch bleiben
29. Mai 1977
Pfingstsonntag
Matthäus 16,13-20
Mit liebevollem Nachdruck zur Einsicht motivieren
3. Juli 1977
4. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 18,15-20
Freiheit von und für Bindungen
10. Juli 1977
5. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 14,25-33
Heimkehr ist an Umkehr gebunden
17. Juli 1977
6. Sonntag nach Trinitatis
Jesaja 43,1-7
Das war meine Hand, nicht ich!?
24. Juli 1977
7. Sonntag nach Trinitatis
Markus 9,43-48
Suchen nach dem, was dem Leben dient
7. August 1977
9. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 13,44-46
Ganzer Einsatz mit Mut und Vertrauen
4. September 1977
13. Sonntag nach Trinitatis
Markus 12,41-44
Wie der Gruß aus einer anderen Welt!
11. September 1977
14. Sonntag nach Trinitatis
Spieka und Cappeln
1. Samuel 2,1-10
Sind wir überhaupt zum Tun des Guten fähig?
18. September 1977
15. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 19,16-26
Danken – als wäre das Leben eine persönliche Gabe
2. Oktober 1977
17. Sonntag nach Trinitatis
Erntedankfest
Psalm 145,16
Die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen
23. Oktober 1977
20. Sonntag nach Trinitatis
Johannes 6,37-40.44
Freiheit vom Zwang und für die Verantwortung
6. November 1977
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Zum Reformationstag
Johannes 8,31-36
Unsere Fragen reichen ins Unbeantwortbare hinein
20. November 1977
Totensonntag / Ewigkeitssonntag
Letzter Sonntag des Kirchenjahres
(Aufstellungspredigt)
Jesaja 51,9-16
Einander helfen, Glaubenshindernisse zu überwinden
4. Dezember 1977
2. Advent
2. Thessalonicher 3,1-5
Warmes Licht für unsere Welt, den armseligen Stall
25. Dezember 1977
1. Weihnachtstag
1. Johannes 3,1-6
Was wir erlebt haben und wie wir uns dazu stellen
31. Dezember 1977
Altjahrsabend
Jesaja 51,1-6
Bibelstellen
Vorwort
Der christliche Glaube ist geradezu unglaublich. Das Unglaubliche sind nicht so sehr die biblischen Berichte über die Auferstehung Jesu, über die Totenauferweckungen der Tochter des Jairus, des Jünglings zu Nain und des Lazarus durch Jesus sowie des Sohnes der Witwe von Sarepta durch Elias und der Tochter der Sunnamitin durch Elisa. Das Unglaubliche sind auch nicht vor allem die biblischen Darstellungen der Entstehung der Welt und Erschaffung des Menschen. Das besonders Unglaubliche sind auch nicht die vielen legendenhaften biblischen Wunderberichte – dass Jesus übers Wasser gegangen sei zum Beispiel.
Das eigentlich geradezu Unglaubliche der christlichen Botschaft ist die überaus liebevolle Betrachtung des Menschen, und zwar des Menschen schlechthin. Wenn wir uns die täglichen Nachrichten anschauen, wenn wir unsere Erfahrungen mit den Mitmenschen bedenken, wenn wir in uns selbst hineinschauen und wenn wir den ganzen Verlauf der menschlichen Geschichte betrachten – und wenn wir dann noch bedenken, wie es Jesus Christus in den wenigen Jahrzehnten seines Lebens ergangen ist, dann muss das liebevolle christliche Menschenbild doch geradezu unglaublich erscheinen.
Beruht denn der christliche Glaube auf Illusionen bezüglich der Art des Menschen? Ganz gewiss nicht. Im Alten Testament lesen wir, „dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar“. Es folgte die Sintflut. Anschließend war der Mensch nicht besser. Selbst herausragende Persönlichkeiten wie Abraham, David und Jakob zum Beispiel schildern die biblischen Texte mit ihren großen menschlichen Schwächen und zum Teil kriminellen Handlungen. Der Mensch wurde auch nicht besser durch die zehn Gebote, auch nicht durch die Mahnungen der Propheten.
Jesus wurde in vielfacher Weise angefeindet und verfolgt. Bei seinen eigenen Freunden stieß er nicht nur immer wieder auf Unverständnis, er wurde von ihnen auch verleugnet, verraten und im Stich gelassen. Und am Ende wurde er von den herrschenden Kräften der Gesellschaft gefangengenommen, misshandelt, zu Unrecht zum Tode verurteilt und durch Kreuzigung hingerichtet, obwohl er doch so viel Gutes gesagt und getan hatte.
Von Illusionen bezüglich des menschlichen Wesens kann weder im Alten noch im Neuen Testament die Rede sein.
Wie sind nach illusionsloser Betrachtung des Menschen die biblischen Berichte über Worte Jesu zu verstehen – wie zum Beispiel sein Satz vom Kreuz herab: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“? Oder seine Antwort auf die Frage, wie oft wir vergeben sollen: „Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal“, was so viel bedeutet wie „endlos oft“.
Hat Jesus das vielleicht in Wirklichkeit gar nicht gesagt? War seine Einstellung gegenüber den Menschen in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so menschenfreundlich?
Mit dieser Frage mag sich die theologische Forschung beschäftigen. Fakt ist, dass die biblischen Texte dieses illusionslose liebevolle Menschenbild als zentralen Inhalt des Wirkens Jesu überliefern und es über die 2000 Jahre bis auf den heutigen Tag als ein zentraler Inhalt des christlichen Glaubens wirksam ist.
Die christliche Botschaft lautet: „Wir sind geliebte Sünder.“ Wenn diese geradezu unglaubliche Botschaft allenthalben ernstgenommen und als Grundlage, Leitfaden und Ziel menschlichen Handelns genommen würde, dann würde es auf unserem Erdball sicherlich anders aussehen.
Ist diese Botschaft nun zu glauben oder nicht? Sie ist es wert, geglaubt – und das heißt ernstgenommen und als verbindlich angenommen – zu werden. Sie entspricht dem, was wir uns für uns selbst wünschen. Und was wir für uns selbst wünschen, möge allen Menschen zuteilwerden! Diese Botschaft zu vermitteln, ist ein wesentliches Anliegen dieser Predigtreihe.
Viel Freude beim Lesen!
Wolfgang Nein, Mai 2019
Moral, christliche Freiheit und Verantwortung
1. August 1976
7. Sonntag nach Trinitatis
1. Korinther 6,9-14.18-20
Es ist manchmal ein sonderbares Gefühl, wenn wir aus dem Urlaub zurückkehren in die gewohnte Umgebung. Es kann passieren, dass uns manches gar nicht mehr so vertraut erscheint. Für einen Augenblick vielleicht nur, aber immerhin, kann uns ein Gefühl des Befremdens erfassen. Das geht meist schnell vorüber, und wir fühlen uns wieder ganz zu Hause. Aber dieser eine Augenblick des Befremdens birgt doch allerhand Möglichkeiten in sich. Wenn wir den richtig nutzen, dann können wir vielleicht die uns vertraute Umgebung, in der wir bisher wie selbstverständlich gelebt haben, die wir sozusagen immer nur von innen heraus gekannt haben, auch einmal von außen betrachten mit ein wenig Abstand, so, wie sie sonst nur Fremde sehen. Das ist dann vielleicht ein etwas kritischer Einblick. Manchmal kann uns das zu neuen Erkenntnissen über uns selbst und unsere Umgebung führen.
Wenn zum Beispiel diejenigen von uns, die mit beiden Beinen in der Kirche stehen, die Sonntag für Sonntag den Gottesdienst besuchen, die regelmäßig biblische Texte hören und lesen, beten und singen und sich regelmäßig mit theologischer Literatur befassen, wenn diejenigen von uns einmal für einige Wochen Urlaub von der Kirche machen, dann kann es sein, dass dieses ganze Kirchliche und Christliche uns bei der ersten Wiederbegegnung etwas fremdartig erscheint.
Dann bekommen wir vielleicht für einen Augenblick eine Ahnung davon, was Leute, die mit Kirche nichts im Sinn haben, empfinden, wenn sie mit Kirche und christlichem Glauben einmal in Berührung kommen.
Diese Perspektive von draußen, wenn wir die konservieren könnten, wäre das, meine ich, für uns durchaus ein Gewinn. Dann hätten wir in uns selbst sozusagen immer eine Kontrollinstanz uns selbst gegenüber, unser eigenen Kirchlichkeit, unserem Christsein gegenüber. Das wäre insofern ein Gewinn, als wir uns dann umso besser auf all diejenigen einstellen könnten, die der Kirche und dem christlichen Glauben fernstehen, und das ist eben doch die Mehrzahl unserer Mitmenschen. Die innere Distanz zu uns selbst, dieser selbstkritische Blick, wäre eine gute Voraussetzung für das Gespräch mit den anderen.
Warum diese lange Einleitung? Der heutige Predigttext im 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 6. Kapitel fordert dazu heraus. Denn über diesen Text werden Außenstehende vielleicht entsetzt den Kopf schütteln oder sich gehörig ärgern oder, und das wäre wohl noch schlimmer, mitleidig verständnisvoll sagen: „Ja, so ist das Christentum!“
Worum geht es in diesem Text? Paulus warnt die Gemeinde in Korinth davor, sich rechtlicher und moralischer Vergehen schuldig zu machen. Insbesondere warnt er vor, wie er es nennt, der Unzucht. Gerade diese Bemerkung wird viele, vielleicht auch manchen unter uns, zum Zorn reizen.
Die, wenn ich so sagen darf, schlimmste Reaktion auf diesen Text wäre wohl die etwas mitleidig verständnisvolle, in dem Sinne etwa, dass einer sagt: Ja, so ist das Christentum: Es soll uns Sitte und Anstand lehren, lehren, was gut und böse ist, was wir tun und was wir nicht tun dürfen.
Aber das ist ganz und gar nicht das Wesen des christlichen Glaubens. Christlicher Glaube ist keine Morallehre. Ganz im Gegenteil, er ist eine Befreiung von den Zwängen der Moral. Jesus Christus ist gerade gekommen, um uns von der Zwangsvorstellung zu befreien, wir müssten die ganze Seligkeit unseres Lebens darin suchen, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen.
Schuldig werden wir immer wieder, jeden Tag neu und vielfältig. Jesus Christus ist nicht gekommen, uns mit drohend erhobenem Zeigefinger zu Sitte und Anstand zu ermahnen. Er hätte uns damit zugrunde gerichtet. Nein, er wollte uns gerade dazu verhelfen, unsere unauslöschliche Schuldhaftigkeit einzugestehen.
Er verhilft uns dazu, indem er die Vergebung Gottes anbietet. Christlicher Glaube ist also nicht schon da verwirklicht, wo einer nach moralischen Grundsätzen lebt. Christlicher Glaube, das ist Eingeständnis der Schuld und Leben aus der Vergebung.
„Nicht um der Gerechten willen, sondern um der Sünder willen“ ist Jesus Christus gekommen. Weil wir das wissen, klingt es auch zunächst für uns etwas schockierend, wenn Paulus sagt: „Wer Unrecht tut, wird Gottes Reich nicht erben.“ Denn wir tun ja Unrecht! Und wir werden es trotz aller Anstrengungen auch morgen noch tun. Und manch einer von uns wird sich zu der einen oder anderen Gruppe von Sündern zählen können, die Paulus hier aufführt: zu den Unzüchtigen, Götzendienern, Ehebrechern, Lüstlingen, Knabenschändern, Dieben, Wucherern, Trunkenbolden, Lästerern und Räubern.
Auch die Christen in der Gemeinde von Korinth waren in der einen oder anderen Weise schuldig geworden. Paulus sagt: „Aber das ist von euch abgewaschen. Ihr seid heilig, ihr seid gerecht geworden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes.“
„Ihr seid heilig, ihr seid gerecht geworden“ – soll das nun heißen: Seit diese Korinther Christen geworden sind, seit der Taufe also, führen sie ein moralisch einwandfreies Leben, sind sie gegen alle Anfechtungen gefeit? Nein, „ihr seid heilig, ihr seid gerecht geworden“, heißt nicht: Ihr habt es nun geschafft, ein makelloses Leben zu führen. Es bedeutet vielmehr: „Alle eure Vergehen werden euch nicht zugerechnet. Sie sind euch bereits im voraus vergeben, weil Gott euch die Tür zum unbeschwerten, fröhlichen Leben immer offenhalten möchte.“
Wenn wir mit Paulus so weit einig sind, bleibt noch der schwerste Brocken, die Sache mit der, wie Paulus sagt, Unzucht. Es mag ja für jeden leicht einzusehen sein, dass ein Dieb oder ein Buchhalter oder ein Räuber sich eines echten strafwürdigen Vergehens schuldig gemacht hat. Aber im Bereich des Sexuellen sind wir heute nicht mehr so leicht bereit, von Vergehen zu sprechen. Ein so abwertender Begriff wie Unzucht passt nicht mehr zu den positiven und freizügigen Einstellungen zur Sexualität, an die wir uns inzwischen schon gewöhnt haben.
Sollen wir diese Abschnitte im Korintherbrief also einfach als veraltet und überholt streichen? Nun, zunächst müssen wir uns näher ansehen, was Paulus geschrieben und gemeint hat. Es geht ihm im Wesentlichen um einen Gedanken – er ist in diesem Satz zusammengefasst: „Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Gott hat ihn euch gegeben. Ihr gehört nicht euch selbst.“
„Ihr gehört nicht euch selbst“, vielleicht ist Ihnen bei diesem Satz schon das Schlagwort eingefallen, dass im Rahmen der Diskussion um den § 218 umgegangen ist: „Mein Bauch gehört mir!“ In diesem Schlagwort äußert sich eine Einstellung, die der des Paulus genau entgegengesetzt ist.
Also: Ist unser Körper nun unser Eigentum, mit dem wir nach Belieben verfahren können, oder ist er es nicht? Die Antwort auf diese Frage lässt sich nicht allgemein verbindlich, in einem wissenschaftlich objektiven Sinne etwa, geben. Sie hängt von meiner persönlichen Einstellung ab, von meinem Glauben.
Als Christen verstehen wir uns, mit unserem Körper, mit unserem ganzen Dasein so, wie es Paulus hier formuliert hat, als Geschöpfe Gottes, in denen Gott selbst gegenwärtig ist. Wir sind durch Gott geschaffen und Gott wohnt in uns. Das führt uns zu einem ungeheuren Respekt vor uns selbst und vor jedem anderen Menschen. Unserem Körper gegenüber gebrauchen wir nicht die völlig ungebundene, gänzlich willkürliche Freiheit unseres eigenen Gutdünkens, sondern wir behandeln unseren Körper und den jedes anderen Menschen als etwas Heiliges, nämlich Gott Zugehöriges, das uns zum größtem Respekt verpflichtet.
Selbst wenn wir uns in diesem Punkt mit Paulus einig wissen, bleibt die Frage, warum Paulus das Sexuelle so negativ beurteilt. Warum lässt es sich mit der Heiligkeit unseres Körpers seiner Meinung nach nicht vereinbaren? Paulus sagt an der einen Stelle: „Unser Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn.“ Er sieht also die Gefahr, dass derjenige der sich seinen sexuellen Trieben überlässt, nicht gleichzeitig auch ganz für Christus da sein kann. Beide üben eine Herrschaft aus, und nur einem können wir dienen. Die meisten von uns werden aus eigener Erfahrung die Macht des Sexuellen kennen. Aber wiederum die Frage: Inwiefern steht sie im Gegensatz zu Jesus Christus? Nun, insofern als sie unseren zwischenmenschlichen Beziehungen Schaden zufügen kann und zufügt. Wir brauchen nur an den Ehebruch zu denken, um uns vorstellen zu können, welches seelische Leid diese Macht auslösen kann.
Sie kann da eine zerstörerische Kraft haben, wo sie rücksichtslos auf die eigene Befriedigung ausgerichtet ist. Paulus hat in der Macht des Sexuellen eine Gefahr für die menschliche Gemeinschaft gesehen. Wenn sich Menschen ihr überlassen, werden sie leiden und Leid verursachen. Er sagt deshalb an anderer Stelle: „Um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine Ehefrau und jede Frau ihren Ehemann haben.“
Freilich, auch innerhalb der Ehe können die Partner einander in sexuellen Dingen viel Leid zufügen. Die Ehe ist nicht von sich aus schon eine Garantie für eine heile menschliche Gemeinschaft. Sie wird es erst da, wo sie als Aufgabe ernst genommen wird, als Aufgabe, das Glück beider Partner zu suchen, im Miteinander und Füreinander, in Zuwendung und gegenseitige Rücksichtsname.
Wir mögen den Eindruck haben, dass Paulus in mancher Hinsicht das Sexuelle zu negativ beurteilt, negativer, als wir es heute tun würden. Wir sehen zwar auch die vielen Gefahren, die mit ihr verbunden sind, aber wir sehen doch auch die positiven Möglichkeiten, die Möglichkeit der Ehepartner etwa, sich gegenseitig höchstes Lebensglück zu bescheren. Davon lesen wir bei Paulus nichts.
Aber dennoch hat Paulus auch uns Wichtiges zu sagen, nämlich das, was wir als seine Leitgedanken erkannt haben: Wir gehören nicht uns selbst, sondern Gott. Wir können Paulus deshalb wohl auch zustimmen, wenn er einer Gruppe der Korinther polemisch zuruft: „Alles ist erlaubt! Jawohl! Aber nicht alles führt zum Guten.“
Wir sind heute an viele Freiheiten gewöhnt und wollen uns auch im Bereich des Sexuellen alle Freiheiten nehmen. Diese Freiheiten können wir aber nur unter der Gefahr, anderen zu schaden, voll verwirklichen. Deshalb ruft Paulus uns dazu auf, uns der Herrschaft Jesu Christi zu unterstellen und unsere Freiheit nicht willkürlich nach eigenem Gutdünken und zur alleinigen Befriedigung eigener Triebe, sondern zur Verwirklichung des gemeinsamen Glücks zu nutzen.
Paulus schließt seine Ermahnung mit den Worten: „Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat ihn euch gegeben. Ihr gehört nicht euch selbst. Denn wie Sklaven seid ihr gekauft für einen hohen Preis. Dafür preist nun Gott mit eurem Leibe.“
Kritik an anderen und Selbstkritik
29. August 1976
11. Sonntag nach Trinitatis
2. Samuel 12,1-10.13-15
Tonbandgeräte und Kassettenrekorder sind heute kein Luxus mehr. Das war nicht immer so. Ich kann mich jedenfalls noch daran erinnern, dass es damals etwas Besonderes war, als unser Lehrer ein Tonbandgerät mit in den Unterricht brachte und wir einmal selbst etwas auf Band sprechen durften. Es ist mir noch gut in Erinnerung, dass das für uns ein seltsames Gefühl war, die eigene Stimme vom Band zu hören. Die war ja kaum wiederzuerkennen. „Das soll ich sein?“, dachte ich damals. Die Stimme klang ja so, als ob das jemand anderes wäre. Ein seltsames Gefühl. Und ich muss sagen, auch ein bisschen ein enttäuschendes. Unter meiner eigenen Stimme hatte ich mir etwas ganz anderes vorgestellt. Eine ähnliche Erfahrung werden Sie vielleicht auch schon gemacht haben.
Wir wollen uns jetzt einmal noch etwas anderes vorstellen, und zwar einen Film über Herrn X oder Frau Y, einen Film, der den Tagesablauf dieser Person von, sagen wir, morgens um sieben bis abends um elf aufs Genaueste festgehalten hat, der vielleicht zeigt, wie Herr X das etwas zu hart geratene Frühstücksei bemängelt, wie er seine Verspätung im Büro mit einem erdachten Verkehrsstau morgens zu entschuldigen sucht, wie er die Kaffeepause über Gebühr verlängert und die Geduld der draußen Wartenden strapaziert, wie er sich noch ein bisschen Briefpapier aus dem Büro für private Zwecke heimlich in die Tasche steckt und wie er am Abend seine Frau mit bösem Blick für das etwas versalzene Spiegelei straft.
Stellen wir uns also vor, wir sähen diesen Film, vielleicht würden wir denken: Ein feiner Kerl, der könnte sich ruhig etwas anständiger benehmen! Bis wir dann die letzte Szene des Films sehen, in der Herr X die Maske vom Gesicht nimmt und wir erkennen müssen: Herr X, das sind ja wir selbst.
Es ist schon ein Unterschied, ob wir nur so dahinleben oder ob wir uns selbst einmal wie einen Fremden betrachten können. Das Letzte kann eine heilsame, vielleicht auch erschütternde Erfahrung sein. Wir nehmen uns selbst ja gern sehr ernst, übersehen auch gern unsere Schwächen und haben notfalls passende Entschuldigungen zur Hand. Wenn wir uns dagegen, ohne es zu wissen, mit den Augen des anderen betrachten, sind wir vielleicht weniger geneigt, diese Person da ernst zu nehmen. Statt uns vor Hochachtung zu verneigen, ringen wir uns vielleicht nur ein müdes Lächeln ab.
Der ehrwürdige König David hat auf peinliche Weise eben diese Erfahrung machen müssen. Der weise Mann Nathan kam zu ihm. Er erzählte das Gleichnis, das wir aus dem zweiten Samuelbuch im zwölften Kapitel gehört haben.
Noch einmal kurz gesagt: Ein armer und ein reicher Mann. der Arme besitzt nur ein einziges Schaf, der Reiche hat viele Schafe und Rinder. Als der Reiche jemand zu Gast hat, ist er zu geizig, eins von seinen eigenen Tieren zu schlachten. Er nimmt dem Armen das einzige Schaf, das dieser besitzt, um es seinem Gast als Speise vorzusetzen. David ist über dieses ungehörige Verhalten entrüstet. „Der Mann hat die Todesstrafe verdient“, sagt er empört. „Außerdem soll er das Schaf vierfach bezahlen.“ David hat noch gar nicht gemerkt, dass er damit das Urteil über sich selbst gesprochen hat. „Du bist der Mann“, sagt Nathan zu David.
Dem David muss ein ungeheurer Schrecken in die Glieder gefahren sein. Nathan hält ihm vor, was er kürzlich selbst an Unrecht begangen hat. Sie kennen die Geschichte: David hatte vom Dach seines Hauses aus die schöne Batseba beim Baden beobachtet. Und obwohl er schon zahlreiche Ehefrauen hatte, wollte er die Batseba noch dazu, die mit Urija, einem Soldaten, verheiratet war. Er lud sie heimlich zu sich ein. Als feststand, dass sie von David ein Kind bekommen würde, sorgte David dafür, dass Urija in den Krieg geschickt wurde, an die Stelle, wo der Kampf am gefährlichsten war. Dort ist Urija dann auch gefallen. Auf diese hinterhältige Weise hatte David den Urija beiseitegeschafft und konnte nun die schöne Batseba nach einer Anstandsfrist für die Trauer in die große Zahl seiner Frauen einreihen.
Erst als Nathan David dieses Unrecht so unverblümt vorhält, erkennt dieser sich in dem reichen Mann aus dem Gleichnis wieder. „Ich habe mich an dem Herrn versündigt“, sagt er. Er gibt sein Unrecht zu. Er versucht nicht, sich zu entschuldigen. Er hätte ja sagen können: „Die Batseba hat mich provoziert mit ihrem Baden.“ Er hätte den Tod des Urija als tragischen Zufall hinstellen können. Er hätte auch dem Nathan einfach den Mund verbieten können. „Was gehen dich meine Privatangelegenheiten an“, hätte er dem Nathan sagen können. Aber nichts dergleichen. David gesteht schlichtweg seine Schuld ein.
Nathan spricht ihm daraufhin die Vergebung Gottes zu: „Dann hat dir auch der Herr deine Sünde vergeben. Du brauchst nicht zu sterben.“ Sterben soll freilich der Sohn, den Batseba zur Welt bringt, weil, wie Nathan sagt, durch das Unrecht Davids der Name Gottes zum Gespött geworden ist.
Auch David ist, wie diese Geschichte zeigt, ein Opfer jener seltsamen Gespaltenheit geworden. Für das, was er selbst getan hat, verurteilt er einen anderen aufs Schärfste. Er weiß durchaus, was Recht und Unrecht ist, aber dieses Wissen reicht gerade aus, über andere zu urteilen. Ihm fehlt die Kraft, das eigene Handeln zu bestimmen.
Der Apostel Paulus hat diese Zwiespältigkeit zwischen unserem Wissen und Wollen einerseits und unserem Tun andererseits einmal so formuliert: „Wir bringen es zwar fertig, das Rechte zu wollen, aber wir sind zu schwach, es auch auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir gerne tun möchten, sondern das Schlechte, das wir verabscheuen.“
Dass David das Rechte tun möchte, davon dürfen wir ausgehen. Er ist ja nicht nur über das Unrecht des reichen Mannes im Gleichnis entrüstet, sondern bekennt auch seine eigene Verfehlung, als Nathan sie ihm auf den Kopf zusagt. David macht sich und Nathan nichts vor. Er ist nicht scheinheilig wie der Pharisäer, von dem wir vorhin im Gleichnis gehört haben: der in den Tempel geht und betet: „Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Einbrecher. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.“ Dieser Pharisäer ist scheinheilig. Er kann gar nicht frei von Verfehlungen sein. Er ist sich selbst gegenüber parteiisch, sieht nur die eine Seite. Für seine Schwächen haben ihm Eitelkeit und Überheblichkeit den Blick verstellt.
Wie viel sympathischer erscheint dagegen David. Er hat großes Unrecht getan, ja! Aber er gesteht es auch ein. Er lässt sich auf seine Verfehlung ansprechen. Er weist die Beschuldigung Nathans nicht hochmütig von sich, sondern demütig bekennt er seine Schuld.
Es haben sich viele Menschen gefragt, warum diese Geschichte von David und Batseba in der Bibel überliefert ist. Sie wirft doch eigentlich kein sehr schmeichelhaftes Licht auf diesen König, der ansonsten als Vorbild an Frömmigkeit gilt.
In der Tat, diese Offenheit der biblischen Erzählung ist geradezu verblüffend. Aber wir spüren doch auch dieses: Trotz der allzu weltlichen Verfehlung will uns David nicht als gottlos erscheinen.
Was ist denn ein freier Mensch? Nicht einer, der seine Hände in Unschuld waschen kann, einer, der keiner Versuchung erlegen ist, der über alle Zweifel und Anfechtungen erhaben ist. Das ist nicht der fromme Mensch. Solche Engel gibt es ja auf Erden gar nicht. Ein frommer Mensch, das ist durchaus ein, wie die Bibel sagt, ein Sünder, aber einer, der sich als solchen erkennt und um Vergebung bittet – so wie der Zöllner aus dem Evangelium von vorhin, der ebenfalls zum Tempel hinaufgeht, um dort zu beten. Er wollte seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: „Gott sei mir Sünder gnädig.“
Das ist ein freier Mann. Er hatte sicherlich keine reine Weste. Aber er vermochte es, die Augen niederzuschlagen. Und nur einem Menschen wie dem Zöllner und eben auch wie David kann Jesus Christus etwas bedeuten. Er ist ja nicht gekommen, uns einen Weg ohne Hindernisse zu zeigen, einen Weg, auf den wir gehen können, ohne zu straucheln. Nein, er ist gekommen, den beschwerlichen Weg mit uns zu gehen, uns über die Hindernisse hinwegzuhelfen und uns dort aufzuhelfen, wo wir gestrauchelt sind.
Mit anderen Worten: Er ist nicht gekommen, uns eine Morallehre zu predigen, uns zu Menschen ohne Fehler zu machen. Sondern mit unserer Schuldhaftigkeit richtig umgehen zu können, dazu hat er uns verholfen. „Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben“, heißt es. Das soll für uns eine Ermutigung sein, uns zu unserer Schuld zu bekennen. Sie wird uns nicht zum Schaden angerechnet. Wir dürfen offen sein und bescheiden. Wir können uns getrost mit den kritischen Augen betrachten, mit denen wir auf andere blicken.
Jesus Christus ermutigt uns zur Selbstkritik, freilich zur wohlwollenden Selbstkritik. Unsere Schuldhaftigkeit ist aufgedeckt, aber nicht, um uns zerstören zu können, um uns mit der Anklage zugrunde zu richten. Wir sollen uns im Angesicht unserer selbst wohl erschrecken, aber wir sollen uns nicht zu Tode erschrecken. Der heilsame Schreck soll uns helfen, unsere innere Gespaltenheit zu erkennen und uns mit uns selbst ins Reine bringen zu lassen durch ein Wort der Versöhnung. David kann in dieser Weise ein Vorbild für uns sein. In all unserer Schuld dürfen wir getrost auf die Güte Gottes vertrauen, wie wir eben gesungen haben:
„Darum auf Gott will hoffen ich,
auf mein Verdienst nicht bauen;
auf ihn mein Herz soll lassen sich
und seiner Güte trauen,
die mir zusagt sein wertes Wort;
das ist mein Trost und treuer Hort,
des will ich allzeit harren.“
Das Leichte und Schwere ist ungleich verteilt
12. September 1976
13. Sonntag nach Trinitatis
1. Mose 4,1-16a
An uns ergeht gelegentlich die Aufforderung: „Lies in der Bibel, dann wirst du etwas über den christlichen Glauben erfahren und in diesem Glauben wachsen.“ Diese Aufforderung mag durchaus sinnvoll sein. Es ist allerdings auch wahr, dass das Lesen von Bibeltexten nicht selten mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Das Bibellesen kann so zu einer schwierigen Aufgabe werden.
Wer häufig in diesem Buch liest, wird sich allerdings wahrscheinlich ein gewisses Vorverständnis angeeignet haben, sodass alles, was da geschrieben steht, im Rahmen des Vorverständnisses irgendwie sinnvoll und hilfreich erscheint. Gerade die ganz bekannten Bibelgeschichten haben für uns ihre feste Aussage, denken wir etwa an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wenn wir die hören, fühlen wir uns kaum genötigt zuzuhören, weil wir meinen, genau zu wissen, was sie uns sagen will.
Heute ist uns nun als Predigttext die Geschichte von Kain und Abel aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, aufgetragen. Auch sie ist uns zur Genüge bekannt. Und dennoch: Wenn wir sie einmal in Ruhe bedenken, wirft sie eine Reihe von Fragen auf, deren Antwort offenbleibt.
Es geht hier offenbar um den guten und den bösen Menschen, den Gott wohlgefälligen und den von Gott nicht angenommen. Es geht um Neid und Todschlag und um vorgetäuschte Selbstgerechtigkeit. Aber sehen wir einmal genauer hin. Da steht: „Die beiden Brüder brachten Gott ein Opfer – Kain von den Früchten des Feldes und Abel von den Erstlingen seiner Herde. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an.“
Warum diese unterschiedliche Behandlung? Warum findet Abel das Wohlgefallen Gottes, und warum wird Kain von Gott so ungnädig behandelt? Hatte Kain schon vorher Böses getan, und hatte Abel stets gottwohlgefällig gelebt? Nichts davon steht im Text.
Wir kennen die Vorgeschichte der beiden Brüder nicht. Kein Hinweis erklärt die unterschiedliche Behandlung des Opfers. Oder sollte Gott gar aus reiner Willkür sich den einen erwählt und den anderen von sich gestoßen haben? Dann wäre er doch ein ungerechter Gott. Dann wäre er doch letztlich verantwortlich zu machen für das weitere Unglück, das eine solche ungerechte Behandlung nach sich ziehen musste.
Die unterschiedliche Stellung Gottes zu den Opfern der beiden Brüder ist doch der Anlass für den tödlichen Bruderzwist. Können wir mit dieser Geschichte überhaupt etwas anfangen, wenn wir über die Ausgangslage nicht Bescheid wissen? Sollen wir uns etwa nur mit den Folgen auseinandersetzen? Sollen wir aus den Folgen Rückschlüsse auf den Beginn ziehen – in der Weise, dass wir sagen: Wenn Kain sich dazu hinreißen ließ, seinen Bruder umzubringen, dann wird er Gott auch vorher schon Anlass gegeben haben, mit ihm unzufrieden zu sein.
Beim Nachdenken über diese Fragen ist mir deutlich geworden, dass wir uns in unserem Leben in einer ähnlichen Ausgangslage befinden wie diese beiden Brüder. Auch wir werden doch von Gott, unserem Schöpfer, recht unterschiedlich behandelt. Die einen kommen gesund zur Welt, die anderen krank, die einen sind schön, die anderen weniger schön. Einigen fällt das Lernen leicht, andere müssen sich um jedes bisschen Wissen redlich bemühen. Manche werden als Kinder wohlhabender Eltern geboren, andere können schon bei ihrer Geburt nicht ernährt werden. Manche Kinder wachsen in der Liebe ihrer Eltern auf, andere müssen schon früh spüren, dass sie unerwünscht sind. Die Ausgangslage ist bei allen Menschen verschieden.
Wenn wir Vergleiche anstellten, müssten wir doch zu dem Schluss kommen, dass es dem einen erheblich besser geht als dem anderen. Warum diese Unterschiede? Warum hat unser Schöpfer die einen so offenbar bevorzugt und die anderen benachteiligt? Gerade diese Unterschiede sind doch der beständige Anlass für die Zwistigkeiten unter den Menschen. Ist nicht Gott letztlich für den Unfrieden verantwortlich, weil seine Schöpfung von vornherein ungerecht ist?
Diese Fragen drängen sich uns auf. Wir müssen sie stellen. Aber sie haben etwas Unheimliches an sich. Wir spüren: Hier geht es um Grundfragen unseres Lebens, und wir haben keine Antwort darauf. Wir sehen die Unterschiede, und wir können sie vielleicht aus der Entstehung und Entwicklungsgeschichte der Menschen erklären. Aber wenn wir an einen Gott glauben, der uns geschaffen hat, dann finden wir keine Erklärung für die Unterschiede. Wir werden keine Antwort auf diese Frage finden. Wir können sie nun aber auch nicht gleichgültig beiseiteschieben. Denn für unser Leben hängt viel davon ab, wie wir uns zu der Verschiedenheit der Menschen stellen.
Als Kain sah, dass Abel von Gott offenbar bevorzugt wurde, „ergrimmte er sehr und senkte finster seinen Blick“, heißt es hier in der Geschichte. Kains Opfer wurde von Gott nicht angenommen. Er fühlte sich zurückgesetzt, von seinem Bruder getrennt. Neid kam in ihm auf und bitterer Hass. Eine menschliche, allzu menschliche Reaktion. Sie ist verständlich, aber sie kann nicht unser Einverständnis finden. Sie führt in unserer Geschichte zur Gewalttat, zum Tod des Bruders. In der Tat, Leben und Tod hängen davon ab, wie wir uns zu uns selbst und zur Andersartigkeit unsrer Mitmenschen stellen.
„Warum ergrimmst du, warum senkst du den Blick? Wenn du fromm bist, kannst du den Blick erheben. Bist du nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen.“
„Warum ergrimmst du?“ Diese Frage klingt fast sarkastisch. Denn es ist doch klar, warum Kain ergrimmt. Und menschlich verständlich ist es auch, wenn auch nicht zu billigen. Diese Frage kann gar nicht so gemeint sein, wie sie gestellt ist. Der Grund für den Zorn Kains ist ja erkennbar. Aber die Frage will ja auch gar keine Antwort. Sie erteilt bereits den Tadel: Dein Zorn ist ungut. Er wird zu einem bösen Ende führen. Die Sünde lauert vor der Tür und hat nach dir Verlangen.
„Wenn du fromm bist, dann kannst du den Blick frei erheben.“ Was heißt das: „fromm“? An diesem Wort misst Gott das Verhalten Kains. Was es bedeutet, darüber erfahren wir direkt nichts. Nur von der Folge hören wir: „Du kannst deinen Blick frei erheben, wenn du fromm bist“, d. h. du wirst dich nicht vom Zorn erfassen lassen.
Ja, wie hätte Kain sich denn sonst noch zu der Bevorzugung Abels durch Gott stellen können? Hätte er seine Verärgerung einfach hinunterschlucken sollen? Hätte er versuchen sollen, die Abweisung seines Opfers einfach zu ignorieren? Das kann doch nicht gemeint sein. Das wäre nur ein Ausweichen vor dem Problem gewesen.
„Dann kannst du deinen Blick frei erheben“ – das deutet doch wohl auf eine wahrhaftige Bewältigung dieses Problems hin. Wie also hätte Kain sich noch verhalten können?
Nun, ich meine, er hätte die Ablehnung seines Opfers schlichtweg annehmen und sich über die positive Bewertung des Opfers Abels freuen können. D. h. er hätte diese unterschiedliche Bewertung des Opfers akzeptieren können als etwas, was er zwar nicht versteht, das zu beurteilen ihm aber auch nicht zusteht. Er hätte seinem Gott die Entscheidung über Annahme und Ablehnung des Opfers überlassen können.
Aber das wollte Kain nicht. Er war nur bereit, eine einzige Entscheidung Gottes zu akzeptieren, nämlich die Annahme des Opfers. Eine andere Entscheidung Gottes missbilligt er. Er nimmt Gott die Freiheit der Entscheidung. Er maßt sich an, das Urteil Gottes zu bemängeln und auf seine Art zu handeln, indem er ein Geschöpf Gottes tötet. Diese Einmischung in Gottes Willen, das ist wohl das Sündhafte.
Wir können uns selbst in Kain wohl wiedererkennen. Es fällt auch uns schwer, die Voraussetzungen unseres Lebens anzunehmen. Auch wir blicken gern auf den anderen mit einem Gefühl des Neids und des Hasses. Und in mancher Stunde sind wir vielleicht versucht, unseren Gott anzuklagen: „Warum hast du es anderen so leicht und mir so schwer gemacht?“ Wir sind gerne bereit, Gott für all das zu danken, was er uns Gutes getan hat, aber sind wir auch bereit, unser Leben als Ganzes anzunehmen, nicht nur das Leichte und Schöne, sondern auch das Schwere? Vermögen wir das Leidvolle anzunehmen, ohne zu klagen, ohne enttäuscht und verbittert zu sein?
Kain hat von Gott bereits Bestimmtes erwartet. Und seine Erwartung ist enttäuscht worden. Gott richtet sich nicht nach unseren Erwartungen. Was er gibt, das gibt er uns aus freien Stücken.
Wir haben durch Jesus Christus gelernt, auf alle Ansprüche zu verzichten und nur noch auf eines zu vertrauen: dass Gott alles zum Guten wenden wird. Zwar können wir die Voraussetzungen unseres Lebens nicht erkennen und verstehen, aber darüber brauchen wir weder zu verzweifeln noch gleichgültig zu werden.
Auch Jesus Christus hat in seinem Leben nicht nur Wege gehen müssen, auf die wir neidisch wären. Er hat viel Leid ertragen müssen bis zum Tod am Kreuz. Er hat Gott dafür nicht angeklagt. Er hat auch die Menschen wegen ihres Unrechts nicht verklagt, sondern ihnen mit seiner Vergebung neue Hoffnung gegeben.
Jesus Christus war fromm, weil er sich dem Willen Gottes überlassen konnte und seinen Geschöpfen diente – durch alle Ungereimtheiten des Lebens hindurch.
Wenn wir so durch das Leben irren in mangelndem Verstehen, dann wollen wir Gott getrost alle Freiheit lassen und darauf vertrauen, dass er es letztlich gut mit uns meint.
Verkündigung
nicht von oben herab und von außen her
10. Oktober 1976
17. Sonntag nach Trinitatis
1. Korinther 9,16-23
Die Predigt heute ist sozusagen eine Predigt in eigener Sache. Wir sollen uns Gedanken machen über das Predigtamt und über die Beziehung zwischen Pastor und Gemeinde. Der Predigttext für den heutigen Sonntag stellt uns diese Aufgabe. Er ist dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther entnommen.
Es geht hier zunächst um die Frage des Lohnes für den Prediger, um die Bezahlung gewissermaßen. Das ist ein, könnte man sagen, ganz weltlich-praktisches Problem. Diesbezüglich hatte es in der Gemeinde in Korinth wohl Ärger gegeben. Jedenfalls sieht Paulus sich in seinem Brief genötigt, einige Dinge klarzustellen.
Ich finde es, nebenbei bemerkt, höchst interessant, die Briefe des Apostels Paulus zu lesen, weil sich aus ihnen die unzähligen Probleme ablesen lassen, die schon in den ersten Gemeinden bestanden haben. Es gibt ja nicht nur bei uns heute, in unserer Gemeinde und in anderen, Probleme, Schwierigkeiten zwischen Pastor und Gemeinde, zwischen Gemeindegliedern und Gruppen. Das alles war schon am Anfang da. Einerseits könnte man sagen: Es ist traurig, dass es auch in christlichen Gemeinden nicht ohne Ärger geht. Andererseits ist es vielleicht auch tröstlich zu sehen, dass man mit seinen Schwierigkeiten nicht so ganz und gar aus der Rolle fällt.
Es geht hier also um das spezielle Problem der Entlohnung des Predigers. Heute, bei uns in Deutschland, ist diese Frage genau geregelt. Bei uns gibt es die Kirchensteuer. Dadurch ist die finanzielle Grundlage für die Bezahlung der Pastoren und andere kirchliche Mitarbeiter gegeben. Die Höhe der Bezüge ist jeweils genau festgelegt. Bei den Pastoren richten sie sich im Wesentlichen nach den Bezügen entsprechender staatlicher Beamter. So ist das in Deutschland bei den Kirchen, denen die Kirchensteuer zu fließt. Aber das ist ja nicht in allen Ländern so und auch nicht in allen Glaubensgemeinschaften.
Zur Zeit des Paulus galt schlichtweg die Regel: Wer arbeitet, soll auch seinen Lebensunterhalt bekommen. Und so sollen auch die Prediger des Evangeliums von den Gemeinden das Nötige zum Leben erhalten. Paulus weist die Korinther ganz ausdrücklich darauf hin: „Wisst ihr nicht, dass die, die den Tempeldienst verrichten, von dem essen, was dem Tempel gehört, und dass die, die am Altar ihres Amtes walten, ihren Anteil am Altar erhalten? So hat auch der Herr den Verkündigern des Evangeliums befohlen, vom Evangelium zu leben.“ Mit aller Entschiedenheit weist Paulus auf sein Recht hin, von der Gemeinde für den Predigtdienst entlohnt zu werden. Daraus können wir schließen, dass ihm dieser Lohn von den Korinthern vorenthalten wurde.
Aber Paulus wollte auf etwas anderes hinaus. Er hatte nämlich auf den Lohn für seine Verkündigung selbst verzichtet, und eben das war zum Problem geworden. Einige in Korinth hatten gemeint, wenn er ein richtiger Apostel sein wolle, dann müsse er auch sein Recht als solcher ausüben.