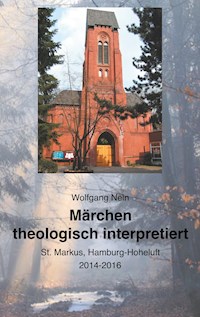Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Das Ja zum Leben und zum Menschen
- Sprache: Deutsch
Das theologische Reden ist ein sehr spezielles. Es handelt von dem Grundlegendsten unserer Existenz mit all ihrem Hintergründigen und Unergründlichen. Wie können wir darüber reden in einer Sprache, die jeder versteht? Luther hat "dem Volk aufs Maul geschaut". Er ist freilich ohne theologische Begriffe und Bilder nicht ausgekommen. Die Predigten dieser Predigtsammlung sind im inneren Dialog vor allem mit denjenigen entstanden, die der Kirche eher fernstehen und sich das kirchliche Reden eher kritisch anhören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Es führen viele Wege in den Stall!
7. Januar 1996
1. Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 2,1-12
Krise macht kreativ
21. Januar 1996
3. Sonntag nach Epiphanias
Apostelgeschichte 10,21-35
Ist Gott ungerecht?
4. Februar 1996
Septuagesimae
(3. Sonntag vor der Passionszeit)
Römer 9,14-24
Wahrhaftige Nächstenliebe statt ichbezogenes Fasten
18. Februar 1996
Estomihi
(Sonntag vor der Passionszeit)
Jesaja 58,1-9a
Geduld nicht missverstehen und missbrauchen!
3. März 1996
Reminiszere
(2. Sonntag der Passionszeit)
Markus 12,1-12
„Gott besinnt sich eines Besseren“
17. März 1996
Laetare
(4. Sonntag der Passionszeit)
Jesaja 54,7-10
Steckbrief eines Unschuldigen
5. April 1996
Karfreitag
Jesaja (52,13-15;)53,1-12
Wir sind es ihm wert – trotz allem!
20. April 1996
Konfirmandenabendmahl
Markus 14,22-24
Wir bekennen uns zum Dennoch
5. Mai 1996
Kantate
(4. Sonntag nach Ostern)
Offenbarung 15,2-4
Vom Gottesdienst in den Bunker
16. Mai 1996
Himmelfahrt
Goldene Konfirmation
Psalm 103,2
Woher kommen wir, wer sind wir, was wird aus uns?
2. Juni 1996
Trinitatis
2. Korinther 13,11-13
Sich in die anderen hineinversetzen
16. Juni 1996
2. Sonntag nach Trinitatis
Partnerschaft St. Markus – Uyole, Tansania
1. Korinther 9,16-23
Besinnt Euch eines Besseren!
23. Juni 1996
3. Sonntag nach Trinitatis
Hesekiel 18,1-4.21-24.30-32
Was und wem soll ich denn nun glauben?
25. August 1996
12. Sonntag nach Trinitatis
1. Korinther 3,9-15
Ermahnungen haben auch ihr Recht
8. September 1996
14. Sonntag nach Trinitatis
1. Thessalonicher 5,14-24
Was hat sich durch Christus verändert?
22. September 1996
16. Sonntag nach Trinitatis
„Kanzeltausch“ mit Eben-Ezer (ev.-method. Gem.)
Hebräer 10,35-36
„An irgendwas muss man doch glauben!“
29. September 1996
17. Sonntag nach Trinitatis
Konfirmandenbegrüßung
Matthäus 19,21
Brief aus Fleisch und Blut
20. Oktober 1996
20. Sonntag nach Trinitatis
2. Korinther 3,3-9
Erlösung hier und jetzt
3. November 1996
22. Sonntag nach Trinitatis
1. Johannes 2,(7-11)12-17
Wer viel empfängt, wird viel verlieren
24. November 1996
Totensonntag / Ewigkeitssonntag
(Letzter Sonntag des Kirchenjahres)
Psalm 126,5
Alt, aber nicht hoffnungslos
29. Dezember 1996
1. Sonntag nach dem Christfest
Lukas 2,25-38
Hochbegabt, sozial und menschlich
5. Januar 1997
2. Sonntag nach dem Christfest
Lukas 2,41-52
Die Zukunft der Gemeinde?
19. Januar 1997
Letzter Sonntag nach Epiphanias
Einführung des Kirchenvorstands
2. Korinther 4,6-10
„Es musste wohl sein“
9. Februar 1997
Estomihi
(Sonntag vor der Passionszeit)
Markus 8,31-38
Heilung durch Provokation der Abwehrkräfte
23. März 1997
Palmsonntag
(6. Sonntag der Passionszeit)
Johannes 12,12-19
Politisches Kalkül und göttlicher Plan
26. März 1997
Passionsandacht
„Pilatus“
Matthäus 27,11-26
Stärkung gegen Fremdsteuerung
27. März 1997
Gründonnerstag
Lukas 23,34
Sehen mit den Augen und dem Herzen
6. April 1997
Quasimodogeniti
(1. Sonntag nach Ostern)
Johannes 20,19-29
Wir können uns direkt an Gott wenden
4. Mai 1997
Rogate
(5. Sonntag nach Ostern)
Johannes 16,23b-28.33
Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt an einem Tag
18. Mai 1997
Pfingstsonntag
Johannes 14,23-27
Wer ist Jesus?
19. Mai 1997
Pfingstmontag
Matthäus 16,13-20
Der Wert des Gottesdienstes
14. Juni 1997
Außentagung des Kirchenvorstands
Psalm 100
Vielfalt des christlichen Glaubens
15. Juni 1997
3. Sonntag nach Trinitatis
Partnerschaft St. Markus – Uyole, Tansania
Lukas 15,1-7
Gute Gaben als Aufgabe annehmen
27. Juli 1997
9. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 25,14-30
Gottesdienst – Feier des Lebens
24. August 1997
13. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 10,25-37
Das Träumen nicht aufgeben!
7. September 1997
15. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 6,24-35
„Ich will so bleiben, wie du bist!“?
14. September 1997
16. Sonntag nach Trinitatis
Begrüßung der neuen Konfirmanden
Psalm 8,5
Grenzen überschreitender Glaube
21. September 1997
17. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 15,21-28
Wir sind gespaltene Persönlichkeiten
26. Oktober 1997
22. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 18,21-35
Leben ist mehr als Überleben
9. November 1997
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Gottesdienst zu Beginn des Basars
Johannes 2,1-17
Flohmarktartikel erhalten ihre Würde zurück
9. November 1997
Abendkirche zum Abschluss des Basars
Gute-Nacht-Geschichte
Den Tod vorausdenken
23. November 1997
Totensonntag / Ewigkeitssonntag
Psalm 90,12
Machbares und Unverfügbares
31. Dezember 1997
Altjahrsabend
Psalm 103,8
Bibelstellen
Vorwort
Das theologische Reden ist ein sehr spezielles. Es handelt von jeder Menge Unbewiesenem. Sollte der Prediger deswegen lieber schweigen und abwarten, bis das Unbewiesene bewiesen ist? Das wäre unsachgemäß, denn das Unbewiesene ist weitgehend zugleich Unbeweisbares. Und bei dem Unbeweisbaren, mit dem sich der Prediger zu befassen hat, handelt es sich um das Grundlegendste unserer Existenz.
Wir kennen die Grundlagen unserer Existenz nicht. Wir nehmen nur wahr, was existiert. Oder vorsichtiger gesagt: Wir nehmen als wahr hin, was existiert. Woher das Existierende kommt, was dahintersteckt, was das Ganze überhaupt auf sich hat, was es überhaupt soll und wo es letztlich hinführen wird, das zu erkennen, ist mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich. Wir sollten uns nichts vormachen. „Was die Welt im Innersten zusammenhält“, wird eine unbeantwortbare Frage bleiben.
Schweigen angesichts des unergründlichen Geheimnisses wäre keine Lösung. Denn wenn das Sein auch ein großes Geheimnis ist, so sind wir doch da. Wir existieren. Und wir sind uns unserer Existenz bewusst. Und wir sind unaufhörlich gezwungen, Entscheidungen zu fällen, um unser Weiterleben sicherzustellen. Wir bewegen uns im Nebel und können nicht stehenbleiben. Was wir tun können, ist, Maßnahmen zu ergreifen, die uns helfen, wenigstens ein Stück weit zu schauen und den überschaubaren Bereich zu gestalten.
Die deutsche Sprache hat vier Buchstaben, um das Geheimnis des Seins kommunikabel zu machen. Sie sind ein sehr behelfsmäßiger Versuch, über etwas zu reden, was so schwer besprechbar ist.
Der Begriff „Gott“ lässt sich mit vielerlei Inhalten füllen. Die verschiedenen Religionen liefern dafür zahlreiche Beispiele. Die Predigten dieses Buches greifen auf die jüdischchristliche Tradition zurück. Die biblischen Generationen haben den Begriff „Gott“ mit persönlichen Kategorien gefüllt. Das ist zum einen hilfreich, weil die Anschaulichkeit von Bildern die Verstehensmöglichkeiten erweitert. Die Personifizierung des Seins ist aber für diejenigen hinderlich, die in den Bildern einen weiteren Beweis dafür sehen, dass das theologische Reden mit der Realität nichts zu tun hat.
Wie können wir über das Grundlegende unserer Existenz mit allem Hintergründigen und Unergründlichen reden in einer Sprache, die jeder versteht? Luther hat „dem Volk aufs Maul geschaut“. Auch er ist freilich ohne theologische Begriffe und Bilder nicht ausgekommen. Die Predigten dieser Predigtsammlung sind im inneren Dialog vor allem mit denjenigen entstanden, die der Kirche eher fernstehen und sich das kirchliche Reden eher kritisch anhören.
Können wir von Gott reden, ohne den Begriff Gott in den Mund zu nehmen? Können wir über Jesus Christus reden, ohne ihn zu erwähnen? Können wir von der Offenbarung sprechen, ohne auf die entsprechenden Texte Bezug zu nehmen?
Noch gibt es eine gewisse Zahl von Menschen, die in kirchlichen Kontexten großgeworden sind und die mit dem theologischen Reden etwas anfangen können – auch für sich persönlich. Die Zahl der kirchlich nicht Sozialisierten und in der theologischen Sprache Ungeübten nimmt aber rapide zu.
Es ist eine Herausforderung, sich um eine theologische Sprache für alle zu bemühen. Es ist einen Versuch wert, bereits gehaltene Predigten einmal so umzuformulieren, als würde es die Bibel, die Kirche, den christlichen Glauben nicht geben. Was bliebe dann an Aussagen bestehen, die im Sinne der christlichen Botschaft für das Leben der Menschen angesichts der unbegreifbaren Grundlagen unserer Existenz hilfreich wären? Blieben dann die im Sinne der christlichen Botschaft relevanten Aussagen erhalten? Und könnte dann in einem zweiten Schritt die Besinnung auf die biblischen Texte und die Kirche als weltweiter menschlicher Gemeinschaft helfen, diese Aussagen als Grundlage und Leitfaden der eigenen Lebensgestaltung und Lebensbewältigung anzunehmen?
Wolfgang Nein, Februar 2017
Es führen viele Wege in den Stall!
7. Januar 1996
1. Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 2,1-12
Gestern, am 6. Januar, war also das Epiphanienfest, das Fest der Erscheinung des Herrn oder - wie es auch genannt wird: das Fest der Heiligen Drei Könige.
Drei Magier aus dem Osten waren einem Stern gefolgt, dem Stern von Bethlehem. Was sind Magier? Das sind doch Zauberer. Und wie nennen wir Menschen, die sich nach den Sternen richten? Das sind doch Astrologen. Schämt sich denn Matthäus gar nicht, uns solche abergläubischen Gestalten als Vorbilder zu schildern? Aus den heidnischen Sterndeutern hat er fromme Anbeter des Christkindes gemacht. Wen kann es da noch wundern, dass nicht lange danach die Kirchengeschichte die drei Heiden in drei Heilige verwandelt hat! Die Zauberer und Astrologen feiern wir als die Heiligen Drei Könige. Für die orthodoxen Christen, auch für die mazedonisch-orthodoxen Christen, die unserer Gemeinde angeschlossen sind, ist dies, wie bereits gesagt, das eigentliche Weihnachtsfest.
Ist das nicht bemerkenswert, dass hier drei Menschen aus einem anderen Land, einer anderen Religion als diejenigen geschildert werden, die in dem neugeborenen Kind von Bethlehem mit Freude die bedeutende Persönlichkeit erkannt haben, die es wert war, sich mit wertvollen Geschenken auf den weiten Weg zu machen? Wir können es dahingestellt sein lassen, ob es sich hier um eine historisch zutreffende Begebenheit handelt; wir können aber auch gleich davon ausgehen, dass wir hier eine Legende vor uns haben. Aber das Interessante ist doch, dass Matthäus, der Evangelist Matthäus, uns diese Männer als Vorbild hinstellt.
Stellen wir uns nur einmal vor, der Bischof der Evangelischen Kirche Deutschlands würde in seinem Weihnachtsbrief an die evangelischen Gemeinden drei bekannte Astrologen zitieren, die in den Zeitschriften ihre Horoskope veröffentlichen, und würde sie uns als vorbildliche Christen hinstellen! Da hätten wir doch Magenkneifen, auch wenn die drei Astrologen etwas Bedenkenswertes gesagt haben mögen. Aber ihr Berufsstand würde die Seriosität aller ihrer Aussagen schon im Vorwege zweifelhaft erscheinen lassen. Wenn Astrologen die christliche Botschaft in Ordnung finden, dann kann an der christlichen Botschaft etwas nicht in Ordnung sein, könnte man argwöhnen. Wir hätten gern andere Zeugen der frohen Botschaft, bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie den Bundespräsidenten z. B. oder andere herausragende Persönlichkeiten.
Was war das Anliegen von Matthäus? Die Antwort lässt sich aus dem Gegenspieler der drei Männer erschließen. Herodes, der König der Juden, will das neugeborene Kind von Bethlehem umbringen lassen aus Furcht vor einem unliebsamen Konkurrenten. Und die religiöse Führung des Landes vollbringt schließlich, was Herodes erfolglos versucht hatte. Von den führenden Vertreter seines eigenen Volkes war Jesus nicht als der Christus erkannt und anerkannt worden. Von ihnen war er verfolgt und hingerichtet worden. Die Anhänger Jesu waren schließlich aus der jüdischen Religionsgemeinschaft hinausgedrängt worden und hatten sich in eigenen Gemeinden organisieren müssen, wie z. B. in der des Matthäus in Syrien vermutlich. Ist es da noch verwunderlich, wenn Matthäus seinen Lesern und Zuhörern mitteilt: Die eigenen Leute haben Jesus verstoßen, aber bei den Fremden hat er Anerkennung gefunden?! Die Obersten der Frommen haben ihn zu Tode gebracht, aber die als Heiden gering geachtet waren, die haben in Jesus den gottgesandten Messias erkannt.
Es steckt also zum einen eine gehörige Portion Kritik und wohl auch Polemik in der Darbietung dieser Szene von den drei Magiern aus dem Osten. Es ist eine Spitze gegen die etablierte Frömmigkeit, die zu blind war für die neue Offenbarung Gottes.
Zum anderen enthält diese Szene aber auch eine positive Aussage: Matthäus bekennt sich hier zu der Möglichkeit, dass auch unter den sog. Heiden von deren eigenen Voraussetzungen her die grundlegende Bedeutung Jesu Christi erkannt werden kann. Jeder Mensch, ganz gleich in welchem Land er lebt, welcher Kultur, welcher Religion er zugehört, kann in Jesus Christus denjenigen erkennen, der den Menschen das Heil bringt. Und umgekehrt gilt: Jesus Christus bietet das Heil jedem Menschen an - ganz gleich in welchem Land er lebt, welcher Kultur und welcher Religion er angehört. Das ist die Botschaft, die uns Matthäus mit seiner Szene von den drei Magiern aus dem Osten vermittelt.
Wie ist diese Botschaft zu verstehen? Ist es nicht so, dass in jedem Menschen gleiche Fragen vorhanden sind, dass jeder Menschen mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, dass in jedem Menschen gleiche Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte vorhanden sind? Steht nicht jeder Mensch erstaunt vor dem Wunder seiner Geburt? Und hat nicht jeder mit der unausweichlichen Tatsache seines eigenen Todes fertigzuwerden? Ist nicht jeder Mensch von Krankheit bedroht, und ist nicht jeder den mannigfaltigen Gefährdungen des Daseins ausgesetzt? Hat nicht jeder die tägliche Mühsal der Lebenserhaltung zu ertragen? Und muss nicht jeder die Frage beantworten: Wie halte ich es mit meinen Mitmenschen? Wie gehe ich mit den zwiespältigen Erfahrungen um, die ich mit ihnen sammle, den erfreulichen und den enttäuschenden? Und wie bestimme ich mein Verhältnis zu mir selbst - dem schillernden, mir am besten bekannten und doch auch unbekannten, dem mir gehorsamen und zugleich auch ungehorsamen Wesen? Jeder muss mit diesen Fragen zurechtkommen. Und in irgendeiner Weise hat jeder darauf seine vorläufigen Antworten gefunden. Es bleibt aber jeder ein Fragender und Suchender.
Da kann es doch sein, dass sich jemandem das Kind von Bethlehem als die Antwort offenbart, die alle bisherigen Antworten in den Schatten stellt. Jemand, der bisher in den Sternen nach einer Antwort auf die drängenden Fragen seines Lebens gesucht hat, kann doch mit einem Mal erkennen: Nicht in den Sternen liegt mein Heil verborgen, sondern in einem Menschen, dem Kind von Bethlehem. Nicht die Sonne ist Gott, nicht der Mond ist Gott, nicht irgendein Stern ist Gott. Sondern Sonne, Mond und Sterne sind Geschöpfe des einen unsichtbaren Gottes, der auch den Menschen geschaffen hat - in Liebe, entworfen nach seinem Bild und auf sein Abbild hin.
Matthäus teilt ganz bestimmt nicht die religiösen Vorstellungen der Magier und Astrologen. Aber er spricht ihnen das Recht zu, von ihren Vorstellungen her, sich mit ihren Bildern und Begriffen dem Christkind zu nähern. Er selbst greift ihre Vorstellungen auf und integriert sie wie selbstverständlich in seine Darstellung des Christusgeschehens, und wir sind ihm auf diesem Weg gefolgt. Nehmen wir den Stern von Bethlehem in unsere gottesdienstliche Darstellung des Krippenspiels mit hinein, weil wir daran glaubten, Gott würde sich uns in den Sternen offenbaren? Nein, uns ist der Stern eine liebe Erinnerung daran, dass er drei Menschen den Weg zum Stall gewiesen hat. Uns hätte der Stern nichts zu sagen gehabt. Aber für diese drei Männer ist er wichtig gewesen. Für uns ist wichtig, dass sie in dem Kind den Christus erkannt haben. Der Stern ist uns dafür das bleibende äußere Zeichen.
Diesen Vorgang erleben wir vielfach - die Bibel ist voll davon: dass wir Vorstellungen, Formen, Bilder, Begriffe anderer Kulturen und Religionen übernommen haben, um mit ihnen unsere christlichen Glaubensinhalte zu beschreiben und zu praktizieren. Wie die Magier hat auch Jesus z. B. Wunder vollbracht - allerdings nicht um der Zauberei willen, sondern um der Menschlichkeit willen.
Es führen viele Wege zu Gott, und Gott kommt uns auf vielen Wegen entgegen. Nehmen wir die Schilderungen der Bibel: Gott offenbart sich in der Schöpfung, er erscheint in Naturereignissen, er macht seinen Willen durch die Geschichte kund. Er lässt uns seinen Willen durch Gesetze wissen. Er erscheint in Träumen, er spricht durch Engel, durch Propheten, er handelt sogar durch Tiere. Er offenbart sich schließlich in der menschlichen Gestalt Jesus Christus. Die biblischen Autoren scheuen sich nicht, die Darstellungsweisen Gottes aufzugreifen, wie sie in den Kulturen verwendet wurden, mit denen sie sich in engem Kontakt befanden. Sie vermochten es dennoch, die übernommenen Formen mit ihren je eigenen Inhalten zu füllen.
Jesus Christus ist der ganzen Welt zum Heil erschienen. Er ist in allen Teilen der Welt angenommen worden. Seine Bedeutung wird unterschiedlich ausgelegt je nach dem, in welchem Zusammenhang sich Menschen ihm zuwenden. Es ist schon ein Unterschied, ob sich ein nordeuropäischer Theologieprofessor über Jesus Christus äußert oder ein Mädchen vom Lande in Tansania, das dort in einer Gemeinde biblische Geschichten kennengelernt hat. Und wenn wir uns hier untereinander befragen würden, dann kämen wir gewiss auch zu unterschiedlichen Ergebnissen - wenn uns natürlich auch viel Gemeinsames verbinden würde.
Matthäus berichtet, wie die gebildeten, wohlhabenden, fremdgläubigen Magier aus dem Osten auf weitem Weg zu Jesus gelangten. Lukas berichtet, wie die armen, ungebildeten Hirten vom Feld den Weg zu Jesus fanden. Jeder von uns kann nur seinen eigenen Weg gehen. Darin wollen wir uns auch gegenseitig respektieren. Das andere ist ebenso wahr: Jedem von uns offenbart sich Gott auf unterschiedliche Weise, auf die uns gemäße Weise. Auch das müssen und wollen wir gelten lassen.
So kann unser Reden von Gott sich sinnvollerweise nur im Dialog miteinander vollziehen. Wäre das nicht ein guter Vorsatz für das neue Jahr: dass wir uns mehr miteinander austauschen, auch und gerade in biblischen und theologischen Dingen, mit mehr Selbstbewusstsein, aber auch mit der gehörigen Toleranz, der Einsicht also, dass jeder - ob Pastor oder Laie - Bedeutsames beizutragen hat.
Wir haben alle einander etwas zu sagen. Wir können alle voneinander lernen und einander bereichern mit den je besonderen Gaben und Einsichten, mit denen Gott jeden von uns gesegnet hat.
Krise macht kreativ
21. Januar 1996
3. Sonntag nach Epiphanias
Apostelgeschichte 10,21-35
Wir haben hier einen Text aus dem Neuen Testament vor uns, einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte des Lukas. In seiner Apostelgeschichte schildert uns Lukas die Anfänge der christlichen Kirche. Wie hat das angefangen mit der Kirche, mit dem christlichen Glauben? Das ist doch eigentlich eine interessante Frage. Das ist ja immerhin schon an die 2000 Jahre her. Heute sitzen wir hier immer noch, Kirche existiert noch, der christliche Glaube existiert noch. Das ist doch erstaunlich. Andererseits befinden sich Kirche und christlicher Glaube in einer Krise. Das könnte uns Grund und Anlass sein zu grundsätzlichen Gedanken, zu fragen: Wie war es damals, wie ist es heute, was können wir lernen aus der Vergangenheit?
Eine Einsicht, die ich für die heutige Krisensituation z. B. ganz hilfreich finde, ist die, dass die Kirche mal ganz klein angefangen hat. Da waren zunächst wenige Menschen um diesen Jesus von Nazareth herum, und zwar schlichte, einfache Menschen und ziemlich mittellose Menschen. Und die Situation, in der es mit dem christlichen Glauben anfing, war andererseits alles andere als einfach. Die Umstände waren höchst schwierig. Das Christentum wuchs in einer Situation der Feindseligkeit auf. Es wurde nicht mit offenen Armen aufgenommen. Im Gegenteil: Wer sich zum christlichen Glauben bekannte, war sich seines Lebens nicht mehr sicher.
Vielleicht war das sogar hilfreich für die Ausbreitung des christlichen Glaubens. Gerade die gemeinsame Bedrohung mochte die ersten Christen zusammengeschweißt haben und ihre Widerstandskraft gestärkt haben.
Davon bin ich überzeugt: Schwierigkeiten haben nicht nur etwas Negatives an sich. Probleme reißen einen nicht nur runter. Probleme können auch aufbauen. Aus einer Krise können wir auch gestärkt hervorgehen. Wenn man es zu bequem hat, ist das ja auch nicht gut: Wenn wir nur genüsslich im Sessel sitzen, weil alles klar ist, dann werden unsere Muskeln schlaff, der Bauch wächst, wir werden träge, auch unser Geist wird träge, uns fällt nichts mehr ein, und wir meinen auch, uns nichts mehr einfallen lassen zu müssen, weil alles läuft.
Die Krise ist auch eine Chance. Als solche sollten wir sie nutzen. Die Krise der Kirche ist eine Chance zur Erneuerung. Es ist uns doch schon seit Jahrzehnten klar, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher: dass die Formen, die Sprache, der Arbeitsstil, die Ansprüche in der Kirche renovierungsbedürftig sind. Es ist ja auch manches an Veränderung versucht worden. Aber der Durchbruch ist noch nicht geschafft. Der ganze große Druck war noch nicht da. Aber jetzt kommt er. Und ich behaupte: Das wird uns guttun. Der Druck kann wie ein Befreiungsschlag wirken und den Pfropfen aus dem Flaschenhals herausdrücken, und dann kann der köstliche Wein fließen.
Natürlich kann man an einer Krise auch zugrunde gehen. Aber diese Gefahr sehe ich im Falle der Kirche und des christlichen Glaubens nicht. Denn das, worum es im christlichen Glauben im Kern geht, das ist existentiell so bedeutsam und so stark, dass es unausrottbar ist. In dem Sinne dürfen wir ganz fest an die Auferstehung glauben.
Die in Jesus Christus verkörperte Liebe Gottes zum Menschen - die kann nicht ausgelöscht werden. Diese Botschaft ist nun einmal in der Welt - und sie wird gebraucht. Das Ja zum Menschen und das Ja zum Leben - nach beidem wird immer dringender Bedarf bestehen wie nach dem täglichen Brot, wie nach Wasser, wie nach Luft und wie nach Licht. Denn das brauchen wir zum Leben. Der Mensch - und wir zählen ja alle zu dieser Gattung hinzu - ist wirklich in vieler Hinsicht ein sehr problematisches Wesen. Aber wir alle wollen geliebt werden, und wir wollen uns auch anderen in Liebe zuwenden. Deswegen werden wir nicht nachlassen, nach dem zu suchen, was uns im Neuen Testament angeboten wird.
Und wie der Mensch, so ist auch das Leben überhaupt eine überaus problematische Angelegenheit. Aber wir wollen leben, und wir wollen auch neues Leben schenken. Darum werden wir auch hier nicht nachlassen, nach dem zu suchen, was unseren Wunsch und unseren Willen und unsere Sehnsucht nach Leben stärkt. Und diese Kraft empfangen wir aus den biblischen Texten. Da ist die Quelle des Lebens. Sie wird nicht versiegen.
Die Krise ist eine Chance. Sie nimmt uns so richtig in die Mangel und schüttelt uns durch. Das wird uns guttun.
Die Krise kann uns die Augen öffnen für manche Aspekte des christlichen Glaubens, die wir bisher nicht so recht wahrgenommen haben, die uns aber vielleicht weiterhelfen können. Blicken wir in die Apostelgeschichte des Lukas zurück - in den heutigen Abschnitt. Der handelt insbesondere von Petrus und Kornelius. Diese beiden Menschen begegnen sich. Der Hintergrund dieser Begegnung hat, wie ich finde, etwas sehr Erhellendes an sich.
Petrus war einer der Jünger Jesu gewesen. Er hatte sich, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und gen Himmel gefahren war und seine Jünger allein zurückgelassen hatte, auf den Weg gemacht. Petrus hatte sich auf den Weg gemacht von Jerusalem nach Cäsarea.
Wer war Petrus gewesen? Petrus war aufgewachsen in der Tradition der jüdischen Religion - wie Jesus ja auch. Dann hatte er Jesus kennengelernt und war zu einem seiner Anhänger geworden. Und schließlich fühlte er sich berufen, die Sache Jesu weiterzutragen.
Er trug sie weiter, er machte sich im wörtlichen Sinne auf den Weg, auf den Weg nach Cäsarea - das war eine Stadt an der Küste, eine Stadt am Rande des Einzugsbereichs der jüdischen Religion. Er begab sich also in fremdes Territorium, in die Gegend fremder religiöser Einflüsse.
In dieser Situation kommen jetzt drei religiöse Strömungen zusammen: die jüdische, die christliche und, wie die Bibel es immer formuliert, die heidnische. Das ist eigentlich ein schlechter Begriff, ich möchte in diesem konkreten Fall mal sagen: die römische Religion, denn Kornelius war ein römischer Hauptmann.
Also noch einmal: Petrus und Kornelius begegnen sich. Petrus ist in der jüdischen Religion aufgewachsen und zum Christen geworden, und Kornelius ist in dem römischen Vielgötterglauben aufgewachsen, aber voller Sympathie für die Religion des Landes, in dem er nun als Fremder lebt und arbeitet.
Diese - ich sag das jetzt mal mit den Worten unserer Tage - diese interkulturelle und interreligiöse Begegnung ist brisant, explosiv, aber auch sehr kreativ. Wo sich Menschen aus verschiedenen Ländern, und noch dazu mit verschiedenem religiösen Hintergrund begegnen, da ist zum einen Gefahr im Verzuge, das ist uns ja - leider - eine tägliche Erfahrung. Aber da ist zum anderen eine enorme Chance gegeben, dass sich Neues entwickelt.
Manche Menschen haben Angst vor dem Andersartigen, vor dem Fremdartigen. Manche haben sogar einen Widerwillen. Manche entwickeln sogar Aggressionen gegen das, was anders ist, als was sie gewohnt sind. Das scheint in der Natur des Menschen zu liegen. Die Bibel selbst ist voll von solchen Abgrenzungstendenzen gegenüber dem Fremden. Das Volk Israel hat sich traditionell abgegrenzt und hat deutlich unterschieden zwischen denen aus dem Volk und den anderen, denen aus anderen Völkern und Religionen, den sog. Heiden. Nach alten israelitischen Gesetzen war z. B. die Heirat mit einem Menschen von außerhalb des eigenen Volkes untersagt. Fremde, Heiden, galten als unrein im religiös-kultischen Sinne. Man sollte sie noch nicht einmal besuchen. Solche Regelungen galten noch bis in die Zeit des Neuen Testaments hinein. Sie spielen auch in unserem heutigen Predigtabschnitt eine Rolle.
Petrus, der, wie gesagt, in der jüdischen Religion aufgewachsen war und sich noch als Jude fühlte, und der nun das Haus des römischen Hauptmanns Kornelius betritt, sagt zu den Anwesenden quasi entschuldigend: „Eigentlich darf ich als Jude dieses heidnische Haus gar nicht betreten und euch als Fremden so nahekommen. Aber ich tue es trotzdem.“
Das ist für uns jetzt der springende Punkt: „Gott hat mir aufgetragen, keinen Menschen als unrein anzusehen.“ Petrus überwindet die Barriere zwischen sich und dem Fremden, und das heißt zwischen sich als Menschen jüdischer Herkunft und dem Mann des römischen Reiches, der römischen Religion. Zu dieser Grenzüberschreitung fühlt sich Petrus ermutigt und berufen durch seinen neuen Glauben. Denn durch Jesus Christus hat er Gott neu sehen und verstehen gelernt, und dabei war ihm aufgegangen: Es kann nicht der Wille Gottes sein, Grenzen zwischen Menschen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die Grenzen müssen überschritten werden, Begegnungen müssen in aller Freiheit erlaubt sein, und nicht nur das: Sie müssen gefördert werden.
Der christliche Glaube fördert solche Grenzüberschreitungen. Mit der Liebe Gottes zum Menschen verträgt es sich nicht, Grenzen kultureller und religiöser Art zu ziehen und Menschen auszugrenzen. Es könnte einer sagen: Kornelius war ein Sonderfall. Er war von vornherein sehr offen gegenüber der jüdischen Religion und der neuen christlichen Strömung; er stand sozusagen schon halb im anderen Lager. Aber dieses Argument dürfen wir nicht gelten lassen. Wir sind im Sinne der grenzenlosen Liebe Gottes zur Grenzüberschreitung allen Menschen gegenüber beauftragt, auch unabhängig von deren Sympathie für uns und unsere kulturelle und religiöse Art.
Ich möchte noch eines hinzufügen: Abgesehen von den menschlichen Aspekten der kulturellen und interreligiösen Begegnung sind solche Begegnungen auch außerordentlich kreativ im besten Sinne des Wortes. Aus solchen Begegnungen entsteht Neues. Auch das Christentum, unser christlicher Glaube, ist das Ergebnis - das wunderbare Ergebnis - interkultureller und interreligiöser Begegnung. Wie gesagt, Petrus war von Haus aus Jude. Und auch Jesus war Jude. In der jüdischen Religion liegen die Wurzeln des christlichen Glaubens. Und die jüdische Religion hat sich wiederum aus der Begegnung mit etlichen anderen Religionen herausgebildet. Römische, griechische und andere Einflüsse haben im weiteren Verlauf den christlichen Glauben mit geformt. Das können wir alles noch aus der Bibel selbst herauslesen.
Die interreligiöse und interkulturelle Begegnung ist aus menschlichen Gründen und um des Friedens willen eine große Aufgabe. Sie ist darüber hinaus auch eine Quelle der Kreativität. Kreativität brauchen wir in der Kirche, in einer Zeit der Krise mehr denn je.
Ist Gott ungerecht?
4. Februar 1996
Septuagesimae
(3. Sonntag vor der Passionszeit)
Römer 9,14-24
Manch einer weiß mit religiösen Dingen nichts anzufangen. Das mit dem Glauben sagt manchen nichts. Und das Reden von Gott erscheint einigen eher peinlich, wenn nicht gar lächerlich.
Es hat aber jemand behauptet - und dem kann ich nur zustimmen: „Der Mensch ist in Wirklichkeit unheilbar religiös.“ Da gibt es kein Entkommen. Das lässt sich auch erklären. Das liegt nämlich an den Grundbedingungen unserer Existenz. Die sind so unfassbar, dass sie immer mehr Fragen aufwerfen werden, als wir jemals beantworten können.
Um ein Beispiel zu nennen: Wir werden aus fast nichts geboren - und was von uns bleibt, ist auch fast nichts. Woher wir kommen und wohin wir gehen, wird ein Geheimnis bleiben. Aber auch was dazwischen ist, ist geheimnisvoller, als wir gemeinhin denken. Das Leben, das wir führen, über das wir im alltäglichen Verlauf nicht so sehr viel nachdenken, dieses Leben ist voller Fragezeichen, voller Ungereimtheiten, voller Rätsel. Das macht das Leben zum einen interessant. Denn es gibt unendlich viel zu entdecken und zu erforschen und zu erleben. Das Leben ist wie ein Abenteuer. Zum anderen können die vielen Fragen und Rätsel und Ungereimtheiten manchmal aber auch geradezu unerträglich sein. Es ist gelegentlich eine wirkliche Belastung, dass wir manche Fragen nicht beantwortet kriegen und dass wir manche Probleme einfach nicht lösen können und dass wir manches nicht so regeln können, wie es uns richtig und gerecht erschiene.
Manches in unserem Leben müssen wir - wohl oder übel - hinnehmen. Das ist wirklich nicht immer leicht. Wir fragen manchmal: „Warum? Warum musste gerade mir das passieren? Bin ich denn schlechter als andere? Habe ich mir denn etwas zuschulden kommen lassen, dass mir dies zustoßen musste?“
Und selbst, wenn wir uns etwas haben zuschulden kommen lassen, wenn wir also einfach die Konsequenzen unserer eigenen Art zu erleiden haben, quält uns die Frage: „Warum? Warum bin ich so, dass ich mich immer wieder so und so verhalte? Warum kann ich nicht anders sein? Warum ist mir bei der Geburt nicht gleich ein anderer Charakter, eine andere Art mitgegeben worden, die mir von vornherein viele Probleme im Leben erspart hätte?“
Warum sind wir so, wie wir sind? Warum geschieht uns dies und jenes? Aus solchen Fragen spricht eine Ohnmacht, nicht selten auch eine Wut und Verzweiflung. Und hinter diesen Fragen steht der Wunsch nach einer Gerechtigkeit, und zwar der Wunsch nach einer barmherzigen Gerechtigkeit.
Wenn es uns schlecht genug geht, kann es sein, dass wir den Eindruck haben: Der muss doch ungerecht sein, der uns geschaffen hat, der das mit dem Dasein eingerichtet hat und der die Dinge des Lebens letztlich in seiner Hand hat.
Ich glaube, dass, wenn es um die Frage nach der letzten Verantwortung geht, dann wird auch der ganz Hartgesottene religiös. Denn wenn uns etwas zugestoßen ist - mag auch unsere eigene Art das Unglück mit verursacht haben -, dann suchen wir doch nach einem letzten Verursacher außerhalb unserer selbst. Dann wird uns klar, und zwar zurecht, dass wir selbst nicht die letzte Instanz sind, dass da doch noch Kräfte außerhalb unserer selbst sind, die wir nicht zu steuern vermögen.
Diese Frage ist eine Grundfrage unserer Existenz: „Wie weit haben wir unserer Leben selbst in der Hand, und wie weit liegt unser Leben in der Hand eines anderen? Wie weit sind wir selbst verantwortlich, und wie weit trägt ein anderer letztlich die Verantwortung für unser Leben, für die Vorgänge in unserem Leben, für unser Sosein und für unser Verhalten?“ Diese Frage ist eine Grundfrage. Sie stellt sich uns in manchen Situationen mit Macht, und sie hat keine endgültige Antwort.
Es ist so, dass wir diese Frage mal so und mal so beantworten - ich will nicht gerade sagen, „wie es uns in den Kram passt“, aber eine einheitliche Antwort haben wir nicht.
Ich möchte mal etwas konkreter werden. Nehmen wir noch einmal das Unglück, das uns selbst zustößt, wo wir fragen: „Warum gerade ich? Habe ich mir etwas zuschulden kommen lassen? Bin ich denn schlechter als andere? Womit habe ich das verdient?“
Hinter diesen Fragen steckt die Auffassung: Wenn ich mich korrekt verhalte, müsste es mir eigentlich gut gehen. Wenn ich mich unkorrekt verhalte, darf ich mich nicht wundern, wenn es mir schlecht geht, die Auffassung also: Den Guten belohnt Gott, den Bösen bestraft er. Wenn es so wäre in der Wirklichkeit, dann hätte das ja zumindest einen Vorteil: Man könnte sein Schicksal selbst bestimmen. Man müsste sich nur immer anständig verhalten, immer Gutes tun, dann ginge es einem auch gut. Und der andere Vorteil wäre: Die Bösen würden letztlich bestraft. Es gäbe also eine letzte Gerechtigkeit. Es würde sich auszahlen, gut zu sein. Und es würde sich letztlich nicht lohnen, Böses zu tun.
Aber entspricht diese Auffassung der Wirklichkeit? Wohl eher nicht. Die Übeltäter kommen oft genug ungestraft davon, und mancher wirklich gute Mensch hat es in seinem Leben sehr schwer.
„Gott belohnt die Guten, und die Bösen bestraft er“, dieses Konzept ist schon im Alten Testament hinterfragt worden. Sie kennen Hiob, den frommen Mann, dem es zunächst gut ging und der dann doch ein Unglück nach dem anderen erleiden musste. An Hiob wird dieses Konzept hinterfragt. Es wird klargemacht: So funktioniert die Gerechtigkeit Gottes nicht.
Es wird in dem Buch Hiob immer wieder die Frage gestellt, die auch Paulus in unserem heutigen Predigttext stellt. „Ist denn Gott ungerecht?“ Paulus antwortet: „Das sei ferne“ - mit anderen Worten: „Natürlich ist Gott gerecht.“ So antwortet meines Wissens das Buch Hiob nicht. Vielmehr kommt im Buch Hiob eine Antwort zum Tragen, die Paulus ein paar Sätze weiter auch gibt: „Wer bist du, Mensch, dass du mit Gott rechten willst?!“ Und dies wiederum mit anderen Worten gesagt: Es hat keinen Sinn, und es ist unangemessen, mit Gott ins Gericht gehen zu wollen.
Damit ist doch gesagt: Gott hat seine eigene Gerechtigkeit, über die wir nicht befinden können, die wir nicht steuern können, die wir einfach hinzunehmen haben, und die wir nicht einmal kritisieren sollen.
Wenn Sie das Buch Hiob lesen, und wenn Sie diese Sätze bei Paulus lesen, dann wird sich Ihnen vielleicht der Eindruck aufdrängen: Das ist ja ein willkürlicher Gott, der ganz nach eigenem Gutdünken es den einen gut gehen lässt, den anderen schlecht, ohne erkennbares System, ohne dass unsereins darauf Einfluss nehmen könnte und ohne dass wir daraus irgendwelche Handlungsempfehlungen ableiten könnten, sodass wir am Ende zu dem Schluss kommen müssten: „Es ist eh egal, wie wir leben, wie wir uns verhalten, was wir tun und was wir nicht tun. Es kann uns so oder so gut gehen oder schlecht gehen.“
Dass solche Willkür etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben sollte, wäre wirklich schwer einsehbar.
Aber das können wir zunächst einmal feststellen: Die Wirklichkeit ist so. Sie ist letztlich für uns unberechenbar und nicht durchkonstruiert nach einem System, das wir mit unseren gängigen Maßstäben als gerecht bezeichnen würden.
Man könnte hierüber in Wut und Verzweiflung geraten. Und Hiob hat ja durchaus Gott angeklagt und verflucht. In seiner Verzweiflung hat er sich und sein Leben und den Schöpfer verflucht. Es ist ja auch wirklich nicht einfach, sich selbst und sein Leben so hinzunehmen, wie Paulus das mit dem Bild vom Töpfer und seinen Gefäßen beschreibt: Der Töpfer formt aus dem Ton verschiedene Gefäße - nach Lust und Laune. Mal stellt er eine große kunstvolle Vase her, mal einen einfachen kleinen Teller, das eine Gefäß vielleicht zur Freude und Erbauung des Benutzers, das andere zum bloßen alltäglichen Gebrauch.
Es ist schwer, sich selbst und sein eigenes Leben in diesem Sinne zu betrachten. Hat der Schöpfer uns und unser Leben als wunderbare Vase gestaltet, die schön anzusehen ist, und die sorgsam bewahrt und geachtet ist, oder hat er uns und unser Leben zu ordinärem Alltagsgeschirr gemacht, das keiner besonderen Beachtung wert ist, und das, wenn es im Mülleimer landet, gar nicht vermisst wird? Wie gesagt: So werden wir unser Leben nicht gerne betrachten wollen. Und: So sollen wir uns und unser Leben auch gar nicht betrachten.