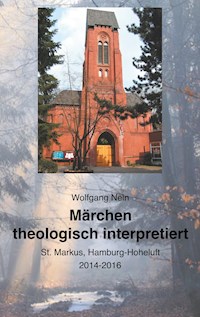Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Das Ja zum Leben und zum Menschen
- Sprache: Deutsch
Wenn wir über unser Dasein nachdenken, stoßen wir an Grenzen, die wir nur noch mit - unbeantwortbaren - Fragen überschreiten können. Das Unerklärbare, Unbegreifbare, Geheimnisvolle zu gestalten, ist wesentlicher Bestandteil des christlichen Gottesdienstes. Dies immer wieder bewusst zu machen, gehört mit zu den Aufgaben einer Predigt. Die Predigten dieses Buches wie der ganzen Predigtsammlung sind von dem steten Bemühen geprägt, die inneren Fragen sowohl der regelmäßigen wie der gelegentlichen Gottesdienstbesucher aufzugreifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Langfristig glauben
14. Januar 1990
2. Sonntag nach Epiphanias
Hebräer 12,12-18(19-21)
„Mission“ unter uns wird wieder eine Aufgabe
4. Februar 1990
Letzter Sonntag nach Epiphanias
2. Petrus 1,16-21
Fasten ja, aber glaubwürdig
25. Februar 1990
Estomihi
(Sonntag vor der Passionszeit)
Jesaja 58,1-9a
Über religiöse Unterschiede friedlich streiten
18. März 1990
Okuli
(3. Sonntag der Passionszeit)
1. Könige 19,1-8(9-13a)
Ein religiös Interessierter lässt sich überzeugen
16. April 1990
Ostermontag
Apostelgeschichte 10,34a.36-43
Wer bin ich?
22. April 1990
Quasimodogeniti
(1. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
Jesaja 43,1b
Leibhaftige Gegenwart wird zur geistigen
27. Mai 1990
Exaudi
(6. Sonntag nach Ostern)
Römer 8,26-30
Christlicher Glaube: ein wertvolles Angebot
15. Juli 1990
5. Sonntag nach Trinitatis
2. Thessalonicher 3,1-5
Erschreckte Einsicht in die eigene Schuld
26. August 1990
11. Sonntag nach Trinitatis
2. Samuel 12,1-10.13-15a
Ratschläge für die Gemeinde und uns
16. September 1990
14. Sonntag nach Trinitatis
1. Thessalonicher 5,14-24
Mit Egoismus dem Gemeinwohl dienen
7. Oktober 1990
17. Sonntag nach Trinitatis
Epheser 4,1-6
Gott schuf den Menschen – als Mann und Frau
4. November 1990
21. Sonntag nach Trinitatis
1. Mose 1,27
Friede und Gerechtigkeit
18. November 1990
Volkstrauertag
Jesaja 32,17
Jeder Augenblick ein Stück Ewigkeit
25. November 1990
Totensonntag / Ewigkeitssonntag
Motettengottesdienst
Psalm 103,15-16
Resigniert vernünftig?
30. Dezember 1990
1. Sonntag nach Weihnachten
Lukas 2,25-38
Die Tage unseres Lebens nehmen zu
31. Dezember 1990
Altjahrsabend
Offenbarung 22,30
Manchmal bleibt nur das Beten
2. Februar 1991
Friedensgebet
Lukas 2,14
Der Mensch zwischen Gott und dem Teufel
17. Februar 1991
Invokavit
(1. Sonntag der Passionszeit)
Matthäus 4,1-11
Das Ende wurde zum Anfang
31. März 1991
Ostermorgen
Markus 16,1-8
Hier geht es um Grundfragen des Lebens
7. April 1991
Quasimodogeniti
(1. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
Psalm 139,14
Religiös mündig werden
5. Mai 1991
Rogate
(5. Sonntag nach Ostern)
Johannes 16,23b-28.33
Das Wunder des Verstehens
19. Mai 1991
Pfingsten
Johannes 14,23-27
„Suchende sind wir“
26. Mai 1991
Trinitatis
Johannes 3,1-8
Aus guten Gaben viel Gutes machen
28. Juli 1991
9. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 25,14-30
Matthäus und Markus mit je eigenem Konzept
22. September 1991
17. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 15,21-28
Sollen wir, was wir nicht können?
20. Oktober 1991
21. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 5,38-48
Gerechtigkeit – Wunsch und Auftrag
31. Oktober 1991
Reformationstag
Matthäus 5,6
Wir sind Christen und Staatsbürger zugleich
3. November 1991
23. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 22,15-22
Wir müssen loslassen, weil wir empfangen haben
24. November 1991
Totensonntag / Ewigkeitssonntag
Matthäus 25,1-13
Christus – ein Angebot für Menschen weltweit
5. Januar 1992
2. Sonntag nach dem Christfest
Matthäus 2,1-12
Angebot für jene, die es wirklich brauchen
9. Januar 1992
4. Sonntag nach Epiphanias
Andacht vor der Bezirksvertretung der Synode
Johannes 10,27-28
Selbstvertrauen plus Gottvertrauen
2. Februar 1992
4. Sonntag nach Epiphanias
2. Korinther 1,8-11
Miteinander und füreinander trotz aller Unterschiede
1. März 1992
Estomihi
(Sonntag vor der Passionszeit)
1. Korinther 13,1-13
Das Menschliche Gottes ins Unmenschliche verkehrt
15. April 1992
Passionsandacht
Markus 15,1-15
Das Kreuz über dem Fernseher
17. April 1992
Karfreitag
2. Korinther 5,(14b-18)19-21
Erzähl mir eine schöne Ostergeschichte!
19. April 1992
Ostersonntag
1. Korinther 15,1-11
Christ sein – mit Herz und Händen
10. Mai 1992
Jubilate
(3. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
Johannes 1,14a
Die guten Erfahrungen zählen mehr
28. Mai 1992
Himmelfahrt
Goldene Konfirmation
Psalm 103,2
Gemeindeaufbau mit Hindernissen
8. Juni 1992
Pfingstmontag
1. Korinther 12,4-11
Bibelauslegung ist unvermeidbar subjektiv
14. Juni 1992
Trinitatis
Partnerschaft St. Markus – Uyole, Tansania
Galater 1,1-10
Jesus – Integrationsfigur?
28. Juni 1992
2. Sonntag nach Trinitatis
Epheser 2,17-22
Unser Stellvertreter
26. Juli 1992
6. Sonntag nach Trinitatis
Römer 6,3-8(9-11)
Wir wollen als rechtschaffen gelten
16. August 1992
9. Sonntag nach Trinitatis
Philipper 3,7-11
Wie werden wir Christen?
6. September 1992
12. Sonntag nach Trinitatis
Apostelgeschichte 9, 1-9(10-20)
Die Kindschaft annehmen
20. September 1992
14. Sonntag nach Trinitatis
Römer 8,14-17
Dankbar annehmen und weitergeben
4. Oktober 1992
Erntedankfest
(16. Sonntag nach Trinitatis)
2. Korinther 9,6-15
Wie verbindlich sind Formen?
18. Oktober 1992
18. Sonntag nach Trinitatis
Römer 14,17-19
Wir sind Heilige, obwohl wir keine sind
1. November 1992
20. Sonntag nach Trinitatis
1. Thessalonicher 1,4-8
Umkehren, stille sein und hoffen?!
31. Dezember 1992
Altjahrsabend
Jesaja 30,15
Bibelstellen
Vorwort
Gibt es in Deutschland Erwachsene, die noch nie in einem christlichen Gottesdienst waren? Gewiss, viele mit Migrationshintergrund. Aber auch unter Menschen aus Familien, die seit Generationen in Deutschland leben, gibt es inzwischen etliche - und ihre Zahl wächst rapide -, die keinerlei Gottesdiensterfahrung haben. Wenn solche Menschen erstmals an einem Gottesdienst teilnehmen, wie werden sie dieses Ereignis erleben? Es mag ihnen recht fremdartig vorkommen. Vielleicht erleben sie es so exotisch, wie wir es im Urlaub empfinden, wenn wir zufällig bei der religiösen Zeremonie einer nichtchristlichen Religion dabei sind.
Wer als Deutscher in Deutschland an einem christlichen Gottesdienst teilnimmt, wird das Erlebte aber wohl eher nicht nur als bloße Folklore in sich aufnehmen. Da er auch sprachlich einiges mitbekommen wird – Lesungen aus der Bibel, Gebete, Texte der Lieder, die Predigt –, wird er sich über manches wundern, über manches vielleicht innerlich den Kopf schütteln; manches wird ihn vielleicht im positiven Sinne innerlich anrühren, ihm neues Wissen und ihm das eine und andere Aha-Erlebnis vermitteln.
Wer mit negativen Voreinstellungen in einen Gottesdienst hineingerät oder zumindest skeptisch voreingestellt ist, wird sich in seinen Vorbehalten möglicherweise bestätigt fühlen. Wer sich in den Gottesdienst mit innerer Offenheit hineinbegibt, wird vielleicht zumindest unterscheiden zwischen dem, was ihm - im positiven und negativen Sinne - fragwürdig und dem, was ihm schön und wertvoll erscheint.
Die Predigt bietet die Möglichkeit, die denkbaren inneren Bewegungen der Gottesdienstbesucher zu berücksichtigen und zu ihnen Stellung zu beziehen. Es ist eine Kunst, mit ein und derselben Ansprache sowohl Menschen zufriedenzustellen, die einen Gottesdienst erstmals miterleben, und diejenigen, die seit Jahren an die Texte, Lieder und Vorgänge in einem Gottesdienst gewöhnt sind.
Der ungeübte Besucher möchte wohl eher, dass seine inneren Fragen aufgegriffen werden. Unter den geübten Gottesdienstbesuchern werden einige manches Unverständliche und Fragwürdige gewohnheitsmäßig und wohlwollend überhören und vielleicht eher beunruhigt sein, wenn in der Predigt allzu viel hinterfragt wird. Aber auch unter ihnen wird die Zahl derjenigen wachsen, die sich mit dogmatischen Wendungen nicht mehr zufriedengeben.
Der Verstehbarkeit gottesdienstlicher Elemente sind gewisse Grenzen gesetzt, da es im Gottesdienst letztlich um das Geheimnis des Seins geht. Wenn wir über unser Dasein nachdenken, stoßen wir an Grenzen, die wir nur noch mit - unbeantwortbaren - Fragen überschreiten können. Das Unerklärbare, Unbegreifbare, Geheimnisvolle zu gestalten ist wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes. Dies immer wieder bewusst zu machen, gehört mit zu den Aufgaben einer Predigt.
Die Predigten dieses Buches wie der ganzen Predigtsammlung sind von dem steten Bemühen geprägt, die inneren Fragen der Gottesdienstbesucher aufzugreifen. Ob diese sich dadurch angesprochen fühlten, vermochten nur sie selbst zu entscheiden.
Viel Freude beim Lesen!
Wolfgang Nein, Mai 2017
Langfristig glauben
14. Januar 1990
2. Sonntag nach Epiphanias
Hebräer 12,12-18(19-21)
Wir alle sind auf dem Weg. Jeder einzelne von uns ist auf dem Weg. Jeder von uns befindet sich in einer anderen Etappe des Lebens. Manche sind schon einen weiten Weg gegangen – über Höhen und durch Tiefen; manche blicken noch erwartungsvoll auf einen hoffentlich langen Weg voraus. Mancher von uns ist erfüllt mit Zuversicht und Tatendrang. Vielleicht sind andere unter uns müde, ohne Perspektive, ohne die Kraft zu hoffen und einen anderen, verheißungsvolleren Weg zu gehen.
Der Schreiber unseres Hebräerbriefes wendet sich an Menschen, die sich offensichtlich in der zuletzt beschriebenen Verfassung befinden. Ihnen möchte er etwas sagen. Für diejenigen unter uns, die sich gerade in einer aktiven, hoffnungsfrohen Phase befinden, lohnt es trotzdem zuzuhören. Denn jeder von uns kann einmal in den Zustand der Resignation, der Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit geraten.
„Richtet auf die erschlafften Hände und die müden Knie“ – mit diesen Worten ermuntert der Schreiber unseres Briefes seine Adressaten. Der bloße Appell ist sicherlich noch keine Hilfe. Denn der Betroffene wird sich fragen: „Ja, wie denn, warum denn, woher soll ich die Kraft nehmen?“ Es ist überhaupt ein schwieriges Unterfangen, einem deprimierten, niedergeschlagenen Menschen aufzuhelfen. Nicht nur aufmunternde Worte, sondern auch stichhaltige Argumente scheinen da oftmals auf unfruchtbaren Boden zu fallen. Als wir im September mit unserem Chor in der DDR waren, bekamen wir durchweg düstere Prophezeiungen über die zu erwartende weitere Entwicklung zu hören. Wenn erst einmal der 40. Jahrestag der Gründung der DDR vorüber wäre, dann würde alles noch schlimmer und die Grenzen vollkommen geschlossen werden. Darum versuchten noch so viele Menschen, rechtzeitig in den Westen zu gelangen. Nach vierzig Jahren Negativerfahrung mit dem dortigen Regime war keine Hörbereitschaft mehr da für Worte der Zuversicht und der Hoffnung. Das mochte sich kaum einer vorstellen, dass sich da drüben jemals – im besseren Sinne – etwas ändern würde.
In bestimmten Situationen klingen aufmunternde Appelle – und auch Argumente – hohl. Von den Betroffenen mögen sie wie Hohn empfunden werden – aus dem Munde dessen, so empfinden sie es, der nicht weiß, wovon er redet, weil er eben in einer anderen Situation lebt.
Mit solchen Reaktionen der inneren Abwehr musste gewiss auch der Schreiber unseres Hebräerbriefes rechnen. Er unternimmt es trotzdem, seinen Adressaten Mut zu machen und seinen Aufruf zur Hoffnung auch mit Argumenten zu unterlegen.
Wir wissen nicht genau, welches die Probleme der Menschen waren, für die dieser Brief damals bestimmt war. Es handelte sich um eine oder mehrere christliche Gemeinden der 3. oder 4. Generation in den 80er/90er Jahren. Die frühen christlichen Gemeinden hatten es sehr schwer. Sie mussten sich gegen eine feindselige Umgebung behaupten, waren von Verfolgungen bedroht, aber durchaus auch von inneren Spannungen und Spaltungen. Und nicht zuletzt auch von Enttäuschungen über unerfüllte Erwartungen. Sie hatten sich unter Gefahr für Leib und Leben und unter Hintanstellung ihrer gesellschaftlichen Sicherheiten für den Glauben an Christus entschieden unter der Annahme, dass er selbst bald wiederkehren und die Herrschaft Gottes errichten würde.
Diese Wiederkehr blieb aber aus. So wurde ihre Geduld strapaziert. Und die Frage machte sicherlich vielen zu schaffen, ob die mit Christus verbundene Verheißung sich jemals erfüllen würde. Christus rückte für sie in die Ferne und das Naheliegende gewann zunehmend an Bedeutung.
Das ist mit dem Hinweis auf Esau gemeint, der sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkaufte. Sie erinnern sich vielleicht an die beiden Söhne Isaaks. Jakob, der nur um Augenblicke Jüngere der beiden Zwillinge, hatte ein Linsengericht zubereitet. Als Esau ihn bat, davon essen zu dürfen, gab Jakob ihm unter der Bedingung davon ab, dass Esau ihm dafür den Erstgeburtssegen abtreten würde. Für uns ist dieses Tauschgeschäft schwer nachvollziehbar. Entscheidend ist, dass Esau um des kurzfristigen Vorteils willen – er wollte seinen Hunger stillen – auf etwas verzichtete, was ihm erst in der Zukunft zuteil werden würde, nämlich die mit dem Segen seines Vaters verbundene Verheißung eines großen und wohlhabenden Volkes: „Möglicherweise sterbe ich sowieso bald, was hat mir dann der Segen genützt? So habe ich wenigstens meinen Hunger gestillt.“
Mangelnde Geduld war sicherlich das Problem derjenigen, an die sich der Schreiber des Hebräerbriefes wandte. Und da ihre Lebenssituation schwierig war, und ihre Gemeinschaft von außen und von innen bedroht war, vermochten sie nicht zu erkennen, dass sich bereits in ihrer – wenn auch beschwerlichen Gegenwart – ein Stück der Verheißung Gottes erfüllte.
Unser Briefeschreiber versucht aber, ihnen das plausibel zu machen. „Ihr macht schmerzliche Erfahrungen“, sagt er, „aber versucht doch einmal, eure Nöte in einem guten Sinne zu verstehen als etwas, was euch zwar Schmerzen bereitet, was euch aber dennoch nützt und voranbringen kann. Denkt einmal an einen Vater, der seine Kinder bestraft. Erleben die Kinder die Strafe nicht als eine schmerzliche Erfahrung? Und dennoch ist sie dazu bestimmt, dem Wohl der Kinder zu dienen. Das können Kinder nicht immer verstehen, weil sie den langfristigen Sinn nicht zu erkennen vermögen. Aber so betrachtet doch eure Leidenserfahrung: als etwas, was euch – bei allen Schmerzen – doch voranbringt, dem Ziel entgegen, das euch von Gott verheißen ist. Darum also, richtet die erschlafften Hände und die lahmen Knie wieder auf. Sammelt alle Kräfte, die in euch noch vorhanden sind und stützt euch gegenseitig und richtet euer Leben so ein, dass ihr mit den Beschwernissen zurechtkommt und ihr es euch durch eure Einstellung nicht noch selbst zusätzlich schwer macht. Strebt nach Frieden untereinander, sorgt dafür, dass keiner die Gemeinschaft vergiftet, und passt auf, dass sich nicht so eine Haltung der kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung breitmacht, wie Esau sie praktiziert hat. Ihr seid doch schon auf Jesus Christus zugegangen. Ihr habt doch schon einmal für wichtig befunden, was in ihm geschehen ist. Ihr habt den Segen der Gnade doch schon sehr zu schätzen gewusst und euch deshalb für ihn entschieden.“
Unser Briefeschreiber versucht, seinen Lesern die Bedeutung Jesu Christi noch einmal nahezubringen. Er spricht sie dabei auf ihre Vergangenheit an, auf die Zeit, als sie noch nichts von Jesus Christus wussten, als für sie nur das Gesetz Mose galt, die harte Forderung der Gebote, die sie stets nur unzureichend zu erfüllen vermochten. Die Priester waren nötig, um ihnen durch Opfer und Riten die Schuld immer wieder zu abnehmen. Dann waren sie durch Christus befreit worden. Sein Tod am Kreuz war das Opfer, mit dem er sich selbst darbrachte, um ein für alle Mal alle Schuld zu sühnen. Aus dieser Vergebung heraus konnten sie nun leben und jeden Tag neu und fröhlich beginnen. Das hatten sie wahrhaftig als eine Befreiung verstanden und angenommen und hatten sich gemeinsam mit anderen auf den Weg in ein neues Leben gemacht.
Wir erleben schon im Alten Testament, wie die Begeisterung über eine neu erlangte Freiheit nachlässt, wenn die ersten Schwierigkeiten auftauchen. „Ach, wären wir nur bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben!“, jammerte das Volk, als es auf der Wanderung durch die Wüste Hunger leidet. Und so werden sich in den ersten christlichen Gemeinden in Krisensituationen manche gefragt haben, um welchen Gewinns willen sie all die Schwierigkeiten auf sich nehmen.
Vielleicht gibt es auch in der DDR Menschen, die sich angesichts der rasanten Umbrüche und ungewissen Zukunftsperspektiven dort schon insgeheim gelegentlich nach der ruhigen alten Zeit zurücksehnen, in der die Freiheit zwar beschnitten war, in der man aber wusste, woran man war.
Der Hebräerbrief ruft dazu auf, trotz aller Schwierigkeiten den Mut nicht sinken zu lassen und verlorenen Mut wieder neu zurückzugewinnen. „Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken!“ Uns tut eine solche Ermutigung sicherlich auch gut – persönlich wie auch gemeindlich und kirchlich. Wir sind nicht an Leib und Leben bedroht wegen unseres Glaubens. Die Bedrohung ist mehr unsichtbarer innerlicher Art. Sie besteht z. B. in einer Identitätskrise, die sich äußern kann etwa in der Frage: „Was macht eigentlich mein Christsein aus? Was unterscheidet mich als Christ von anderen Menschen? Habe ich den anderen etwas voraus oder ihnen etwas Besonderes zu bieten?“ In der Tat ist wohl vieles von dem, was einmal insbesondere Merkmal christlicher Ethik gewesen ist, in die Strukturen und Grundhaltungen unserer Gesellschaft eingeflossen, vor allem im sozialen Bereich, im Umgang mit den Schwachen der Gesellschaft. Da verschwimmen die Grenzen zwischen dem Christlichen und einer allgemein weltlichmitmenschlichen Art.
Aber dennoch – und auch, um gerade die Grundlage einer menschlichen Gesellschaft zu erhalten – ist es notwendig, dass wir uns auf die Quelle besinnen und uns aus ihr immer neu stärken lassen. Christus ist das „Ja“ Gottes zum Menschen. Und dieses „Ja“ zum Menschen ist ganz und gar keine Selbstverständlichkeit. Es hat in den Strukturen unserer Gesellschaft seinen Niederschlag gefunden. Aber es muss immer neu nachgesprochen werden und in Lebenswirklichkeit umgesetzt werden. Wir sind alle auf dem Weg. Wenn wir durch Tiefen gehen, haben wir es nötig, dass uns einer das „Ja“ Gottes zuspricht. Wenn wir über Höhen gehen, dann ist es unsere Aufgabe, denen Mut zuzusprechen, die darniederliegen. Und wo wir erkennen, dass unsere Gesellschaft dem Menschen die Achtung nicht zukommen lässt, die ihm von Christus her gebührt, da ist es unsere Aufgabe als Christen, als Gemeinde, als Kirche, das Wort Gottes einzubringen.
„Mission“ unter uns wird wieder eine Aufgabe
4. Februar 1990
Letzter Sonntag nach Epiphanias
2. Petrus 1,16-21
Der christliche Glaube ist nicht jedermanns Sache. Es gibt viele Menschen, die gar nicht wissen, worum es in unserem Glauben überhaupt geht. Die Zahl der jungen Menschen, die ohne jede Information über den christlichen Glauben groß wird, wächst. Wenn Sie z. B. heute einem Zwölfjährigen das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter erzählen oder vom Verlorenen Sohn, dann müssen Sie damit rechnen, dass er Ihnen sagt: „Nie gehört.“ Ich habe es schon erlebt, dass ich fragte: „Was feiern wir zu Weihnachten?“ und darauf keine Antwort bekam.
Warum erzähle ich dies? Weil diese Beispiele deutlich machen, dass wir zunehmend vor einer besonderen Herausforderung stehen: nämlich Menschen etwas vom christlichen Glauben zu erzählen, die keinerlei Vorkenntnisse haben, wo man also auf nichts aufbauen kann, wo die Verwendung christlicher Redewendungen, Formeln, Bilder nichts aussagt. Sie werden nicht verstanden. Die Herausforderung besteht also darin, etwas zu sagen, was für den anderen ganz neu ist, und dieses Neue verständlich, nachvollziehbar und annehmbar zu erklären, am besten so, dass er oder sie am Ende sagt: „Gut, das leuchtet ein, das finde ich wichtig, das nehme ich mir zu Herzen.“
Vor einer solchen Herausforderung standen auch die ersten Christen, als sie etwas von ihrem Glauben weitersagten. Sie konnten manchen für ihren Glauben gewinnen, sie mussten dann aber auch eine Erfahrung machen, die auch uns heute nicht erspart bleibt: dass Menschen, die zunächst gesagt haben: „Das leuchtet ein, das finde ich gut!“, nach einer gewissen Zeit in Zweifel geraten und noch einmal kritisch nachfragen: „Sag mal, du hast mir das alles so schön erzählt mit dem christlichen Glauben; das klang gut, aber die Wirklichkeit sieht doch etwas anders aus. Von christlicher Nächstenliebe hast du gesprochen, aber wo wird sie denn praktiziert?“ Es stellt sich also sehr schnell die Frage nach der Glaubwürdigkeit unserer Darstellung des christlichen Glaubens. Und wenn dann einer kritisch nachfragt, stehen wir vor der weiteren Herausforderung, nun doch noch überzeugende Antworten und Erklärungen zu finden. Dabei kann man dann auch auf Abwege geraten.
Der 2. Petrusbrief, aus dem unser Text stammt, ist der Versuch, solche kritischen Nachfragen zu beantworten. Er hat nicht jeden zu überzeugen vermocht. Das zeigt, wie schwierig die Überzeugungsarbeit ist.
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der christlichen Aussagen hat damals die Tatsache erregt, dass die Wiederkehr Christi ausblieb. Für uns ist das heute in dieser Form kein drängendes Thema. Aber versetzen wir uns einmal in die damaligen Christen. Jesus hatte verkündigt: „Kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“ Mit dem Auftreten Jesu verband sich die Vorstellung, dass jetzt große Umwälzungen stattfinden würden. Dann kam der Kreuzestod Jesu mit der Folge einer tiefen Enttäuschung und Verunsicherung auf Seiten der Jünger. Seine Anhänger fanden schließlich Trost in der Vorstellung, dass der auferstandene Christus in Kürze noch einmal erscheinen und dann das angefangene Werk vollenden würde.
Paulus macht mehrfach deutlich, dass er die Wiederkehr Christi noch zu seinen Lebzeiten erwartete – und damit die Vollendung der Herrschaft Gottes auf Erden. Die Wiederkehr Christi ließ aber auf sich warten. Und als schon 100-150 Jahre nach Jesu Tod verstrichen waren, fanden schließlich viele das Reden von einer Wiederkehr Christi nicht mehr glaubwürdig. Damit war für sie aber der ganze Glaube in Frage gestellt. Und die Motivation zu einem christlichen Lebenswandel schwand für viele dahin: „Es bleibt ja doch alles beim Alten“, war für viele die ernüchternde Erkenntnis. „Durch Jesus Christus hat sich nichts verändert und wird sich offensichtlich auch nichts verändern. Wozu also sich grundlos und zwecklos mühen?“
Der Schreiber des Briefes versucht, die Zweifler umzustimmen. Er schreibt einen Brief und eignet sich die Autorität des Petrus an. Es war aber nicht Petrus. Er beruft sich auf seine Augenzeugenschaft: Er sei bei der Verklärung Jesu auf dem Berg dabei gewesen und habe selbst die Stimme Gottes gehört, wie dieser sagte: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ Und er ermahnt zu dogmatischer Schriftauslegung: „Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet.“
Er ruft dann im weiteren Verlauf des Briefes auch dazu auf, das Ausbleiben der Wiederkehr Christi als Zeichen der Langmut Gottes positiv zu verstehen: Gott verlängere – zugunsten des Menschen – die Zeit der Bewährung. Jeder solle noch die Möglichkeit zur Umkehr haben.
Ob der Schreiber unseres Briefes mit diesen Argumenten überzeugen konnte, wissen wir nicht. Er sah sich mit einer erheblichen Enttäuschung konfrontiert. Die zu Christus Bekehrten hatten auf eine Veränderung der Welt durch ihn gehofft. Die Wirklichkeit sah aber nun anders aus. Nichts hatte sich verändert. Der Hoffnung für die Zukunft war der Boden entzogen: „Was hat uns der Glaube an Christus gebracht?", werden etliche gefragt haben. Und sie werden zu dem Schluss gekommen sein: „Uns sind leere Versprechungen gemacht worden.“
Vor diesem Problem steht jeder, der den christlichen Glauben weiterzugeben versucht. Das ist ein grundsätzliches Problem von Mission. Ich betone dies auch im Blick auf die heute beginnende Hamburger Missionswoche – das Problem also: Wie können wir unseren Glauben glaubwürdig weitergeben? Wie können wir von der wunderbaren Kraft unseres Glaubens reden, ohne falsche Erwartungen zu wecken, die früher oder später zu Enttäuschungen und zum Rückzug führen?
Ein befreundeter Pastor aus einer argentinischen Gemeinde – Sie können ihn morgen Abend kennenlernen – hat mir Folgendes erzählt: Er sagte: „An unserer Theologischen Hochschule bringen wir den Studenten die Theorie des christlichen Glaubens bei. Aber wie sieht es dann mit der Praxis aus? Um die Glaubwürdigkeit der theologischen Ausbildung zu erhöhen, haben wir nun Folgendes unternommen“, erzählte er weiter: „Wir haben für die Theologiestudenten Unterkünfte in einem Armenviertel besorgt. Dort wohnen sie für einige Zeit ihres Studiums und leben und arbeiten zusammen mit den Menschen, die täglich um ihr Überleben kämpfen müssen. Im Zusammenleben mit ihnen versuchen sie, gewisse Verbesserungen zu schaffen, indem sie z. B. einen Mittagstisch organisieren, damit die Ärmsten etwas zu essen haben, indem sie die Kinder zu sinnvollen Beschäftigungen anleiten, sich der Alphabetisierung und der Gesundheitsvorsorge u. ä. annehmen. Und abends fahren dann diese Studenten zur Theologischen Hochschule und hören sich die Theorie an. Sie hören jetzt mit ganz anderen Ohren. Sie sind jetzt selbstkritischer geworden und erleben das Problem der Glaubwürdigkeit am eigenen Leibe.“
Von der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit, der mitleidenden Solidarität zu reden und zu hören, ist eine Sache. Sie mit dem eigenen Leben zu bezeugen, ist eine andere Sache. Dass beides zusammenkommt, macht die Glaubwürdigkeit aus. Und das ist ein ganz schwieriges Unterfangen.
Wir stehen vor dieser Herausforderung in unserer eigenen Gesellschaft. Es ist eigentlich nicht nur eine Herausforderung gegenüber denen, die vom christlichen Glauben noch nichts wissen und denen wir etwas vermitteln möchten. Es ist auch eine Herausforderung uns selbst gegenüber: Wie können wir uns Christen nennen und uns dabei auch redlich bemühen, als Christen zu leben?
Der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Verheißung und Erfüllung wird nicht durch unseren bloßen Willen aufzuheben sein. Aber einfach abfinden sollen wir uns mit ihm nicht. Wir tun wohl daran, um mit den Worten unseres Textes zu reden, „dass wir auf Christus achten als auf das Licht, das im Dunkel unserer Welt aufgeleuchtet ist, und seinem Schein folgen auf das Ziel hin, das uns verheißen ist.
Fasten ja, aber glaubwürdig
25. Februar 1990
Estomihi
(Sonntag vor der Passionszeit)
Jesaja 58, 1-9a
Am Mittwoch, Aschermittwoch, beginnt die Fastenzeit. Sie endet Karsamstag, also am Sonnabend vor Ostern. Bis dahin sind es 46 Tage – oder 40 Tage -, wenn man die Sonntage nicht rechnet, eine Erinnerung an das vierzigtägige Fasten Jesu in der Wüste.
Unter evangelischen Christen ist der Fastenbrauch nicht sehr verbreitet. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Luther Vorbehalte gegenüber dem Fasten hatte, wie es zu seiner Zeit in der Kirche verstanden und praktiziert wurde. Er hat uns anempfohlen, die Wochen vor Ostern als Passionszeit zu betrachten, als eine Zeit also, in der wir Anteil nehmen am Leiden Jesu. Dazu ist das Fasten allerdings eine angemessene Form. Es kommt aber, wie gesagt, auf das „Warum“ und das „Wie“ des Fastens an. Wann immer es praktiziert wurde, ist es auch der Kritik ausgesetzt gewesen. Im Alten und im Neuen Testament finden wir mehrfach kritische Stellungnahmen zum Fasten, eben auch in unserem heutigen Text aus dem 3. Teil des Jesajabuches. Dieser Text hat uns durchaus etwas Aktuelles zu sagen.
Ganz fern ist uns das Thema Fasten ja doch nicht. Denn die Aktion „7 Wochen ohne“ stellt jeden von uns vor die ganz persönliche Frage: „Mache ich da mit? Wenn ja, warum und wie? Wenn nein, warum nicht?" Immerhin sollen nach den Erfahrungen der letzten zehn Jahre etwa zwei Millionen Menschen an dieser Aktion beteiligt sein. Also befassen wir uns einmal in den nächsten Minuten mit diesem Thema.
Zunächst: Was hat der Jesajatext am Fasten auszusetzen? Der Prophet zitiert seine Zeitgenossen, die er hat sagen hören: „Warum, Gott, fasten wir und du siehst es nicht? Warum, Gott, tun wir Buße und du merkst es nicht?“ Offenbar haben sich die Mitmenschen des Propheten vom Fasten etwas Konkretes versprochen: eine Gegenleistung Gottes für ihre religiöse Leistung. Wie diese Belohnung hätte aussehen sollen, können wir dem Text nicht entnehmen. Vielleicht ging es mit dem Wiederaufbau des Tempels nicht zügig voran. Es handelt sich ja hier um Menschen, die aus dem babylonischen Exil in ihre Heimat zurückgekehrt waren und dabei waren, ihre Stadt Jerusalem und den zerstörten Tempel wieder aufzubauen und das gemeinschaftliche Leben wieder neu zu ordnen. Das war gewiss keine leichte Aufgabe. Wir erleben in diesen Monaten hautnah, wie schwierig ein Umbruch und Neuanfang in einem Land ist.
Das Fasten wurde damals geübt an bestimmten Festtagen, Gedenktagen nämlich, die an die Zerstörung Jerusalems und des Tempels erinnern sollten. Und da das Fasten eine Art Opfer ist, ein persönliches Opfer, das u.a. in der Einschränkung der Mahlzeiten besteht, wird es viele gegeben haben, die zu solchem Opfer nur bereit waren unter der Voraussetzung, dass sich der Verzicht auch lohne, dass sich der Herr des Schicksals durch ein bußfertiges Volk z. B. dazu bewegen ließe, die menschlichen Bemühungen um einen Wiederaufbau des Landes mit Erfolg zu krönen. „Warum, Gott, fasten wir, und du siehst es nicht? Warum, Gott, tun wir Buße, und du merkst es nicht?“ Der Erfolg schien sich noch nicht eingestellt zu haben, wie diese Vorhaltungen zum Ausdruck bringen.
Martin Luther hatte sich gegen dieses Verständnis des Fastens gewandt. Fasten kann nicht den Sinn haben, sich Gott durch ein gutes Werk gefügig machen zu wollen. Aber dies ist nicht der Punkt, an dem der Prophet seine Kritik ansetzt. Er hält seinem Volk vielmehr vor: Eure religiöse Übung und eure Lebenspraxis stehen in krassem Widerspruch zueinander. Im Fasten ist euch Gottes Urteil wichtig – da wollt ihr gelobt und belohnt werden. Aber in eurem Verhalten gegenüber euren Mitmenschen, da ist euch Gottes Urteil offenbar vollkommen unwichtig; da ist euch sein Wille gleichgültig. „Als Geschäftsleute treibt ihr eure Arbeiter auch an den Fastentagen zur Arbeit an, ergeht ihr euch in Streit und Zank und schlagt zu mit roher Gewalt.“ Besteht denn allein darin das Fasten, dass man die religiösen Riten genau beachtet? „Nein“, sagt der Prophet, „das ist vielmehr ein Fasten, wie Gott es liebt: dass ihr die Fesseln Unschuldiger löst, die Versklavten freilasst, den Hungrigen Brot gebt, die Armen aufnehmt, sie kleidet und ihnen ein Zuhause gebt und den hilfsbedürftigen Mitmenschen nicht im Stich lasst. Wenn du dann Gott anrufst, wird er dich hören und dir Gutes zuteil werden lassen.“
Wie gesagt: mit diesem Nachsatz hatte Luther seine Schwierigkeiten; wir werden darauf zurückkommen müssen. Aber der Hauptgedanke: Das Fasten als religiöse Übung gerät dann ins Zwielicht, wenn es im Widerspruch zu einem menschlichen zwischenmenschlichen Verhalten steht, dieser Hauptgedanke fordert doch zur Zustimmung heraus. Denn es ist ein und derselbe Gott, um den es geht. Es kann nicht sein, um das einmal auf uns zu beziehen, dass wir hier in der Kirche in der religiösen Feier Gott huldigen und auf der Straße seinen Willen missachten.
Gott geht es um den Menschen, das streicht der Prophet heraus. Es geht Gott um Gerechtigkeit, um Rücksichtnahme, um Schutz des Schwachen, um Wohlergehen für jeden Einzelnen. Wem Gottes Wille wichtig ist, der hat hier seine Aufgabe: im zwischenmenschlichen Bereich. Wer sich da nicht bemüht, der ist in der Ausübung seiner religiösen Riten, seines Fastens, nicht glaubwürdig.
Ich sage bewusst: „Wer sich da nicht bemüht.“ Denn der Erfolg wird immer zu wünschen übrig lassen. Wenn einer mit seinem Mitmenschen z. B. im Streit liegt, auch schuldhaft im Streit liegt, dann kann es trotzdem sein, dass er ein glaubwürdiges Verhältnis zu Gott hat, wenn er etwa zum Ausdruck bringt: „Mir tut es leid, dass ich mit dem anderen nicht ins Reine komme. Ich sehe meine Schuld und möchte das Richtige tun; aber es gelingt mir nicht, über meinen eigenen Schatten zu springen.“
Das wahrhaftige Bekenntnis des eigenen Fehlverhaltens und der ehrliche Wunsch zur Umkehr sind schon eine ganze Menge. Da wird man dem Betreffenden nicht sagen können: „Lass das Beten, lass das Fasten – du wirkst unglaubwürdig.“ Nein, im Gegenteil – es sind ja gerade unsere Unvollkommenheiten, unsere Fehlhaltungen und Verfehlungen, unsere Sünde, biblisch gesprochen, die das Fasten und die Buße sinnvoll und nötig machen. Unglaubwürdig werden religiöse Formen erst bei demjenigen, der sich in seinem konkreten zwischenmenschlichen Verhalten nicht einmal bemüht um die Verwirklichung dessen, was dem Willen Gottes entspricht.
„Gott ist dem Sünder gnädig“, hat Martin Luther betont: Gott ist dem bußfertigen Sünder gnädig. Dem unbußfertigen Sünder nützt die Vergebung Gottes nichts; denn diese setzt die Bereitschaft zur Umkehr voraus. Sie ist als Angebot da. Aber sie kann ihre segensreiche Wirkung nicht entfalten.
Das ist es wohl auch, was der Prophet letztlich meint: Da, wo nicht nur im rituellen Sinne gefastet wird, sondern auch der ernsthafte Versuch gemacht wird, den Willen Gottes im zwischenmenschlichen Verhalten zu tun, da erst könnte jemand mit einer gewissen Berechtigung klagen: „Herr, wir fasten, und du siehst es nicht; wir tun Buße, und du merkst es nicht.“ So hat Hiob als guter und frommer Mann geklagt. An ihm sehen wir, dass auch der Gottwohlgefällige durch sein Verhalten die Besserung der Lebensverhältnisse nicht erzwingen kann. Aber er geht auf einem verheißungsvollen Weg.
Wie können wir sinnvoll und glaubwürdig fasten? Der Prophet plädiert dafür, religiösen Ritus und Lebenspraxis im Zusammenhang zu sehen als zwei Formen, dem Willen des einen und selben Gottes zu entsprechen. Er sagt nicht: „Lasst das Fasten, kümmert euch um den Mitmenschen.“ Eine solche Einseitigkeit kommt für ihn genauso wenig in Frage wie die Einseitigkeit, die er in seinem Text beklagt: der Ritus ohne die entsprechende Lebenspraxis. Wer es bei dem Ritus allein belässt, verkennt, dass es Gott um die menschliche Gemeinschaft geht. Wer es bei der Praxis der Zwischenmenschlichkeit belässt, verkennt, dass die Lebenswirklichkeit umfassender ist als unsere tägliche Lebenspraxis. Gerade die Unvollkommenheiten unserer Erfahrungswelt weisen über sich hinaus in Bereiche, die wir nur durch unsere Wünsche und Hoffnungen und unsere Klagen zu beschreiben vermögen.
Fasten als bloßer religiöser Ritus kommt unter evangelischen Christen wohl kaum vor. Wenn unter uns gefastet wird – etwa im Rahmen der Aktion „7 Wochen ohne“, dann geschieht dies wohl durchweg mit sehr praxisbezogenen Absichten. Es wird mit dem Fasten ein Einbruch versucht in gewisse Lebensgewohnheiten, die als schädlich, zumindest als problematisch erkannt worden sind, wie z. B. übermäßiger Konsum von Süßigkeiten, Zigaretten, Alkohol oder auch die Abhängigkeit vom Fernsehen ... Mit der Einsicht in persönliches Fehlverhalten und der Bereitschaft zur Umkehr ist dieses moderne Fasten wohl in vielen Fällen verbunden.
Die Teilnahme an diesem Fasten hat auch einen gemeinschaftsbezogenen Wert. Wenn der Einzelne seine Sucht unter Kontrolle bringt, entlastet er die Gemeinschaft. Vielleicht würde der Prophet noch die Frage stellen: „Und was macht ihr mit dem Geld, das ihr in der Fastenzeit durch euren Verzicht einspart? Lasst ihr es Programmen zur Linderung des Hungers in der Welt zukommen oder geht ihr nach der Fastenzeit von dem Ersparten einmal umso üppiger essen? Es wären bei einer täglichen Ersparnis von 1,- DM und 2 Millionen Fastenden immerhin an die 100 Millionen DM. Aber vielleicht würde der Prophet diese Frage auch nicht stellen in Anerkennung der guten Wirkung, die diese moderne Fastenaktion auch so bereits erzielt.
Es ist ein guter und empfehlenswerter Schritt, in der vorösterlichen Zeit zu fasten, sich einen Verzicht aufzuerlegen, in der Einsicht, eine Verhaltensänderung nötig zu haben, um unserer selbst und um der Gemeinschaft willen. Ein solcher Verzicht ist gar nicht so einfach zu verwirklichen. Wir sollten uns dabei gegenseitig unterstützen, wir hier in der Gemeinde. Vielleicht sollten wir das einmal miteinander besprechen.
Über religiöse Unterschiede friedlich streiten
18. März 1990
Okuli
(3. Sonntag der Passionszeit)
1. Könige 19,1-8(9-13a)
Elia wollte seinem Namen alle Ehre machen. Es ist ihm aber nicht immer leichtgefallen. Elia, d. h. auf Deutsch: „Gott ist Jahwe“. Oder wenn wir den Namen so übersetzen würden: „El ist Jahwe“, dann würde das Programm Elias noch deutlicher werden. „El“ war der Name des obersten kanaanäischen Gottes, Jahwe war der Gott des Volkes Israel. Um die Anerkennung Jahwes als des obersten, des eigentlichen Gottes, ging es Elia.
In unserem Text spiegelt sich die Auseinandersetzung zweier Religionen: die Auseinandersetzung zwischen der Religion des Volkes Israel, das aus Ägypten in das Land Kanaan eingewandert war und sich dort niedergelassen hatte, und der Religion der im Lande Kanaan ansässigen Bevölkerung, der Kanaanäer.
Diese religiöse Auseinandersetzung mag uns auf den ersten Blick als ein Vorgang längst vergangener Zeiten erscheinen, der mit unserer heutigen Zeit nichts mehr zu tun hat. Aber bei näherer Betrachtung wirft das Anliegen Elias doch Fragen auf, die auch heute gestellt werden, gestellt werden müssen, und auf eine Antwort drängen, die Frage zunächst: „Wer ist dein Gott?“ Und dann, wenn wir festgestellt haben, dass wir unterschiedlichen Gottesvorstellungen anhängen, die Fragen: „Wie gehen wir miteinander um? Wie verhalten wir uns zur Religion, zum Glauben des anderen? Welches Verständnis von Wahrheit haben wir? Meinen wir, im Besitz der Wahrheit zu sein, und meinen wir, die von uns erkannte Wahrheit dem anderen auferlegen zu müssen? Oder sollen wir alles gleich gelten lassen?“
Diese Fragen stellen sich für uns ganz aktuell, weil wir mit Menschen verschiedener Religionen zusammenleben, mit Moslems insbesondere, und weil wir durch unsere Reisen und die immer schnelleren Kommunikationsmöglichkeiten immer häufiger und intensiver Menschen anderer Religionen begegnen, und schließlich auch, weil wir als Christen in viele Konfessionen und Gruppierungen gespalten sind: in Katholiken und Lutheraner, Reformierte, Methodisten, Baptisten und so fort.
Die religiöse Auseinandersetzung ist im Laufe der Geschichte oft sehr heftig auch mit Mitteln der Gewalt geführt worden. Solche Vorgänge ereignen sich auch heute noch. Auch die biblischen Berichte des Alten und Neuen Testaments geben uns einen Einblick in solche Gewalttaten um des Glaubens willen, schreckliche Berichte. Auch das, was wir von Elia lesen, ist voll von Mord und Totschlag.
Dagegen spricht gerade der heutige Text eigentlich für einen schonenden Umgang mit dem religiös Andersdenkenden. Denn Elia spürt am eigenen Leib die Macht des Glaubenszweifels. Er hatte sich gerade zuvor mit vollem Engagement für seinen Gott Jahwe eingesetzt; lesen Sie das einmal selbst nach. In einem offenen Wettstreit hatte Elia erwirkt, dass Jahwe sich als der stärkere Gott gegenüber dem kanaanäischen Gott Baal erwies.