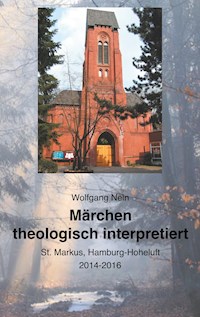Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kriege und Terroranschläge müsste es nicht geben, aber es gibt sie. Sie sind keine Naturereignisse. Sie gehen vom Menschen aus. Was sagt uns das über den Menschen? Mit dieser Frage und mit der Sehnsucht nach einem friedlichen Miteinander befassen sich die hier abgedruckten Predigten mit Bezügen zu konkreten Ereignissen der vergangenen fünf Jahrzehnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der göttliche Weg zum Frieden
11. April 1976
Palmsonntag / 6. Sonntag der Passionszeit
St. Jacobi, Lüdingworth
Sacharja 9,9-10
Die Kreuze auf den Gräbern mahnen uns alle
14. November 1976
Volkstrauertag
Gedenkfeier für gefallene Soldaten
Matthäus 5,21-24
Die endzeitliche Katastrophe ist menschenmöglich
29. Oktober 1978
23. Sonntag nach Trinitatis
2. Thessalonicher 2,1-12
Die Abgründe des menschlichen Wesens
2. September 1979
12. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 5,9
Nichtmilitärische Friedensarbeit stärken!
18. November 1979
Volkstrauertag
Andachten an Gedenksteinen in Gudendorf und
Franzenburg
Matthäus 5,9
Das Böse bekämpfen, nicht den Menschen
26. Oktober 1980
21. Sonntag nach Trinitatis
Epheser 6,10-17
Der Herr wird seinem Volk Kraft geben
;
der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden.
Juni - Juli 1981
Gemeindebriefandacht
Psalm 29,11
Kämpfen mit dem geistlichen Wort
19. Juni 1981
Kirchentag
Feierabendmahl
Epheser 6,10-17
Bemüht euch um Frieden mit jedermann und um
Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird.
September – Oktober 1981
Gemeindebriefandacht
Hebräer 12,14
Den Tod vorwegnehmen
14. November 1981
Geistliche Musik zur Friedenswoche
Ebenezer (ev.-meth.)
Psalm 90,12
Der Glaube ist nicht nur für das stille Kämmerlein
15. November 1981
Volkstrauertag
1. Petrus 3,8-17 / Matthäus 5,38-48
Keine Atomwaffen – „Ohne Wenn und Aber“
7. November 1982
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Friedensgottesdienst
Jesaja 41,10
Selig sind, die Frieden stiften
;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
November 1983
Gemeindebriefandacht
Matthäus 5,9
Risiko der Feindschaft – Risiko der Liebe
13. November 1983
Volkstrauertag
Friedensgottesdienst
Jeremia 8,4-7
Jesus Christus sprach:
Seht zu, dass euch niemand verführe!
Februar – März 1984
Gemeindebriefandacht
Markus 13,5
Christlicher Glaube und politische Mitverantwortung
11. August 1985
10. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 19,41-48
Als Christ die Gesellschaft mitgestalten
16. November 1986
Volkstrauertag
Römer 8,18-25
Wir sind entlastet und beauftragt
8. November 1987
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Bittgottesdienst für den Frieden
Römer 6,19b-23
Hoffen ohne Illusionen
13. November 1988
Volkstrauertag
Bittgottesdienst für den Frieden
Hesekiel 37,1-6
Friede und Gerechtigkeit
18. November 1990
Volkstrauertag
Jesaja 32,17
Manchmal bleibt nur das Beten
2. Februar 1991
Friedensgebet
Lukas 2,14
Umkehren, stille sein und hoffen?!
31. Dezember 1992
Altjahrsabend
Jesaja 30,15
Der Mensch – gut gemacht?
7. Mai 1995
Jubilate / 3. Sonntag nach Ostern
1. Mose 1,1-4a.26-31a;2,1-4a
Für den Frieden – ohne Krieg!
13. Mai 1999
Himmelfahrt
Kosovokrieg
Apostelgeschichte 1,9-11
„11. September 2001“
16. September 2001
14. Sonntag nach Trinitatis
Römer 12,21
Ethik für den Frieden
14. Oktober 2001
18. Sonntag nach Trinitatis
2. Mose 20,1-17
Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.
1. Dezember 2001
Gemeindebriefandacht
Sacharja 9,9
„Friede auf Erden!“
Dezember 2001
Gemeindebriefandacht
Lukas 2,14
Schluss mit dem Sündenbock!
15. September 2002
16. Sonntag nach Trinitatis
Erinnerung an den 11. September
Hebräer 10,35-36(37-38)39
Vertrauen und „Kein Krieg gegen den Irak!“
16. Januar 2003
Ansprache beim Neujahrsempfang
Das Böse mit Gutem überwinden
26. Januar 2003
3. Sonntag nach Epiphanias
Bibelsonntag und Aktion gegen den Irakkrieg
Römer 1,16
Himmlische Gerechtigkeit
16. Februar 2003
Septuagesimae / 3. Sonntag vor der Passionszeit
Matthäus 20,1-16
Gute und ungute Saat
23. Februar 2003
Sexagesimae / 2. Sonntag vor der Passionszeit
Lukas 8,4-15
Überwinde das Böse mit Gutem
Februar - März 2003
Gemeindebriefandacht
Römer 12,21
Drei Konzepte fürs Leben
9. Februar 2003
Letzter Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 17,1-9
Irakkrieg
April-Mai 2003
Gemeindebriefandacht
Römer 12,2
Das Heil kommt nicht aus der Gewalt
13. April 2003
Palmsonntag / 6. Sonntag der Passionszeit
Johannes 12,12-19
Kirche und Krieg
27. Juli 2003
6. Sonntag nach Trinitatis
Aktion Gomorrha
Matthäus 28,20a
Am Ende Freude und Frieden
31. Dezember 2003
Altjahrsabend
Internationales Taizé-Treffen in Hamburg
Lukas 2,14
Zeichen gegen die Ohnmacht
12. September 2004
14. Sonntag nach Trinitatis
Gedenken der Menschen in Beslan
Themengottesdienst „Liturgie, Rituale, Symbole“
Klagelieder 3,22-24.26.31.32
Friede auf Erden – wie schön wäre das!
5. Dezember 2004
Adventsfeier im Eppendorfer Bürgerverein
Lukas 2,14
Zwischenzeit zur Neuorientierung
8. Mai 2005
Exaudi / 6. Sonntag nach Ostern
60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
Johannes 7,37-39
Kein Frieden ohne Unfrieden
16. Oktober 2005
21. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 10,34-39
Hoffen und Handeln
13. November 2005
Volkstrauertag
1. Timotheus 2,1-4
Religion ist nicht nur Privatsache
13. August 2006
9. Sonntag nach Trinitatis
Jeremia 1,4-10
Pflänzchen der Hoffnung hegen
19. November 2006
Volkstrauertag
Micha 4,3
„Friede auf Erden allen Menschen!“
Dezember 2006 – Januar 2007
Gemeindebriefandacht
Lukas 2,14
Wird es immer Kriege geben?
16. November 2008
Volkstrauertag
Micha 4,3
Jerusalem – Stadt des Friedens?
16. August 2009
10. Sonntag nach Trinitatis
Israelsonntag
Lukas 19,41-44a
Krieg und Frieden
15. November 2009
Volkstrauertag
Matthäus 26,52
Anhang: „Frieden ist erreichbar“
(
Cuxhavener Allgemeine, März 1968)
Bibelstellen
Vorwort
Es gibt Probleme, die können wir nicht verhindern. Wir können uns auf sie einstellen und versuchen, bestmöglich mit ihnen umzugehen – ein Erdbeben zum Beispiel. Wir können das Problem erforschen und Frühwarnsysteme entwickeln. Wir können Gebäude bauen, die einem Erdbeben möglichst standhalten. Wenn es ein Erdbeben gibt, werden wir dafür niemandem einen Vorwurf machen können.
Es gibt aber auch Probleme, die müsste es nicht geben, aber es gibt sie und es wird sie wohl immer geben – Krieg zum Beispiel. Ein Krieg ist menschengemacht. Es liegt am Menschen, dass es Kriege gibt. Insofern könnte der Mensch dafür sorgen, dass es keinen Krieg gibt. Der Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt, dass es Kriege immer gegeben hat. Von daher legt sich die Vermutung nahe, dass es wohl auch künftig immer wieder Kriege geben wird.
Es gibt Kriege zwischen Nationen, es gibt Kriege interhalb von Nationen, Bürgerkriege, es gibt kriegerische Handlungen, es gibt Kriege mit konventionellen Waffen, mit Atombomben, mit chemischen und biologischen Waffen, es gibt Kriege mit Waffen neuerer Art – mit Drohnen zum Beispiel –, oder kriegsähnliche Handlungen, wie zum Beispiel durch Hackerangriffe im Internet. Es gibt auch – in Anführungszeichen – „Kriege“ zwischen Gruppen und zwischen Einzelpersonen, Kleinkriege, „Rosenkriege“. Und es gibt den „Krieg“ in der Gestalt terroristischer Aktionen. Es handelt sich immer um Maßnahmen, mit Gewalt unterschiedlicher Art Ziele zu erreichen.
Was sagt das über uns Menschen aus? Wir könnten uns darüber streiten, ob der Mensch gut oder böse ist, ob vielleicht einige gut, andere aber böse sind und ob die bösen vielleicht in der Mehrheit sind oder stärker sind als die guten. Wir könnten auch darüber nachdenken, ob der Mensch mit der Lösung mancher Konflikte einfach überfordert ist.
Einen Krieg mit militärischen Mitteln kann kein Einzelner ausführen, auch nicht eine kleine Gruppe. Damit es zu einem Krieg kommt, müssen viele mitmachen. Und es haben stets viele mitgemacht, auch wenn sie es vielleicht eigentlich gar nicht wollten. Und manche, vielleicht sogar viele, fanden es schließlich doch in Ordnung – nicht gut, aber in Ordnung –, dass Krieg geführt wurde, zum Beispiel weil sie keine andere Möglichkeit mehr sahen, ein bestimmtes Problem zu lösen – aus Gründen der Selbstverteidigung oder der Verteidigung Verbündeter oder Befreundeter oder aus Gründen der Vergeltung oder der Herstellung von Gerechtigkeit oder zur Wahrung von wirtschaftlichen oder politischen Interessen oder zur Durchsetzung vermeintlicher Rechte oder aus verletztem Stolz oder zur Abschreckung, um noch größeren Problemen vorzubeugen. Es wurde nicht selten auch Krieg geführt, um Land zu erobern. Es gibt Angriffskriege und Verteidigungskriege.
Weltweit betrachtet hat es immer Kriege gegeben, größere und kleinere, regionale, zwei große Kriege, die als Weltkriege in die Geschichte eingegangen sind. Auch nach dem 2. Weltkrieg sind – bis in die Gegenwart hinein – zahleiche Kriege geführt worden.
Es wird wohl kaum jemand behaupten wollen, dass es irgendwann keine Kriege mehr geben wird. Dennoch gibt es nach manchen Kriegen den Ruf: „Nie wieder Krieg!“
Die Sehnsucht nach Frieden im Kleinen wie im Großen ist wohl allenthalben vorhanden. Wird er jemals allenthalben Wirklichkeit werden? Schon diese Fragestellung wirkt fern der Realität.
„Der Frieden beginnt im Herzen“, ist eine sehr realistische Feststellung. Und wir müssen wohl eingestehen, dass in uns allen Kräfte am Werke sind, die wir manchmal nur schwer unter Kontrolle haben. Sie können in der einen oder anderen Weise – im Guten wie im Bösen – nach außen wirken, wenn es die äußeren Gegebenheiten zulassen. Während des Dritten Reiches und in der Ex-DDR haben viele Menschen inneren Kräften freien Lauf gelassen, derer sie sich im Nachhinein wohl geschämt haben dürften. Das gesellschaftliche System kann ebenso gute wie böse Kräfte in uns fördern oder im Zaum halten. Von daher ist es überaus bedeutsam, ein gesellschaftliches System zu schaffen und zu bewahren, das die guten Kräfte im Menschen fördert und die bösen Kräfte an ihrer Entfaltung hindert. Diesbezüglich kann Kirche einen wertvollen Beitrag leisten.
Zu den wesentlichen Inhalten des christlichen Glaubens gehört die Friedensbotschaft: „Friede auf Erden allen Menschen!“ Jesus Christus verkörpert diese Botschaft in mehrfacher Hinsicht. Er verhielt sich friedfertig – auch denen gegenüber, die ihm nicht wohlgesonnen waren, sondern ihm sogar nach dem Leben trachteten und ihn schließlich umbrachten. Er rief zu friedfertigem Verhalten auf, zu Verzicht auf Vergeltung, zur Bereitschaft, sich zu versöhnen, zu verzeihen, das Böse mit Gutem zu überwinden, auch dem Feind liebevoll begegnen. Er rief dazu auf, sich selbstkritisch zu prüfen, sich im Herzen zu besinnen auf das Gute, das wir empfangen haben, von Egoismus – im kleinen Persönlichen und Nationalen wie im großen Weltweiten – abzulassen und sich um das zu bemühen, was dem Wohl aller Menschen dient und dem Schöpfer die Ehre gibt.
Mit seinem Aufruf verkündete er kein politisches Programm. Er ging nicht davon aus, dass der Mensch durch dieses von ihm empfohlene Verhalten den Frieden auf Erden schaffen könnte. Mit seinem Aufruf – wie überhaupt mit seinem ganzen Leben und Wirken – brachte er vielmehr zum Ausdruck, wie er ein würdiges Menschsein im göttlichen Sinne verstand.
Den vermeintlichen göttlichen Willen auf dem Wege der Gewalt durch kriegerisches Vorgehen oder terroristische Akte erfüllen zu wollen, entspricht nicht der christlichen Botschaft. Historisch betrachtet hat es zwar auch im Bereich der Kirche schreckliche Fehlentwicklungen gegeben. Diese haben aber eben nicht dem eigentlichen Anliegen der christlichen Botschaft entsprochen.
In den Bemühungen um Frieden im Kleinen wie im Großen können bzw. könnten die Kirchen einen wertvollen Beitrag leisten. Sie haben neben der Friedensbotschaft – „Friede auf Erden allen Menschen!“ – und den vielen guten Worten und Geschichten der Bibel umfassende Möglichkeiten, vom kleinen Ritual bis zur weltweiten Organisation –, auf die Gefühle, das Denken und Verhalten von Menschen einzuwirken und so den guten Willen zur Förderung des Friedens zu stärken.
Kirche sollte sich in ihrem Beitrag nicht einschränken lassen durch politische Vorgaben. Sie sollte sich leiten lassen durch das Verständnis für die allen Menschen gemeinsame existentielle Situation in diesem Dasein auf diesem Erdball, von dem Bemühen, allen Menschen ein Leben in Würde und Wohlergehen zu ermöglichen. Sie sollte der Wahrheit und Wahrhaftigkeit dienen. Sie sollte Unterdrückung und Ausbeutung der Schwachen anklagen und das „Recht“ des Stärkeren ächten. Sie sollte Strukturen stärken, die das Gute im Menschen fördern und das Böse im Zaum halten. Sie sollte stets dazu beitragen, dass Situationen der Gewalt nicht eskalieren, dass auf Maßnahmen der Vergeltung verzichtet wird, und dass sich alle Anstrengungen darauf richten, konstruktive Lösungen von Konflikten zu finden und „das Böse mit Gutem zu vergelten“. Und sie sollte das Bewusstsein dafür stärken, dass der Frieden im Herzen beginnt, dass ein jeder Kritik an anderen mit Selbstkritik verbindet und anderen das Verhalten zukommen lässt, das er für sich selbst von anderen wünscht. Die Kirchen sollten darauf achten, dass in den Bemühungen um Frieden der Respekt vor dem Andersdenkenden und Andershandelnden und Leib und Leben des Anderen gewahrt bleiben.
Kirchen sollte auch in den Bemühungen um Frieden die Grenzen des menschlich Möglichen benennen. Sie sollten das Konfliktive im Guten aufzeigen und deutlich machen, dass auch der Friedenswillen zu Unfrieden führen kann. Sie sollten mithelfen, Illusionen von Hoffnung zu unterscheiden und die Kraft zur Hoffnung stärken.
Wolfgang Nein, Mai 2021
Der göttliche Weg zum Frieden
11. April 1976
Palmsonntag / 6. Sonntag der Passionszeit
St. Jacobi, Lüdingworth
Sacharja 9,9-10
„Er wird Frieden schaffen von einem Ende der Welt bis zum anderen.“ Das hat sich der Prophet von dieser armseligen Gestalt erhofft, die auf einem Esel in Jerusalem einziehen sollte. Diese Hoffnung ist von vielen Menschen geteilt worden.
Wie ist so etwas möglich? Wie kann es Menschen geben, die so etwas geradezu Widersinniges auch nur im Entferntesten für möglich halten? Dass jemand überhaupt Frieden in der ganzen Welt für möglich hält, darüber könnte man schon den Kopf schütteln. Aber dass jemand die Schaffung des Friedens von einer so armseligen Gestalt erwartet, das kann einen sprachlos machen.
Ich meine das ernst: Die Vorstellung, die der Prophet hier zum Ausdruck bringt, muss in Anbetracht unserer täglichen Erfahrungen fast lächerlich erscheinen. Sie ist in ihrer Naivität gerade zu erschütternd. Das ist jedenfalls der erste Eindruck. Wenn es bei diesem Eindruck nicht bleiben soll, dann müssen wir noch einmal kräftig nachdenken. Wie kann es überhaupt denkbar sein, die Schaffung weltweiten Friedens einer so unscheinbaren Gestalt zuzutrauen?
Zunächst einmal können wir feststellen, dass es dieses Zutrauen gab, und zwar nicht nur beim Propheten Sacharja. Im Neuen Testament begegnet uns der Friedensstifter in der Person Jesus Christus. Er ist, wie wir wissen, ganz ausdrücklich als ein Armer, ein Verfolgter, ein politisch Machtloser geschildert.
Der Evangelist Johannes, und nicht nur er, sieht in Jesus Christus den, von dem Sacharja in seiner Weissagung spricht. Wir haben es eben im Evangelium gehört. Jesus ist so auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen, wie es der Prophet angekündigt hatte. Wir haben es also nicht mit dem spleenigen Gedanken eines Einzelnen zu tun, sondern mit der Hoffnung zahlreicher Menschen zu verschiedenen Zeiten.
Waren diese Menschen Träumer? Waren sie weltfremd? Waren sie, wie wir heute sagen würden, unpolitisch? Kannten sie vielleicht die Spielregeln von Krieg und Frieden nicht, sodass sie sich ahnungslos solchen Illusionen hingeben konnten?
Wir können wohl davon ausgehen, dass diese Weissagung des Sacharja im vollen Bewusstsein der politischen Lage seiner Zeit entstanden ist. Jerusalem war zerstört worden, große Teile der Bevölkerung waren ins Ausland verschleppt worden. Wie sollte es angesichts solch trostloser Erfahrungen weitergehen? Würde die Zukunft eine Befreiung von der Fremdherrschaft bringen? Diese Fragen ergaben sich aus dem bewussten Erleben der politischen Wirklichkeit, allerdings aus dem Erleben politischer Ohnmacht heraus.
Zur Zeit Jesu war das ähnlich. Auch da war es die Fremdherrschaft, die römische Fremdherrschaft, an der keiner vorbeisehen konnte und die das politische Bewusstsein prägte. Nein, die Leute wussten schon, was los war. Und es gab sicherlich eine ganze Menge Leute, die in den kriegerischen Zeiten so dachten, wie wir es gelegentlich von Politikern hören: dass nämlich der Friede nur durch die Demonstration der Stärke zu erhalten sei. Nur wenn wir dem anderen deutlich vor Augen führen, wie stark wir sind, werde sich der andere vielleicht ruhig verhalten. Das klingt ganz einleuchtend.
Allerdings kann einen dieser Gedanke nur trösten, solange man stark genug ist, solche Stärke zu demonstrieren. Im übrigen ist das Wort „Frieden“ wohl auch zu schade für ein solches Gleichgewicht des Schreckens. Frieden – damit kann doch nicht gemeint sein, dass wir uns gegenseitig durch Angstmachen in Schach halten.
Nun war das Volk zu Sacharjas Zeiten sicherlich politisch ohnmächtig, und auch den Juden zur Zeit Jesu fehlte wohl die nötige Macht zur Demonstration der Stärke. So könnten wir vielleicht einfach sagen: In jener Situation der Ohnmacht mussten sich die Menschen eben nach einer neuen Hoffnung umsehen. Da ihnen die militärische Stärke fehlte, mussten sie die Rettung von irgendwo anders her erwarten. Da ist wohl etwas Richtiges dran.
Gerade dieses kleine jüdische Volk hat ja in vielen Jahrhunderten zahlreiche Niederlagen hinnehmen müssen. Das große und mächtige Reich unter David und Salomo war nur von verhältnismäßig kurzer Dauer gewesen. Die Zeiten der Zerstörung von innen und von außen waren stets viel länger gewesen.
Diese böse Erfahrung dürfte wohl tief in den Menschen verwurzelt gewesen sein: dass durch politische Macht, durch militärische Stärke der Frieden nicht zu erschaffen wäre.
Wenn wir einmal auf die weitere Geschichte, auch auf unsere Geschichte und auf unsere Gegenwart blicken – müssen wir da nicht feststellen, dass die Zeiten äußerlicher Ruhe immer nur verhältnismäßig kurz sind und solche Ruhe auch räumlich immer sehr begrenzt ist?
Ruhig ist es bei uns im Augenblick. Aber in wie vielen Teilen der Welt sieht es anders aus? Die Älteren unter Ihnen wissen aus eigener leidvoller Erfahrung, wie schnell militärische Stärke sich in Schwäche verwandeln kann. Auch wir müssten eigentlich bekennen, dass Frieden durch Gewalt weder zu schaffen noch dauerhaft zu erhalten ist. Trotzdem setzen wir in die Waffen immer wieder unsere Hoffnung. Wir haben das Geld, uns die furchtbarsten Waffen zu beschaffen und können uns so der Illusion hingeben, damit einen Beitrag zur Friedenssicherung zu leisten.
Das Volk, für das Sacharja sprach, und die Menschen um Jesus herum konnten sich mit solcher Macht nicht oberflächlich trösten. Sie mussten in sich gehen und ihre Lage als Menschen in dieser unruhigen Welt neu bedenken. Woher sollten sie den Mut und die Kraft nehmen, sich vertrauensvoll auf den Weg in die Zukunft zu machen?
Sie haben sich besonnen und ihre Besinnung ist nicht vergebens gewesen. Ihnen sind die Augen aufgegangen. Sie haben begonnen, das Leben und ihre Zukunft neu zu sehen.
Sie sind sehr bescheiden geworden. Sie haben eingesehen, dass sie sich selbst den Frieden nicht erschaffen können. Sie haben erkannt, dass sie aus eigener Kraft im besten Fall nur einen Zustand äußerer Ruhe für eine kurze Zeit und für wenige Menschen herzustellen vermögen. Aber etwas, dass man Frieden nennen könnte – und Frieden, das kann nur Frieden für alle Menschen bedeuten –, das zu erschaffen erschien ihnen nach allen Erfahrungen menschenunmöglich. Sie haben es deshalb, meine ich, zurecht aufgegeben, den Frieden aus menschlicher Anstrengung zu erhoffen. So kamen sie zu der Einsicht, dass er nur durch Gott Wirklichkeit werden könnte.
Dass diese Menschen dabei wirklich an Frieden gedacht haben und nicht nur an einen Zustand äußerlicher Ruhe, das erkennen wir an dem Friedensboten, den Gott zu ihnen schicken würde, an dieser armen Gestalt, die auf einem Esel nach Jerusalem einziehen sollte. Dieser Mensch ist das genaue Gegenteil von allem, was sie sonst als sogenannte Friedensbringer gekannt hatten.
In seiner Person selbst verkörpert er den Frieden. Er hat keine Waffen, er hat keinen Besitz und er hat keine politische Macht. Er verfolgt keine persönlichen Interessen, sondern will allen Hilfe bringen. Er will, dass alles Kriegsgerät abgeschafft wird, damit überall Frieden herrschen kann.
Ein solcher Mensch ist vielleicht leicht zu übersehen und zu überhören. Aber allein er ist glaubwürdig. Er verkörpert in der Tat den Frieden. Er rasselt nicht mit dem Säbel, um mit grimmigem Gesicht den Frieden zu verkünden, sondern er kommt ohne Waffen und ist freundlich.
Die Israeliten hatten erkannt, dass ein solcher Friede nicht durch Menschen erschaffen werden könnte. Das hatten sie durch leidvolle Erfahrungen gelernt. Solch ein Friede war nicht von dieser Welt, sondern etwas Göttliches, etwas, das nur von Gott zu erwarten wäre.
Und insofern waren sie ganz gewiss keine naiven Träumer, sie waren sich vielmehr des menschlichen Unvermögens und der menschlichen Ohnmacht voll bewusst und gaben sich keinen Illusionen hin. Aber sie wollten auch nicht einfach resignieren. Sie wollte nicht ohne Hoffnung in die Zukunft gehen. Wie könnten sie sonst auch leben?
So steht dieser friedliche Gottesbote vor ihnen, wie Sacharja ihn verkündet hatte. Auf ihn blicken sie in ihren schweren Stunden, um sich zu besinnen und sich stärken zu lassen. Er war zwar noch nicht leibhaftig da. Aber in ihrem Glauben, in ihren Hoffnungen hatte er schon den ersten Schritt in die Wirklichkeit hinein getan.
Als dann Jesus Christus da war, erinnerte man sich an die alten Weissagungen, an das Bild des Sacharja von dieser armen Gestalt auf dem Esel. Menschen in Israel erkannten: Dieser da, der muss der Friedensbote Gottes sein. Jesus Christus war arm. Er hatte keinen Besitz. Und was er hatte, das gab er denen, die es brauchten. Er hatte keine Waffen. Nur sein Wort. Und damit tötete er nicht, sondern verkündete er das neue Leben. Er hatte keine Macht, mit der er hätte strotzen und Angst einflößen können. Seine Macht war die Ohnmacht. Sie erfüllte die Menschen nicht mit Furcht, wohl aber mit Ehrfurcht.
Seine Erscheinung war eigentlich fast unscheinbar. Er zog durch das Land, heilte Kranke, tröstete Traurige, setzte sich mit den Verachteten der Gesellschaft an einen Tisch. Er wandte sich denen zu, die gemeinhin zu den unwichtigeren Gliedern der Gesellschaft zählten.
Er gab nichts darauf, mit den großen Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen, mit ihnen in Verhandlungen einzutreten. Er schien keinen Wert darauf zu legen, an die großen Schalthebel gesellschaftlicher Veränderung heranzukommen. Stattdessen widmete er sich mit Sorgfalt dem scheinbar Unwichtigen.
Und noch etwas ist bemerkenswert an ihm: Wo er selbst bedroht ist, sucht er nicht sich zu verteidigen. Zwar unterlässt er es niemals, in seinem Handeln und Reden deutlich zu machen, dass er den Frieden bringen will. Aber als er gefangen genommen und verklagt werden soll, flieht er nicht, sondern er setzt sich dem Unrecht aus. Er setzt damit seine Ankläger ins Unrecht. Er lässt sich unschuldig hinrichten, damit sie im Spiegel des Kreuzes sich selbst als die Ungerechten erkennen können.
Er überführt die Menschen freilich nicht, um sie nun für ihr Unrecht auf ewig verdammen zu können, sondern er will sie mit ihren eigenen Untaten erschrecken und zur Besinnung führen. Sie sollen die ganze Tiefe ihrer Schuld erkennen, um so vielleicht bereit zu werden zur Umkehr.
So hat uns Jesus Christus den Weg zum Frieden gewiesen. Nicht die Demonstration der Stärke kann uns zum Frieden führen, sondern die Einsicht in unsere menschliche Schuld und die Bereitschaft zur Umkehr.
Umkehr – was bedeutet das? Auch das erfahren wir durch Jesus Christus. Es bedeutet, sich auf Gottes Willen einzulassen, wie er uns in Jesus Christus begegnet, d. h. Gott zu dienen, indem wir die Menschen lieben. Und es bedeutet die Bereitschaft zu leiden, auch Unrecht zu erleiden.
Das ist wohl wahr, dass nach allem, was wir bisher aus der langen menschlichen Geschichte wissen, es unvorstellbar erscheint, dass der Friede auf Erden durch Menschen erschaffen werden könnte. Der Frieden ist etwas Göttliches, etwas – wir könnten sagen – Außerweltliches. Aber in der armseligen, leidenden Gestalt Jesus Christus ist doch ein Stück Frieden Wirklichkeit geworden. Darauf sollen wir blicken. Wenn wir daran unser Leben ausrichten, war das Werk Jesu Christi nicht vergebens.
Die Kreuze auf den Gräbern mahnen uns alle
14. November 1976
Volkstrauertag
Gedenkfeier für gefallene Soldaten
Matthäus 5,21-24
Einunddreißig Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs hat der Volkstrauertag seinen Sinn noch nicht verloren. In zweifacher Hinsicht ist er jetzt noch genauso sinnvoll wie zuvor: als Erinnerung an die grausamen Ereignisse, die Millionen von Menschen das Leben gekostet haben, und als Mahnung, als aktuelle Mahnung an uns, Ähnliches nicht wieder geschehen zu lassen.
Manche von Ihnen werden Angehörige im Krieg verloren haben. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch selbst einen körperlichen Schaden aus dem Krieg davongetragen. Mir ist aufgefallen, dass die Erinnerungen bei denen, die dabei waren, längst noch nicht erloschen sind. Einunddreißig Jahre sind zwar schon eine lange Zeit, aber bei vielen sind die furchtbaren Geschehnisse noch lebendig.
Vorgestern besuchte ich eine Familie südlich von Hannover. Der Mann hatte einen Arm im Krieg verloren. Wir sprachen über Sehenswürdigkeiten in Deutschland und über das Reisen. Er sagte, ins Ausland sei er nicht wieder gefahren, und auch das Steinhuder Meer habe er nicht wieder sehen wollen. Das hätte ihm damals gereicht.
Ich mochte nicht weiter nach Einzelheiten fragen. Die Kriegserinnerungen waren in ihm noch wach. Mich machte das betroffen. Er hat immerhin noch seine Familie; in die hat er sich ganz zurückgezogen. Von Politik will er nichts mehr wissen. „Wir Deutsche haben den Krieg nicht gewollt“, sagte er. Das waren die Politiker.
Ich habe mit ihm nicht weiter darüber gesprochen. Ihm war die Verbitterung abzuspüren. Er hat resigniert. Er ist mutlos geworden. Er hat sich zurückgezogen in seine Familie und in sich selbst. Das ist allzu verständlich. Diese Mutlosigkeit ist allerdings auch erschütternd.
Wir sind am Volkstrauertag dazu aufgerufen, uns auch einen Auftrag für die Zukunft geben zu lassen. Die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit, der Tod von 65 Millionen Menschen in zwei Weltkriegen, der Tod der Soldaten, der Männer, Frauen und Kinder, der Tod von Millionen von Juden, all das soll uns dringend dazu ermahnen, die Wiederholung solchen Geschehens zu verhindern.
Das ist eine Mahnung an unser ganzes Volk, aber auch an jeden Einzelnen von uns. Wir würden es uns zu leicht machen, wenn wir uns der Meinung anschlössen, dass es die Politiker seien, die für die Kriege verantwortlich sind. Wir alle tragen die Verantwortung gleichermaßen.
Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen: dass die Verantwortung für die Erhaltung des Friedens bei uns allen liegt. Das Leben so vieler Menschen darf nicht in den Händen weniger liegen. Zum Glück haben das viele in unserem Land nach dem letzten Weltkrieg erkannt. Das Bewusstsein der politischen Verantwortung jedes Einzelnen ist bei uns durch den letzten Krieg gewachsen. Es darf durch das Verstreichen von Jahrzehnten und durch die Nachkriegsgeneration nicht verloren gehen.
Bittere Erfahrungen führen nicht unbedingt zur Einsicht. Auf den 1. Weltkrieg folgte der zweite. Und seit dem zweiten hat es eine Unsumme örtlich begrenzter Kriege gegeben. Dennoch können wir auf die Erinnerungen nicht resigniert verzichten. Sie belegen dokumentarisch die Unendlichkeit menschlicher Schuld.
Keine theoretische Diskussion über das Wesen des Menschen könnte deutlich machen, in welch gewaltige Verirrungen Menschen sich versteigen können. Unsere Fantasie würde hinter der Wahrheit immer zurückbleiben. Der Volkstrauertag will die Erinnerungen wachhalten, um uns durch das Gedenken an die Toten zu mahnen.
Das eine Kreuz auf Golgatha, an dem Jesus Christus unschuldig hing, hat uns die menschliche Schuld wie einen Spiegel vor Augen führen sollen. Nun sind es schon viele Millionen von Kreuzen auf den Gräbern der Gefallenen. Wie viele werden noch hinzukommen müssen?
Der Blick in die Geschichte macht uns kaum Hoffnung, dass schon bald dauerhaft der Frieden in aller Welt einkehren werde. Wir wären aber schlecht beraten, wenn wir uns den Blick in die Zukunft von den schrecklichen Erfahrungen der Vergangenheit verfinstern ließen. Wir könnten unseres Lebens nicht mehr froh werden, wenn wir mit den Dokumenten menschlicher Schuld alleingelassen wären.
Die Millionen von Kreuzen klagen uns zwar an. Und jeder, der sich ihnen ehrlich aussetzt, muss zutiefst betroffen sein. Aber das Kreuz von Golgatha ist durch die Auferstehung Jesu Christi für uns zugleich zum Zeichen der Hoffnung geworden. Zum Zeichen der Hoffnung, nicht der Illusion.
Es gibt ja nicht nur das Schreckliche. Auch das andere ist Wirklichkeit geworden, das, was uns in Jesus Christus begegnet ist: der Verzicht auf Gewalt, der Verzicht auf Besitz, der Verzicht auf das eigene Recht – die Bereitschaft zu verschenken, die Bereitschaft zu vergeben, die Bereitschaft, Opfer auf sich zu nehmen.
Wir sind vielleicht geneigt, all das mit einer Handbewegung abzutun. Zu weltfremd mag das erscheinen, was Jesus Christus vorgelebt hat. Vielleicht ist es weltfremd. Dann aber nur in dem Sinne, dass es in unserer Welt so wenig zu finden ist, dass es uns fremdartig erscheint.
Von Jesus Christus wird gesagt: „Er kam wie ein Fremdling in die Welt.“ Das können wir im Neuen Testament lesen. Und auch Christen haben sich in der Nachfolge Jesu Christi als Fremdlinge verstanden. So sonderbar das zunächst auch erscheinen mag: Was durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist, ist Wirklichkeit geworden.
Wir haben dadurch die Möglichkeit der Wahl bekommen. Wir können weiterhin unser Leben, unser Denken und Handeln bestimmt sein lassen von der katastrophalen Erfahrung der Unmenschlichkeit des Menschen und können unser Wohl auch weiterhin durch die Demonstration von Macht zu sichern suchen. Wir können aber auch ganz auf Versöhnung setzen. Beides birgt Risiken in sich.
Das eine ist das Risiko des Hasses: die Gefahr, in die Grube zu fallen, die wir selbst gegraben haben. Das andere ist das Risiko der Liebe.
Jesus Christus ist dieses zweite Risiko eingegangen. Es hat ihn ans Kreuz gebracht. Aber er hat sein Leben nicht bereut. Durch seine beharrliche Zuwendung zu den Menschen trotz ihrer Schuld macht er uns Mut, uns von dieser neuen Wirklichkeit bestimmen zu lassen. Viele sind in seine Nachfolge eingetreten. Oder vielleicht sind es doch nicht so viele. Aber wir finden immer wieder Menschen, die darauf verzichten, sich selbst zu behaupten, sich zu verteidigen, sich durchzusetzen, die sich stattdessen anderen aussetzen und durch ihre eigene Schwäche andere dazu herausfordern, auf Gewalt zu verzichten.
Es ist ein Segen, dass wir die Zukunft nicht kennen. Es ist noch alles offen für uns. Das macht Hoffnung möglich.
Mit welcher Radikalität Jesus Christus uns zum Verzicht zur Gewalt herausfordert, geht aus dem Abschnitt der Bergpredigt hervor, den ich vorhin vorgelesen habe. Er greift das alte mosaische Gebot auf, das wir ja auch heute noch lernen: „Du sollst nicht töten!“, und führt es auf seine Art weiter. Jeder, der seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Schon der kleinste Streit mit dem Bruder, der sich in bloßen Beschimpfungen äußern kann – kleinen, kleinsten Streit schon hält er offenbar für ebenso verwerflich wie das Töten. Er fordert dazu auf, vor Gott nicht hinzutreten, ohne sich zuvor mit dem Bruder versöhnt zu haben.
Hier ergeht eine Forderung an uns, der wir nicht gerecht werden können. Wir kennen uns selbst gut genug und wissen, wie schwer es uns fällt, mit dem anderen ins Reine zu kommen. Das weiß auch Jesus Christus. Es geht ihm nicht darum, uns zugrunde zu richten mit einer Forderung, deren Sinn wir zwar einsehen, zu deren Erfüllung wir jedoch nicht imstande sind. Er hat ja immer zu den Menschen gehalten, die es nicht fertiggebracht haben, das zu tun, was sie zu tun schuldig waren.
Was er will, ist, uns die Richtung für unser Leben zu weisen. Er stellt das Bild von der Versöhnung vor uns hin und ruft uns auf, uns von diesem Bild leiten zu lassen. Er will unseren Blick wegreißen von der Trostlosigkeit unserer täglichen Erfahrungen. Er will uns aber auch warnen, uns in unserer Resignation mit der Einhaltung von Grundgeboten zu begnügen.
Das Töten nimmt seinen Anfang schon in der bloßen Missachtung des Mitmenschen. In dem Bild vom Weltgericht, wie wir es vorhin im Evangelium gehört haben, wird deutlich, wie das zu verstehen ist. „Was du einem der geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und was du einem meiner geringsten Brüder nicht getan hast, das hast du mir nicht getan.“
In jedem Menschen begegnet uns Jesus Christus. Jeder Mensch trägt etwas Göttliches in sich. Darum ist jede Missachtung eines anderen Menschen eine Missachtung Gottes. Nicht um die Verletzung von Gesetzen geht es, sondern um die Missachtung Gottes selbst.
Kriege sind eine höchst unpersönliche Sache. Menschen töten einander, die, wenn sie sich persönlich kennten, vielleicht gute Freunde wären.
Durch Jesus Christus sind wir dazu aufgerufen, jeden Menschen persönlich anzusehen, nicht als den Feind, den Soldaten, den Fremden, sondern als den Menschen, der wie ein Bruder Kind desselben Vaters ist. Wir alle haben Grund genug, in uns selbst zu gehen und uns kritisch zu fragen: Wie stehen wir zu unserem Mitmenschen? Erkennen wir in ihm Jesus Christus, den Sohn Gottes?
Kriege werden nicht, wie wir sagten, von Politikern gemacht, sondern jeder Einzelne von uns trägt seine Verantwortung. Der Volkstrauertag hat einen Sinn nur, wenn wir ihn als Aufruf zur persönlichen Umkehr verstehen. Die Kreuze auf den Gräbern mahnen uns, wie das Kreuz auf Golgatha, zur Einsicht unserer Schuld.
Die endzeitliche Katastrophe ist menschenmöglich
29. Oktober 1978
23. Sonntag nach Trinitatis
2. Thessalonicher 2,1-12
Vergangenen Dienstag hatte der evangelische Militärpfarrer in Nordholz die Cuxhavener Pastoren zu einem Gespräch über seine Arbeit eingeladen. Er gab uns dabei eine Einführung in die modernen Waffensysteme, mit denen die Soldaten zu tun haben, die er täglich betreut.
Es war für uns alle – ich darf wohl sagen – erschütternd zu hören, welche gewaltige Zerstörungskraft in diesen Waffen steckt, die in Ost und West entwickelt und massenhaft produziert worden sind. Sie reichen aus, alles Leben auf der Erde mehrmals nacheinander völlig zu vernichten. Das hatten wir natürlich auch schon vorher gewusst, aber wie es wohl jedem geht, denken wir an so schreckliche Möglichkeiten nur dann, wenn dazu ein besonderer Anlass besteht.
Unser Predigttext handelt auch von dem möglichen Ende der Welt. Allerdings spricht er in Bildern der damaligen Zeit. Für uns sind sie zunächst ein wenig schwer nachzuvollziehen.
Paulus warnt in seinem Brief an die Thessalonicher im zweiten Kapitel die Gemeinde vor der irrigen Vorstellung, dass irgendein Mensch das Datum für das bevorstehende Ende der Welt angeben könnte. Er selbst hatte dieses Missverständnis durch seine eigenen Worte vielleicht hervorgerufen. Er war nämlich einmal gefragt worden, wie das mit der Auferstehung der Toten bei der Wiederkehr Christi sei. Man ging ja damals davon aus, dass Jesus Christus ein zweites Mal auf Erden erscheinen und dann das Himmelreich vollenden würde. Alle Christen sollten dann in dieses Himmelreich hineingenommen werden. Und da stellte sich für viele die Frage, ob das nur für die dann noch Lebenden oder auch für die schon Verstorbenen gelten würde.
Paulus beruhigte die Gemüter, indem er darauf verwies, dass die Toten in keiner Weise benachteiligt wären. Die Toten würden zum ewigen Leben im Reich Gottes auferstehen.
Aus seinen Formulierungen schlossen die Thessalonicher wohl, dass die Wiederkehr Christi und damit das Ende der Welt und die Errichtung des Reiches Gottes unmittelbar bevorstünde. Paulus hat wohl in der Tat daran geglaubt, dass er die Zeitenwende noch zu seinen Lebzeiten erleben würde.
Was ihm aber offenbar große Sorgen bereitete, war die Tatsache, dass nun in der Gemeinde von Thessalonich Leute umhergingen, gewissermaßen mit dem Kalender in der Hand, die ihre Mitchristen mit genauen Berechnungen in Aufruhr versetzten. Gegen diese falschen Propheten und die Angstmache – wir kennen so etwas ja auch heute, denken wir nur etwa an die Zeugen Jehovas – richtet Paulus seine Worte. Er verweist darauf, dass vor der Wiederkehr Christi noch manches geschehen müsse. Und zwar müsse noch der Antichrist, der zur Zeit noch zurückgehalten werde, seine volle Macht entfalten und die Ungläubigen an sich reißen. Erst dann würde Jesus Christus wieder auftreten und allen bösen Mächten ein Ende setzen und die Gläubigen ins ewige Himmelreich führen.
Uns mögen die Bilder vom Ende der Welt und vom Anbruch des Gottesreiches altertümlich und wenig ansprechend erscheinen. Vielleicht wissen wir mit ihnen nichts anzufangen. Deshalb möchte ich das, was in diesen Bildern zum Ausdruck gebracht ist, noch einmal ein wenig anders formulieren.
Da ist zunächst die Rede von der Wiederkehr Jesu Christi, von der endgültigen Errichtung des Reiches Gottes, auch himmlisches Reich genannt. Damit ist die Hoffnung bezeichnet, die wir als Christen mit der Zukunft verbinden.
Jesus Christus, das ist doch derjenige, der uns durch sein Leben einen Blick hat werfen lassen in eine neue Welt, ein neues Leben, das so ganz anders und viel schöner ist als alles, was wir bisher gewohnt waren.
Es ist nicht die schöne heile Welt eines Aldous Huxley, der in einem kleinen Buch seine Vision von einer Gesellschaft dargelegt hat, in der durch Erziehungstechniken und durch chemische Mittel die Menschen in einen Zustand permanenter Zufriedenheit und Glückseligkeit versetzt werden, dabei allerdings das, was wir eigene Persönlichkeit nennen, völlig verlieren.
Jesus Christus hat bei seinem ersten Auftreten auf der Erde zwar auch manches Leid direkt beseitigt: Ein Blindgeborener konnte wieder sehen, ein Lahmer wieder gehen, Aussätzige wurden wieder rein. Aber diese direkte Hilfe nützte ja nur denen, die unmittelbar betroffen waren. Was er uns allen gegeben hat, ist die Erfahrung seiner Liebe zu den Menschen, seiner Gegenwart in der Not, seines Mitleidens und – und das vielleicht vor allem – seiner Vergebung.
Diese seine Solidarität mit allen Menschen, die in der einen oder anderen Weise am Leben leiden – und wer zählt sich nicht zu ihnen? – lässt uns das Leben neu sehen, mit hoffnungsvollen Augen.
Unser Blick ist nicht mehr gefangen vom Leid selbst, sondern wir durchdringen es und sehen schon sein Ende, weil wir nach der Erfahrung mit Jesus Christus Hilfe für möglich halten. Diese Hoffnung ist eine unwahrscheinliche Kraft, die das Leid überwinden hilft.
Ich sagte vorhin, dass die Vergebung Jesu Christi vielleicht das Wichtigste sei. Das habe ich deshalb gesagt, weil vielleicht das meiste Leid, das wir zu ertragen haben, durch menschliche Schuld verursacht ist. Unser größtes Problem sind wir selbst, und damit wir an Enttäuschung über uns selbst nicht zu Grunde gehen, noch die Augen vor unserer Schuld verschließen müssen, haben wir die Vergebung Jesu Christi als ständige Ermutigung, nach Niederlagen neu anzufangen.
Jesus Christus hat uns durch seine Liebe zu den Menschen und zum Leben das Leben mit neuen Augen sehen gelehrt. Mit ihm können wir nun besser leben als zuvor. Aber noch leben wir im Leid. Noch ist die Welt nicht besser geworden, als sie es vorher war. Nur dass wir eben besser mit ihr fertigwerden. Und so ist es von Anfang an christliche Hoffnung gewesen, dass das, was in Jesus Christus so schön angefangen hat, einmal vollendet werden wird, dass wir also nicht nur im Leid eine Stärkung haben, sondern dass das Leid überhaupt beendet sein wird.