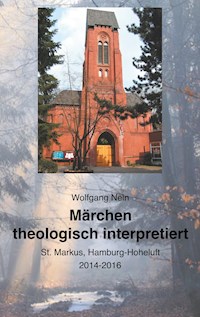Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die christliche Botschaft ist recht verstanden eine ganz wunderbare. Sie ist in ihrer Schönheit und Menschlichkeit wahrhaft göttlich und geradezu unglaublich. Sie kann Orientierung geben und eine wertvolle Lebenshilfe sein für alle, die vom Staunen über dieses geheimnisvolle Dasein erfüllt sind, die dankbar sind für die Gabe des Lebens, die die ambivalenten täglichen Erfahrungen mit Freude zum einen und Erschrecken zum anderen wahrnehmen und sich in den vielen Ungereimtheiten des Lebens um ein sinnerfülltes Leben bemühen. Die existentiellen Herausforderungen werden bleiben. Kirche hat darum eine bleibende Aufgabe. Die Bibel ist eine Schatzkiste voller guter Worte, die erfüllt sind von einem guten Geist. Das Wertvolle so weiterzugeben, dass es Menschen zur Lebenshilfe wird, dazu können Predigten beitragen. Möge es immer wieder gelingen. Die hier abgedruckten Predigten sind Teil einer achtzehnbändigen Predigtreihe, die alle vom Autor in den Jahren 1972 bis 2012 gehaltenen Predigten umfasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Strafe Gottes – Zeichen seiner Liebe?
22. Oktober 1972
21. Sonntag nach Trinitatis
Hebräer 12,4-11
Geschichte theologisch interpretieren?
12. November 1972
Drittletzter Sonntag nach Kirchenjahres
St. Abundus, Groden
Daniel 5,1-30
Hoffnung statt Resignation und Gewissheit
17. Dezember 1972
3. Advent
Offenbarung 3,7-13
Wunderberichte – Ausdruck vorhandenen Glaubens
14. Januar 1973
2. Sonntag nach Epiphanias
Johannes 2,1-11
Mit Gottvertrauen tun, was uns möglich ist
28. Januar 1973
4. Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 8,23-27
Jesus, der Sohn Gottes?!
11. Februar 1973
Letzter Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 17,1-9
„Als ob wir genau wüssten“
18. März 1973
Reminiszere
(2. Sonntag in der Passionszeit)
Matthäus 15,21-28
Freude trotz des Leids?
13. Mai 1973
Jubilate
(3. Sonntag nach Ostern)
Johannes 16,16-23a
Den Zuständen in der Welt liebevoll trotzen
24. Juni 1973
1. Sonntag nach Trinitatis
Johannistag
Jesaja 40,6-8
Die Hoffnung nicht aufgeben
22. Juli 1973
5. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 5,1-11
Das Leben auch mit seinen Belastungen annehmen
16. September 1973
13. Sonntag nach Trinitatis
Markus 7,31-37
Mitmenschlichkeit nicht vom Dank abhängig machen
30. September 1973
15. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 17,11-16
Sich das Leben immer neu schenken lassen
7. Oktober 1973
16. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 7,11-16
Gesetz nicht für sich und gegen den anderen missbrauchen
14. Oktober 1973
17. Sonntag nach Trinitatis
St. Abundus, Groden
Lukas 14,1-6
Sich leiten lassen vom Heil hinter dem Heillosen
11. November 1973
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Matthäus 24,15-28
Die Pflicht des Stärkeren
9. Dezember 1973
2. Advent
Römer 15,4-13
Freiheit der Liebe gegen Knechtschaft des Gesetzes
30. Dezember 1973
1. Sonntag nach Weihnachten
Emmauskirche
Galater 4,1-7
Nicht jeder Bibeltext enthält eine frohe Botschaft
3. Februar 1974
Letzter Sonntag nach Epiphanias
2. Petrus 1,16-21
Geltungsdrang kann „Nächstenliebe“ trüben
24. Februar 1974
Estomihi
(Sonntag vor der Passionszeit)
1. Korinther 13
Kann uns stellvertretendes Leiden helfen?
12. April 1974
Karfreitag
Andacht im Krankenhaus
Jesaja 53,4-5
Das Göttliche in Christus und dem Mitmenschen wahrnehmen
21. April 1974
Quasimodogeniti
(1. Sonntag nach Ostern)
1. Johannes 5,1-5
Alltägliches Leben als Gottesdienst
26. Mai 1974
Exaudi
(6. Sonntag nach Ostern)
1. Petrus 4,7-11
Das Leben und den Menschen liebevoll annehmen!
9. Juni 1974
Trinitatis
Römer 11,33-36
Von Gott können wir uns nicht emanzipieren
30. Juni 1974
3. Sonntag nach Trinitatis
1. Petrus 5,5c-11
Es ist nicht gleichgültig, wie wir leben
17. November 1974
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Volkstrauertag
2. Thessalonicher 1,3-10
Gott wertschätzen wird uns guttun
8. Dezember 1974
2. Advent
Maleachi 3,1-3b.19-22
Adventszeit – Vorfreude mit Ernst
15. Dezember 1974
3. Advent
Lukas 3,1-9
Freude der Kinder und Sehnsucht der Erwachsenen
24. Dezember 1974
Heiligabend
Lukas 2,1-20
Die Botschaft zu Weihnachten in Worten und Bildern
26. Dezember 1974
2. Weihnachtstag
Johannes 8,12-16
Bibelstellen
Vorwort
Diese Predigtreihe ist quasi im Rückwärtsgang entstanden. Band 18 ist der letzte in der Reihe, beginnt aber mit der ersten Predigt, die ich – 1972 – in der Öffentlichkeit gehalten habe. Der erste Band ist ohne Nummerierung, denn eine Reihe war bei seinem Erscheinen noch gar nicht geplant. Die ursprüngliche Idee war, ein paar Predigten als Buch im Familienkreis zu Weihnachten zu verschenken.
Aus dem ursprünglichen Gedanken entwickelte sich aus verschiedenen Überlegungen und Gegebenheiten heraus schließlich dieses Predigtprojekt. Grundlegend war die Möglichkeit, Bücher als books on demand bei Bod, Norderstedt, unkompliziert und überaus preisgünstig veröffentlichen zu können.
Für Predigten gibt es eigentlichen keinen Markt. Kirchenintern werden Predigten zwar oft als besonders wichtiges Element der kirchlichen Arbeit bezeichnet. Sehr verbreitet ist aber auch das Empfinden, dass es sich bei Predigten um eine „institutionelle Belanglosigkeit“ handele.
Wenn ein Verlag überhaupt Predigten veröffentlicht, dann solche von historischen und prominenten Autoren. Im Übrigen sind im Internet jede Menge Predigten frei zugänglich.
Für mich persönlich sind Predigten immer ein wichtiger Teil meiner beruflichen Tätigkeit gewesen, da sie sich für mein Verständnis mit den grundlegenden Fragen des Lebens beschäftigen und dies in Verbindung mit dem, was die biblischen Generationen erlebt, gedacht und geglaubt haben. Schon als Schüler habe ich im Gottesdienst stets mit Spannung auf die Predigt gewartet.
Als ich schließlich selbst zu predigen hatte, forderte mich die Aufgabe dazu heraus, mir eine eigene Theologie zurechtzulegen, die ich vor mir selbst und den Gottesdienstbesuchern gegenüber glaubwürdig würde vertreten können. Außerdem war mein Bedürfnis, meine Überlegungen so darzubieten und mich so auszudrücken, dass auch Menschen damit etwas würden anfangen können, die in Kirche und Theologie ungeübt sind und mit einer gewissen Skepsis am Gottesdienst teilnehmen. Es sollten sich aber auch Kircheninterne mit der Predigt wohlfühlen können.
Ich selbst bin von Haus aus nicht kirchlich sozialisiert, war aber stets erfüllt vom Interesse an den Grundfragen des Lebens. Mit Eintritt in den Ruhestand hat mein Interesse an der Predigt nicht nachgelassen. Ich gehe oft in Gottesdienste und höre mir an, was die Kollegen und Kolleginnen predigen.
Was und wie habe ich selbst gepredigt? Die Antwort auf diese Frage zu finden, war für mich ein weiteres Motiv, meine eigenen Predigten einmal geordnet – in Buchform – zusammenzustellen. Da ich alle Predigten aufbewahrt habe, kann ich nun selbst alles nachlesen und mir meine Gedanken über die Inhalte und die Formen machen. Dabei kann ich feststellen, dass ich im Großen und Ganzen den zu Anfang eingeschlagenen Weg ziemlich gradlinig weitergegangen bin.
Anfangs hatte ich bezüglich der Veröffentlichung der Predigten noch gewisse Schamgefühle. Aber nun sage ich mir im Sinne des Apostels Paulus: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht.“
Die christliche Botschaft ist recht verstanden eine ganz wunderbare. Sie ist in ihrer Schönheit und Menschlichkeit wahrhaft göttlich und geradezu unglaublich. Sie kann allen, die vom Staunen über dieses geheimnisvolle Dasein erfüllt sind, die dankbar sind für die Gabe des Lebens und die die ambivalenten täglichen Erfahrungen mit Freude zum einen und Erschrecken zum anderen wahrnehmen und sich in den vielen Ungereimtheiten des Lebens um ein sinnerfülltes Leben bemühen, Orientierung geben und eine wertvolle Lebenshilfe sein.
Die existentiellen Herausforderungen werden bleiben. Kirche hat darum eine bleibende Aufgabe. Die Bibel ist eine Schatzkiste voller guter Worte, die erfüllt sind von einem guten Geist. Das Wertvolle so weiterzugeben, dass es Menschen zur Lebenshilfe wird, dazu können Predigten beitragen. Möge es immer wieder gelingen.
Wolfgang Nein, Juli 2019
Strafe Gottes – Zeichen seiner Liebe?
22. Oktober 1972
21. Sonntag nach Trinitatis
Hebräer 12,4-11
Der Predigttext zum heutigen Sonntag handelt von der Strafe Gottes. Der Abschnitt steht im 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Der Autor fordert an dieser Stelle dazu auf, die Strafe Gottes als ein Zeichen der göttlichen Liebe zu verstehen.
Was empfinden Sie, wenn Sie diesen Text hören oder lesen? Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie sich über einige Stellen in diesem Text ärgern, zum Beispiel über den wie selbstverständlich angeführten Vergleich mit dem Vater, der seinen Sohn bestraft? Zunächst mögen sich die Frauen unter Ihnen daran stoßen, dass der Vater hier als Erzieher hingestellt wird, wo es doch meist vor allem Sie, die Mütter, es sind, die mit der Erziehung der Kinder zu tun haben. In dieser Frage müssen wir einfach bedenken, dass dem Verfasser des Textes eine ganz andere gesellschaftliche Ordnung vor Augen stand, als er den Brief schrieb, eine Ordnung nämlich, in der die Stellung des Vaters in der Erziehung überragend war.
In einem anderen Punkt hat unser Ärger schon etwas mehr Berechtigung, nämlich was das Strafen oder – wie es im Text noch provozierender heißt –, „die Züchtigung“ anbetrifft.
Strafen ist doch heute eine höchst umstrittene Sache. Geprügelt wurde früher häufig, wenn das liebe Kind nicht spurte – und zwar nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Lehrern. Diejenigen unter Ihnen, die meine Eltern und Großeltern sein könnten, Sie denken vielleicht manchmal noch mit einem leisen Seufzer an die gute alte Zeit, wo man unerzogenen Kindern noch mit einer ordentlichen Tracht Prügel drohen und sie manchmal sogar zur Raison bringen konnte. Aber im Allgemeinen steht man heute doch der Strafe – und vor allem der körperlichen Strafe – sehr skeptisch gegenüber. Das ist auch gut so.
Freilich, überall geht es nicht ganz ohne Strafe ab. Stellen Sie sich vor, die Gerichte wollten plötzlich darauf verzichten, Strafen zu verhängen! So weit haben es die moderne Psychologie und Pädagogik und was sonst für Wissenschaften mit diesem Problem zu tun haben, noch nicht gebracht.
Das ist also das andere, das manchen an diesem Text ärgern mag: Die Selbstverständlichkeit, mit der hier Strafe als Mittel der Erziehung hingestellt wird. Nun will der Text aber doch auf Folgendes hinaus: dass nämlich die Strafe Gottes ein Zeichen der göttlichen Liebe sei.
Wenn wir nun wieder an die Erziehung im Elternhaus denken, mögen wir an diesem Gedanken wohl etwas Sympathisches finden. Denn wenn die Mutter das Kind einmal straft, dann soll es diese Strafe nicht als Zeichen des Hasses, sondern als Zeichen der Liebe verstehen. Welcher Mutter tut es nicht selbst im Herzen weh, wenn sie zum Beispiel die Tochter bestraft, weil sie partout nicht beim Abwaschen helfen will und dafür abends mit traurigem Gesicht in der Ecke sitzt, weil sie den Krimi nicht sehen darf?
Kinder müssen erzogen werden. Wenn Eltern dann zum Mittel der Strafe greifen, mag das vielleicht nicht immer den neuesten Erkenntnissen der Erziehungswissenschaften gerecht werden, aber man wird den Eltern auch keinen bösen Willen unterstellen können. Wir müssen davon ausgehen, dass die Eltern tatsächlich gerade das Beste des Kindes im Auge haben. Motiv der elterlichen Strafe ist nicht Rache, sondern der Wille, das Kind in seiner Entwicklung zu fördern.
Auch im deutschen Strafrecht – das sei hier nebenbei erwähnt – ist man heute weitgehend vom Motiv der Vergeltung abgerückt. Wenn das Gericht heute eine Strafe verhängt, dann soll diese Strafe immer auch mit als ein Mittel dazu verstanden werden, den Bestraften zur Besserung seines zukünftigen Lebenswandels anzuhalten. Wie weit die gerichtlich verhängten Strafen diesem Ziel tatsächlich dienen und dienen können, das zu erörtern, ist hier nicht die richtige Stelle.
Wir haben nunmehr schon ein gutes Körnchen in unserem Text gefunden. Vielleicht finden wir noch ein weiteres. Da steht: „Alle Züchtigung aber dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein.“ Dem können wir wohl unbesehen zustimmen. Denn die Strafe fügt uns zunächst einen Schmerz zu, sei er körperlicher oder seelischer Natur.
Der Text geht dann einen Schritt weiter, auch den können wir wohl noch mit vollziehen, wenn es da heißt: „Aber danach wird sie (nämlich die Traurigkeit) geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit.“ Was soll das anderes bedeuten – jetzt wieder auf der Ebene der elterlichen Erziehung gesprochen –, als dass das Kind durch die Strafe – vereinfacht gesagt – zwischen Gut und Böse unterscheiden lernt, sodass das schmerzliche Ereignis nützliche Erkenntnisse einbringt.
Freilich, automatisch lässt sich ein Mensch nicht eines Besseren belehren. So, wie der eine Spruch sagt: „Not lehrt nicht nur Beten, sondern auch Fluchen“, so kann auch eine Strafe, statt zur besseren Einsicht zu führen, bei dem einen Aggressionen verstärken, bei dem anderen in Resignation enden. Die Skepsis gegenüber der Strafe als Mittel der Erziehung rührt ja weitgehend gerade von dieser Befürchtung her, dass die Strafen letztlich mehr unerwünschte als erfreuliche Wirkungen haben.
Nun haben wir dem Text also einige gute Seiten abgewonnen, wenn wir auch gewisse Einschränkungen machen mussten. Wir könnten jetzt befriedigt den Schlusspunkt setzen, hätten wir bisher nicht eines völlig außer Acht gelassen, nämlich, dass unser Text nicht von der Strafe der Eltern oder des Lehrers oder sonstiger Mitmenschen spricht, sondern von der Strafe Gottes handelt. Hier tauchen die wahren Schwierigkeiten erst auf.
Dem Autor des Hebräerbriefes geht es in unserem Text darum zu zeigen, wie die Strafe Gottes zu verstehen ist: nämlich als ein Zeichen der göttlichen Liebe. Er will den Menschen, die er hier anspricht und die es in Sachen christlicher Glaube an Standhaftigkeit zu wünschen übrig ließen, sagen: Ihr, die ihr von Verfolgungen bedroht seid, ihr werdet demnächst dem Tod ins Auge sehen müssen. Werdet dann nicht schwach! Lasst euch nicht abschrecken und verzagt nicht! Die Strafe Gottes, die mit der Verfolgung kommt, wird zwar schmerzlich sein, aber sie wird euch letztlich dem Himmelreich näherbringen.
Hier wird kein Zweifel daran laut, dass eine Strafe Gottes im Verzuge ist. Es geht nur um das rechte Verständnis der göttlichen Strafe. Aber wie steht es mit uns? Für uns liegt hier doch ein ganz grundsätzliches Problem. Ich meine nicht nur, dass uns allein der Begriff Gott schon schwer zu schaffen macht. Nein, der Gedanke, dass es so etwas wie „Strafe Gottes“ geben soll, hat doch etwas Befremdliches für uns an sich. Oder geht Ihnen das nicht so? Wir kennen diesen Gedanken, aber er stößt eher auf Abneigung als auf Verständnis.
Als ich die Predigt vorbereitete, habe ich mich etwas umgehört zum Thema „Strafe Gottes“. Da sagte mir eine Frau: „Manchmal trifft es einen hart. Da verliert man plötzlich seinen Ehemann durch einen Unfall, man sitzt allein da mit seinen Kindern, und dann fragt man sich: Womit habe ich das verdient? Ich bin doch auch nicht schlechter als die anderen. Es gibt doch genug Leute, denen man Schlechtes nachsagen könnte, und denen geht es gut und immer besser. Wieso gerade ich? Womit habe ich das Unglück verdient? Wo bleibt da die Gerechtigkeit?“ Und dann sagte sie: „Strafe Gottes – wenn es so etwas gäbe, dann müsste das ja ein schlimmer Gott sein, der einem solche Ungerechtigkeiten zufügen kann.“
Diese Frau hat in vielleicht ganz typischer Weise reagiert. Vielleicht würden Sie jetzt Ähnliches sagen, wenn wir in einer Diskussionsrunde zusammensäßen, statt dass Sie der Predigt nur zuhören. „Womit habe ich das verdient?“ Wenn wir so reagieren, geraten wir in eine Sackgasse, dann hat die Vorstellung von einer Strafe Gottes nichts Sympathisches mehr an sich, und dann sind wir wohl nicht bereit, diese Vorstellung noch aufrechtzuerhalten.
Denn treiben wir das hinter dieser Reaktion stehende Verständnis von der Strafe Gottes einmal auf die Spitze und denken wir an die durch Contergan geschädigten Kinder! Womit haben diese Kinder das schwere Schicksal verdient? Sie haben sich doch noch gar nicht schuldig machen können! Das Unglück war über sie schon hereingebrochen, bevor sie überhaupt geboren waren. Es würde geradezu makaber klingen, hier davon zu reden, dass die Strafe ein Zeichen göttlicher Liebe sei.
Nein, so kommen wir nicht weiter. Wenn die Vorstellung von der Strafe Gottes noch eine Berechtigung haben und uns etwas Sinnvolles sagen soll, dann müssen wir anders argumentieren.
Die Krux der typischen Vorstellung von der Strafe Gottes liegt zunächst darin, dass sie die Strafe zu persönlich nimmt, dass sie nämlich eine Beziehung sucht zwischen dem Unglück und dem Lebenswandel der Person, die dieses Unglück getroffen hat. Eine solche Beziehung besteht bei den durch Contergan geschädigten Kindern jedenfalls nicht.
Das Unglück ist hier der körperliche Schaden. Die Geschädigten sind unschuldig und die Schuldigen – ich meine die gerichtlich Schuldigen – sind von dem körperlichen Schaden unbehelligt geblieben. Es gibt hier also offenbar niemanden, der zugleich geschädigt und schuldig ist. Wollen wir das Unglück als Strafe verstehen, so müssen wir jemanden finden, der zugleich geschädigt, d. h. gestraft, und schuldig ist.
Hier scheint mir das Problem zu liegen. Einen solchen Jemand gibt es nicht, es sei denn wir sind bereit, als Mitmenschen, schlichtweg als Mitmenschen das Leid der Kinder auch als unser eigenes Leid zu verstehen – sozusagen mitzuleiden – und die Schuld der gerichtlich Schuldigen auch als unsere eigene Schuld zu verstehen, uns mitschuldig, mitverantwortlich zu fühlen. Dann können wir das Unglück der Kinder auch als eine Strafe verstehen, eine Strafe über uns selbst und über jeden, der bereit ist, mitzuleiden und sich mitverantwortlich machen zu lassen.
Ein anderes Beispiel mag zeigen, worum es hier geht. Hungersnot in Indien. Die Hungernden sind die eigentlich Geschädigten. Sie sind aber nicht zugleich schuldig für die miserable wirtschaftliche Lage Indiens. Wer trägt die Schuld? Die indische Regierung? Hätten nicht die reichen Nationen der Erde die Möglichkeit, das Leid in Indien zu lindern? Wir können die Frage nicht verneinen. Wir sind Mitglieder einer reichen Nation. Sind wir bereit, mit den Hungernden Indiens mitzuleiden und uns für ihr Leid mitverantwortlich zu fühlen? Ich bin mir sicher, dass manche von Ihnen eine solche Mitverantwortung für sich bejahen.
Nun haben wir eine Schwierigkeit überwunden. Wir haben einen Weg gefunden, doch noch sinnvoll von der Strafe Gottes zu sprechen. Uns bleibt zu fragen: Welche Bedeutung hat nun das zentrale Thema des Textes, die Aufforderung, in der Strafe Gottes ein Zeichen der göttlichen Liebe zu sehen? Nun, wir sind hiermit aufgefordert, uns von dem Mitleid und der Mitschuld, die wir auf uns geladen haben, nicht erdrücken zu lassen, nicht zu resignieren und uns nicht von dem Weg abbringen zu lassen, den wir meinen gehen zu müssen, damit mehr Menschlichkeit verwirklicht werde.
Wenn wir das tägliche Leid, die immer neuen Unglücksfälle ignorieren und uns im Innersten nur berühren lassen, wenn wir selbst schwer getroffen sind und wenn wir in unserem eigenen Leid nur die Knute eines sich rächenden Gottes sehen und in Selbstmitleid verfallen, dann haben wir den Text sicherlich nicht recht verstanden. Leid und Unglück werden erst dann zu einem Zeichen der göttlichen Liebe für uns, wenn wir bereit sind, daraus als menschliche Gemeinschaft zu lernen. Wenn wir bereit sind zu fragen: „Was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir in Zukunft tun?“ Dann kann das Unglück letztlich doch zum Segen der Menschen werden. Es stellt sich dann dar als der schmerzliche Weg des Lernens durch eine Lehre nicht durch Worte, sondern durch leidvolles Erleben.
Diesen unbeirrten Blick nach vorn meint der Autor unseres Textes, wenn er die Gemeinde auffordert: „Dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasst!“
Geschichte theologisch interpretieren?
12. November 1972
Drittletzter Sonntag nach Kirchenjahres
St. Abundus, Groden
Daniel 5,1-30
Angesichts der vielen Ungerechtigkeiten in der Welt hat sich schon mancher gefragt: „Wo liegt da der Sinn? Völker bekriegen sich, reiche Länder beuten arme Länder aus, Leute mit Kenntnissen nutzen die Unwissenheit anderer aus. So war es schon immer. Wird es immer so bleiben? Wird es jemals Gerechtigkeit geben?“ Diese Frage stellt sich verständlicherweise besonders dringend dann, wenn unsere eigene Unkenntnis einmal ausgenutzt worden ist.
In einer Situation des Leids befanden sich wohl auch die Leute in Jerusalem so etwa 160/170 Jahre vor der Geburt Christi. Sie litten unter der Unterdrückung eines fremden Königs, des Königs von Syrien. Antiochos hieß er. Er hatte den Tempel von Jerusalem plündern lassen und hatte jeden Gottesdienst in der Öffentlichkeit verboten. Die Leute in Jerusalem waren verbittert. Sie fragten sich: „Wohin soll das noch führen?“ Die Unterdrückung hatte schon viele Jahre gedauert. Sie stellten deshalb verzweifelt die Frage: „Gibt es überhaupt Gerechtigkeit? Haben es die Mächtigen in der Hand, über unser Schicksal nach Gutdünken zu entscheiden? Bestimmen sie eigenmächtig und unwiderruflich den Lauf der Dinge?“
Die Menschen, die diese Fragen stellten, wollten die Fragen nicht bejahen. Sie konnten es nicht glauben, dass irgendwelche Menschen – und seien es auch Könige – so mächtig sein sollten, dass sie selbst die Herren des Schicksals wären. Sie konnten es nicht glauben und hofften darum auf bessere Zeiten. Sie suchten Trost, um an der bestehenden Lage nicht zu verzweifeln.
Sie suchten Trost und fanden ihn in einer Legende, einer Legende, die so wundersam klingt, dass man meint, sie sei für Kinder erdacht. Aber sie sollte doch Erwachsenen Trost spenden. Wenn ich diese Legende gleich erzähle – sie ist nämlich unser heutiger Predigttext –, dann müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr von ihren farbigen Einzelheiten fesseln lassen. Denn wichtiger ist es, auf das zu achten, was der Text uns heute noch an Bedeutungsvollem zu sagen hat. Was das ist, will ich vorweg wenigstens in einem Satz sagen, nämlich dies: Das Geschick der Menschen liegt in der Hand Gottes, Gott lenkt die Welt und nicht der Mensch. Gott setzt Könige ein und setzt sie ab. Gott bestimmt den Lauf der Geschichte. Darum geht es in diesem Text.
Doch lassen Sie mich nun diese Legende erzählen. Dann können wir uns weiter Gedanken darüber machen, was wir mit der Vorstellung, dass Gott die Geschichte lenke, anfangen wollen. Der Text steht im Alten Testament im 5. Kapitel des Danielbuches. Er nennt drei Personen.
Die eine ist Nebukadnezar. Sie haben von ihm schon gehört. Er war ein mächtiger König, ein König der Babylonier. Die Hauptstadt seines Reiches, die Stadt Babylon, war in aller Munde wegen ihres Wohlstandes und wegen des derben und zügellosen Lebens ihrer Bewohner. Nebukadnezar war berühmt und berüchtigt zugleich. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er ehrte, wen er wollte, und er demütigte, wen er wollte. Er war allgewaltig. Das dachten jedenfalls viele Menschen, und das dachte auch Nebukadnezar von sich selbst. Er wurde stolz und hochmütig. Als ihm Ruhm und Macht zu Kopfe gestiegen waren, stieß ihn Gott von seinem königlichen Thron. Nebukadnezar verlor seine Ehre. Farbig schildert die Legende seinen Niedergang:
„Er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, und sein Herz wurde gleich dem der Tiere, und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott, der Höchste, Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will.“
So erging es Nebukadnezar. Er musste erkennen, dass kein König, auch nicht der mächtigste, den Lauf der Dinge nach Gutdünken bestimmen kann, sondern dass auch sein Schicksal in der Hand eines noch Mächtigeren, in der Hand Gottes liegt.
Die zweite Person, die man als den Held unserer Legende bezeichnen könnte, ist Daniel. Sein Schicksal war mit dem Leben Nebukadnezars eng verknüpft. Nebukadnezar hatte Jerusalem zerstört. Das war genau im Jahre 587 vor der Geburt Christi. Die Bevölkerung der Stadt und des umliegenden Landes hatte er in sein eigenes Reich, nach Babylonien verschleppt.
Unter den Gefangenen befand sich auch Daniel, der zu der Zeit noch ein Kind war. Daniel hatte das Glück, zusammen mit einigen Gefährten direkt am Hofe des fremden Königs großgezogen zu werden. Er war für den Dienst am Königshof ausersehen. Durch allerlei wundersame Taten und durch die Unerschrockenheit, mit der Daniel für den Glauben seines eigenen Volkes in der fremden Welt des babylonischen Reiches eintrat, gelangte er bald zu Ruhm und Ehre. Auch unsere Legende erzählt von einer solchen wundersamen Tat Daniels.
Die dritte Person ist Belsazar. Auch er war ein König der Babylonier. Die Legende stellt ihn als Sohn Nebukadnezars vor. Ob diese Vater-Sohn-Beziehung historisch richtig ist, steht auf einem anderen Blatt. Wir haben es hier mit einer Legende zu tun, und Legenden nehmen es mit der geschichtlichen Wahrheit naturgemäß nicht so genau. Das Leben Belsazars ist es, in dem sich das Geschehen abspielte, von dem die Legende erzählt. Das war so:
„Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem, weggenommen worden waren; und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter.
Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Und der König rief laut, dass man die Zauberer, Wahrsager und Sternkundigen herbeiholen sollte. Und er ließ den Weisen von Babel sagen: Welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. Da wurden alle Weisen des Königs herbeigeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seinen Mächtigen wurde angst und bange.“
In dieser scheinbar aussichtslosen Lage wusste die Königin einen Rat. Sie erinnerte sich an die wundersamen Taten Daniels, dieses weisen Mannes aus dem fernen Land. Der König ließ Daniel vorführen und versprach ihm Reichtum und Macht für den Fall, dass er die Schrift lesen und deuten könnte. Daniel wies diese Angebote bescheiden zurück, erklärte sich aber bereit, die Bitte des Königs zu erfüllen. Er erinnerte den König an das Schicksal Nebukadnezars, den Gott wegen seines Hochmuts vom Thron gestoßen und gedemütigt hatte. Dann fuhr er fort:
„Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken; dazu hast du die silbernen, goldenen, bronzenen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch etwas wissen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben.
So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene mene tekel u-parsin. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben.“
Nachdem Daniel so die Bitte des Königs erfüllt hatte, machte der König sofort seine Versprechungen wahr und ließ Daniel die angekündigten Ehrungen zuteilwerden. Aber auch das in der geheimnisvollen Schrift angekündigte Ende des Königs ließ nicht lange auf sich warten. Noch in derselben Nacht wurde Belsazar getötet.
Was fangen wir nun mit dieser doch ganz aufregenden Geschichte an? Ist sie zu wundersam und anscheinend zu sehr auf kindliche Gemüter abgestimmt, als dass es sich lohnte, ernsthafte Gedanken auf sie zu verwenden?
Sehen wir von dem Legendenhaften einmal ab.
Beginnen wir auf der Negativseite und fragen wir uns zunächst, was uns an diesen Texten ärgert. Mit anderen Worten: Wie sollten wir diesen Text nicht verstehen?
Folgendes zum Beispiel mag uns stören: Da sind Menschen in einer Notlage. Sie nehmen sich diese Legende her, um sich damit zu trösten, dass Gott ihre Feinde zur Rechenschaft ziehen werde. Machen sich diese Menschen nicht etwas vor? Verschließen sie nicht die Augen vor den Realitäten? So mancher Feind hat doch einen totalen Sieg errungen und ist von jeder Rechenschaft verschont geblieben! Dafür liefert die Geschichte zahlreiche Beispiele. Denken wir nur einmal an die Indianer in Nordamerika. Sie sind von den weißen Einwanderern fast vollständig ausgerottet und enteignet worden. Sie werden ihre einstige Bedeutung nie wiedererlangen. Das an ihnen geschehene Unrecht ist nicht wiedergutgemacht worden. Ihre Feinde sind ungeschoren davongekommen und haben unwiderruflich gesiegt.
Dass Gott unsere Feinde vernichten und uns damit in unserer jeweiligen besonderen Not helfen und uns Gerechtigkeit verschaffen werde, das dürfen wir unter der Lenkung Gottes nicht verstehen. Man würde uns zurecht als fromme Träumer verspotten.
Wir müssten uns auch diese kritische Frage gefallen lassen: Ist denn diese Gerechtigkeit, die wir da von unserem Gott erwarten, überhaupt eine Gerechtigkeit? Müssten wir nicht richtiger „Parteilichkeit“ sagen? Denn wenn wir hoffen und in dieser Hoffnung einen Trost finden, dass Gott die anderen klein machen werde, um uns selbst wieder aufzurichten, dann erwarten wir doch eine einseitige, eine parteiische Hilfe Gottes. Oder könnten wir etwa meinen, gerechter zu sein als die anderen und von daher eine Bevorzugung Gottes verdient zu haben? In der Situation des Krieges hat mancher für die Vernichtung des Feindes gebetet. Wir dürfen aber doch nicht die Augen davor verschließen, dass Gott für alle Menschen da ist.