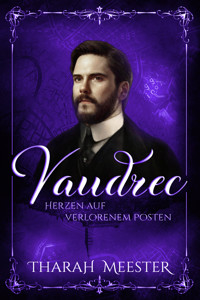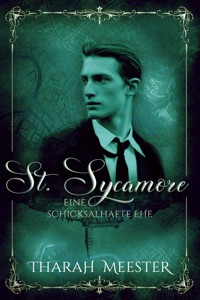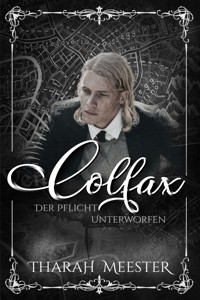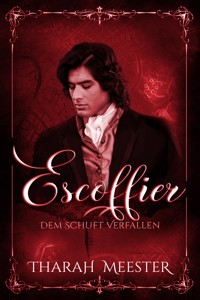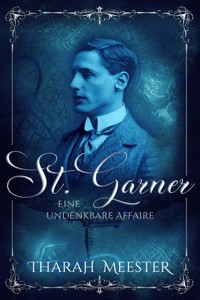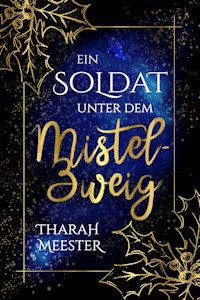6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drystane Marshall, Ascots vorzüglichster und tollkühnster Zeitungsschreiber, lässt nichts zwischen sich und eine gute Story kommen. Als die Geliebte eines zwielichtigen Politikers ermordet wird, ist er wie immer der erste Schreiber am Tatort. Sein journalistischer Eifer stößt jedoch auf die verschränkten Arme Donatien Giancovellis, der ihn in seiner gewohnt schroffen Art an der Ausübung seiner Pflichten hindert. Damit nicht genug, vermutet Drystane hinter dessen Verhalten noch viel durchtriebenere Motive. Ist der biedere Detective Sergeant etwa mit dem Geheimbund verbandelt und wartet nur darauf, ihn im richtigen Augenblick aus dem Weg zu schaffen? Während er sich bemüht, die Wahrheit herauszufinden, muss er sich eingestehen, dass er sich der geheimnisvollen Ausstrahlung des stummen Polizisten nicht entziehen kann und es auch gar nicht will. Dieser Roman kann für sich allein gelesen werden. Um den höchsten Lesegenuss zu erreichen, empfiehlt es sich jedoch, die Protagonisten bereits in 'Der Tischler und sein Stutzer' kennenzulernen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DER INBEGRIFF VON BIEDERKEIT
ASCOT CRIME AND DRAMA
THARAH MEESTER
Copyright © 2017 Tharah Meester
Alle Rechte vorbehalten.
Cover & Illustrationen © 2017 by Dominik Zeiner-Haring
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN-13: 978-1544784632
ISBN: 1544784635
Mehr auf
www.tharahmeester.com
Kontakt sehr gerne unter:
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir sind also wieder in Ascot, hm? Es scheint so.
Wo fange ich diesmal an? Bei den Neuerungen, dass Ascot jetzt ein eigenes Wappen und sogar einen Leitspruch in der alten Sprache der Stadt vorzuweisen hat? Und darüber hinaus einen eigenen Reihentitel? Hm, das seht ihr ja selbst...
Und dass es auf meinem Blog (www.tharahmeester.com) wie immer einen Soundtrack zum Buch gibt, wissen auch die meisten.
Nun, dann vielleicht bei der versprochenen Lautschrift für die Vornamen der werten Herren Marshall & Giancovelli, damit mein Drystane nicht versehentlich wie ein trockener Fleck (dry stain) ausgesprochen wird. Also der Fleck stimmt ja noch irgendwie, aber das dry wird zum dri... Genug gefaselt, ich komme zum Punkt:
Da wir das jetzt geklärt hätten, möchte ich noch etwas an-sprechen, das von weitaus größerer Bedeutung ist: Um für einen guten Lesefluss zu sorgen, habe ich die Gebärden-sprache ein wenig stilisiert und Dinge wie das Mitsprechen und die Grammatik außen vor gelassen. Ich habe mich in den letzten sechs Monaten ausführlich damit beschäftigt und festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sie sich bis zu einem Niveau, das reicht, um ein paar Nettigkeiten auszutauschen, beizubringen. Daher lasse ich einen Link da, in der Hoffnung, dass der ein oder andere Interesse daran hat. Für den Falle eines Falles, dass man eines Tages jemandem begegnet, dem man mit einem ‚Wie geht es dir?’ in seiner Sprache eine sehr große Freude bereiten kann. Näheres also zum Beispiel auf www.gebaerdenlernen.de!
Jetzt entlasse ich euch und trete beiseite, um den Weg für die Kutsche freizugeben, die euch direkt ins düstere Herz Ascots führen wird.
Danksagung
Ich bedanke mich bei meinen fleißigen Tippfehlersuchern Gabi Cervenka vom Laberladen (den ihr unbedingt besuchen solltet), Marie-Jeanne Rimpler, Lisa Ruchti, Sabrina Pommer von Sanarkai’s Welt der Bücher und natürlich meiner lieben Yu! Ihr habt mir sehr geholfen! Vielen Dank!
Auch meinem Ehemann muss ich einen Dank aussprechen – für seine Geduld mit meiner perfektionistischen Wenigkeit, seinen wertvollen Beistand und natürlich für mein perfektes Wappen, in das ich total verknallt bin.
For him who fain would teach the world
The world holds hate in fee
For Socrates, the hemlock cup;
For Christ, Gethsemane.
– Don Marquis
Für den, der gern die Welt belehren würde,
hält die Welt Hass in Gebühr.
Für Sokrates den Schierlingsbecher,
für Christus Gethsemane.
(meine freie Übersetzung)
Gescheiterte Existenzen auf der Suche nach Sinn
Die Identitäten der Raub-mörder, die sich seit einer Weile mit ihren schmutzigen Fingern an den Tresoren der Bank of Ascot zu schaffen machen und dabei alles niedermetzeln, was sich ihnen in den Weg stellt, sind nun ans Tageslicht gekommen.
Es handelt sich um Jacob Penlyn, Patrick Wax und Gene Morrer. Alle drei sind einstige Metallarbeiter, die ihre Anstellung aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums und der damit einhergehenden Problematik verloren haben. Angeblich ein Herz und eine Seele. Vorausgesetzt es dreht sich nicht um den letzten Schluck eines Single Malt.
Die Enthüllung ihrer Namen und Porträtzeichnungen wird jedoch bedauerlicherweise kaum zu ihrer Verhaftung beitragen können, da sie nach ihrer letzten Missetat nun untergetaucht sind. Sind sie klug, verschwinden sie mit ihrer Beute aus der Stadt und ziehen weiter, um ihre Sünden woanders zu begehen.
Mein Gespür sagt mir aller-dings, dass wir ihre Namen nicht zum letzten Mal in unserem Blatt abdrucken.
Trotz all der Hoffnungs-losigkeit, die ich bezüglich einer Verhaftung sehe, bittet die Polizei Ascots natürlich wieder einmal um Mithilfe des Volkes, ohne die kaum etwas voranzugehen scheint. Sach-dienliche Hinweise dürfen jedem Streifenpolizisten ins Ohr geflüstert werden.
Berichterstattung durch
D. Marshall
1
Ascot, Jahr 603
„P
ferdedreck, das darf nicht wahr sein!“
Drystanes Laune hatte den Tiefpunkt erreicht, noch bevor er aus der Kutsche stieg. Ein Blick aus dem Fenster des Wagens genügte ihm, um zu wissen, dass er zu spät war, obwohl er den Fahrer zu einem halsbrecherischen Tempo angehalten hatte.
Giancovelli war vor ihm angekommen – Wie hat der Mistkerl das geschafft? – und würde ihm den Zutritt zum Tatort ver-weigern. Und auf die Weise dafür sorgen, dass Drystane eine grandiose Geschichte durch die Lappen ging.
Jeden anderen Polizisten hätte er vielleicht überreden oder überlisten können, aber nicht Giancovelli. Der würde ihm die Tour vermasseln.
„Was ist denn, Mr Marshall?“, fragte sein Pressezeichner und hob den Vorhang an, um müde hinauszuspähen. Sein fehlender Enthusiasmus wäre durch die frühe Morgenstunde zu entschuldigen gewesen, wenn er kein Teil seines Charak-ters wäre. „Oh“, nickte Neb, als er den Grund für Drystanes Missgestimmtheit entdeckte. „Das ist nicht gut.“
„In der Tat. Nichts ist jemals gut, wenn ich diesen Narren ansehen muss.“ Zähneknirschend musterte er Giancovelli, wie er in Gesellschaft seines rotbraunen Jagdhundes abseits der anderen Beamten vor dem Haus am Ende der Straße stand. Übelgelaunt gaffte er zur Kutsche herüber. Als ihre Blicke sich trafen, legten sich ihrer beider Stirnen in Falten, und Drystane ließ den Vorhang mit einem Knurren an seinen Platz zurückfallen. „Lass uns gehen. Drystane Marshall gibt nicht kampflos auf.“
Neb seufzte und stieg vor ihm aus dem Gefährt.
Widerwillig und dennoch entschlossen folgte Drystane ihm und griff sich mit der Rechten an den Kragen seines Mantels, um ihn zuzuhalten, damit die beißende Kälte nicht unter seine Kleider kriechen konnte. Sein Gebaren hielt sie allerdings nicht davon ab.
Zumindest hatte es inzwischen aufgehört zu schneien. Die ganze Nacht lang waren dicke Flocken aus den Wolken ge-fallen. Er hatte vom Fenster seines Büros aus beobachtet, wie sie sich auf der Erde niedergelassen hatten, um sich auf den Straßen Ascots in Matsch zu verwandeln und ihn zu ärgern. Mit jedem Schritt in Richtung Giancovelli schmatzte es unter den Sohlen seiner sündhaft teuren Boniver Fred’s. Er hasste die-ses unelegante Geräusch, vor allem, wenn es ihn irgendwohin verfolgte!
„Einen wunderschönen guten Morgen, Giancovelli“, säu-selte er mit einem aufgesetzten Lächeln, um dessen Falschheit sein Gegenüber sehr wohl wusste.
Detective Sergeant Giancovelli ließ sich zu keinem noch so winzigen Nicken herab. Stattdessen stand er regungslos vor ihm und betrachtete ihn aus seinen kühl wirkenden Augen, die von unbeschreiblicher Farbe waren. Blau? Grün? Eine Mi-schung davon? Wen interessierte das? Sein dunkelblondes Haar, welches ihm bis über die Schultern reichte, war feucht. Vermutlich geschmolzener Schnee.
Drystane knirschte aufgrund der Unhöflichkeit mit den Zähnen und ignorierte das Brummen des Hundes. „Ich will einen Blick ins Haus werfen. Die Ascot Daily Mail will über den Vorfall berichten. Wäre es möglich, dass...?“
Seine Bitte wurde mit einem Kopfschütteln abgeschmettert, noch ehe man ihm die Möglichkeit gegeben hatte, sie gänzlich vorzubringen.
„Ihr werdet mich abermals warten lassen, bis die restlichen Reporter eingetroffen sind? Muss ich mich in Geduld üben, bis Chef de police Howard die Gnade zeigt, den Journalisten ein paar Brocken Informationen hinzuwerfen?“
Giancovelli schüttelte erneut das Haupt und schluckte auf jene bemühte Weise, auf die er es meist tat. Er strich sich mit dem Handrücken eilig über die Lippen.
„Was dann?“, forderte Drystane zu wissen und klammerte sich mit halb erfrorenen Fingern an den Riemen seiner leder-nen Umhängetasche.
Mit unwirschen Handbewegungen deutete Giancovelli ein paar Gesten in Gebärdensprache.
„Was will er uns sagen?“, fragte Neb.
Drystane nahm keine Notiz von ihm. „Ich soll nach Hause fahren?“, wiederholte er den stummen Befehl und Zorn ver-brannte ihm die Eingeweide.
Giancovelli, dieser unerträgliche Arsch, nickte und schluck-te abermals auf diese sonderbar enervierende Art.
„Aus welchem Grund?“, presste Drystane zwischen den Zähnen hervor.
Das schlichte Handzeichen, das ihm zur Antwort gegeben wurde, stand für Anweisung. Drystane hatte sie alle auswendig gelernt, um mit dem Mistkerl streiten zu können, auch ohne dass dieser ein Wort sagen musste.
„Anweisung von wem? Seid Ihr sicher, dass Ihr mich nicht schlichtweg wieder in der Ausübung meiner Arbeit behindern wollt?“
Statt einer Erwiderung musterte Giancovelli ihn flüchtig von oben bis unten. Dabei verdüsterte sich seine Miene und er zog ein kariertes Taschentuch hervor, um sich unwillig über den Mund zu wischen.
Nun geht das wieder los! Was auch immer es war, es nervte Drystane gewaltig. Ebenso wie der abschätzige Blick, mit dem Giancovelli ihm zeigte, wie wenig er von ihm hielt. „Ver-dammtes Arschloch“, murrte er und wandte sich ab, um ihn in dem Glauben zu lassen, er träte geläutert den Rückzug an. „Der Blödmann soll endlich zur Hölle fahren, damit ich hier meine Ruhe habe.“
„Ihr habt mich also umsonst aus dem Bett holen lassen“, murmelte Neb.
„Es ist noch nicht vorbei“, erwiderte Drystane und wirbelte herum, um zum Haus zu laufen. Sogleich ertönte warnendes Gebell und der Matsch machte ihn langsam, doch er musste es versuchen! Die Bemühungen seines Spions, der ihm den Tipp gegeben hatte, noch ehe die Detectives sich am Tatort einge-funden hatten, sollten nicht umsonst gewesen sein. Er musste einen Blick auf Eileen Forsythes Leiche werfen, um sich ein Bild vom Tathergang machen zu können! Alles andere wäre reine Spekulation und seine Berichterstattung konnte nicht von einer solchen abhängen!
Er war nicht weit gekommen, da wurde er von hinten gepackt. Kräftige Finger schlangen sich um seinen Oberarm.
Giancovelli schubste ihn in Richtung Kutsche und schnitt eine bitterböse Grimasse, die ihm Angst einjagen sollte, ihn aber lediglich zornig machte.
„Nur eine Minute, verdammt! Gebt mir nur eine Minute!“, brüllte Drystane und machte die restlichen Beamten auf sich aufmerksam, die sich köstlich über ihn amüsierten – diese vermaledeiten Mistsäcke!
Giancovelli versetzte ihm einen weiteren Stoß, der ihn ins Wanken brachte. Er verlor auf dem rutschigen Untergrund den Halt und landete so heftig mit dem Hintern auf dem Pflasterstein, dass ihm die Zähne klapperten. Ein Schauder der Kälte durchfuhr seinen Körper, gleich darauf ging er vor Wut in Flammen auf. „Was bildet Ihr Euch ein, auf diese Weise mit mir umzugehen, Ihr verfluchter Arsch?!“
Neb eilte an seine Seite, um ihm aufzuhelfen, doch Drystane schlug dessen Hand fort und kam aus eigener Kraft in die Höhe.
„Was fällt Euch ein?!“, zeterte er, während er den schmut-zigen Schnee von seinem Mantel klopfte. „Sollte der Stoff ruiniert sein, werdet Ihr höchstpersönlich für den Ersatz auf-kommen, das verspreche ich Euch!“
Giancovelli verzog keine Miene und wandte sich ab. Sein Hund folgte ihm so abrupt, als wäre er am Bein seines Herrn festgemacht.
„Habt Ihr mich gehört, Giancovelli?!“
Der Mann hob die rechte Faust und zeigte ihm den Mittelfinger, ohne sich zu ihm umzudrehen.
„Euch ist schon klar, was diese Geste bedeutet, oder? Verfluchter Narr! Ihr droht mir mit Penetration! Na, dann kommt doch, und fickt mich, Giancovelli! Kommt und fickt mich!“
Die Polizisten vor dem Haus brachen in schallendes Ge-lächter aus, während Giancovelli keine Reaktion zeigte.
Drystane gab einen Laut des bitteren Trotzes von sich und machte auf dem Absatz kehrt, um in die Kutsche zu steigen. Dabei rutschte er ein weiteres Mal aus und landete auf dem Steißbein, was für noch mehr Erheiterung sorgte.
Neb zog ihn hoch und half ihm in ihr Gefährt, in welchem Drystane sich mit einer Aneinanderreihung von Flüchen und Schimpfworten abreagierte. „Ich hasse den Kerl! Ich hasse ihn! Oh, ich verfluche ihn!“
Das Holz knarzte unter seinen Sohlen, als er sich in das schlicht eingerichtete Schlafzimmer begab, welches Marshall unbedingt hatte besichtigen wollen.
Gero blieb auf einen Handwink hin vor der Tür sitzen und begann verhalten zu hecheln. Es behagte ihm nicht, von seiner Seite zu weichen. Donatien strich ihm zur Beschwichtigung über den Kopf.
Eileen Forsythe lag auf ihrem Himmelbett. Völlig entkleidet und ungewöhnlich blass. Der Einstich an ihrem Unterleib, der sie getötet hatte, war kaum zu erkennen. Man hatte ihr die Kleider ausgezogen, als jegliches Leben bereits aus ihr ge-wichen war, und sie gesäubert, um sie lasziv auf den Laken zu drapieren. Ihr Nachbar hatte einen Streifenpolizisten verstän-digt, da er Schleifgeräusche aus ihrem Haus gehört hatte.
„Seid Ihr den Schreiber losgeworden?“, fragte Howard, der über die Leiche gebeugt an deren Haar zu riechen schien.
Sie hatten die Kutsche von weitem kommen sehen und gewusst, dass es nur Marshall sein konnte, der zu so früher Stunde seiner Arbeit nachging. Irgendeiner seiner kleinen Spitzel war immer wach und so war er stets über jegliches Geschehen in der Stadt informiert.
Zur Antwort nickte Donatien, doch sein Vorgesetzter wandte sich nicht um, sodass er zu einem leisen Mhm gezwungen war. Aufgrund der ungewohnten Belastung schmerzten seine Stimmbänder und er räusperte sich, um das Kratzen im Hals zu lindern.
„Gute Arbeit. Dieses Pack wird immer unerträglicher, vor allem Marshall. Ich sollte bald etwas dagegen unternehmen“, murmelte Howard. „Sie haben ihr alles vom Leib gestreift, was sie anhatte.“ Er deutete auf den Waschtisch, auf dem Haarbänder und Kämme lagen. „Auch den Schmuck haben sie ihr abgenommen. Bis auf dieses Stück hier.“
Donatien folgte Howards Zeigefinger, dessen Spitze auf einen einzelnen Ring deutete. Dann wanderte sein Blick zu dem Kleid hinüber, welches an einer Stelle mit Blut besudelt war. Es war jene Stelle, an der sich die Klinge einen Weg in Eileen Forsythes Fleisch gebahnt hatte.
„Alles ist sauber, was bedeutet, dass sie das arme Mädchen nicht hier, sondern irgendwo außerhalb des Hauses umge-bracht haben. Aber der Täter wusste, wo sie wohnte, und hat sie hergebracht.“
Donatien klatschte in die Hände und Howard wandte sich ihm zu, um seine Gebärden zu verfolgen: Vielleicht hat er sie auf dem Balkon oder im Garten überrascht.
Der Chef de police schüttelte den Kopf. „Auf dem Balkon habe ich mich umgesehen. Er ist von einer Schneeschicht bedeckt. Die einzigen Spuren dort draußen sind Vogelfüßchen auf dem Geländer. Gershwin und Turnbull sehen sich gerade im Garten um. Ich hoffe, sie finden etwas.“
Donatien nickte schwach und tat einen Schritt Richtung Bett, um der Toten den Ring vom Finger zu ziehen. Er las die Gravur und gab einen Laut von sich, der den Inspektor an seine Seite beschwor. Von draußen hörten sie zwei oder mehrere heranfahrende Kutschen.
„Was habt Ihr gefunden?“, fragte Howard und nahm das Schmuckstück an sich, um es eingehender zu betrachten. Auch er widmete sich der Inschrift: In Liebe, Iljanko. „Ein Ring von Peshnic ist das Einzige, das der Mörder ihr am Leib ge-lassen hat. Was will er uns damit sagen? War er eifersüchtig? Vielleicht war es auch eine ehemalige Geliebte Peshnics, die sich mit der Trennung nicht abfinden konnte und sich durch die Zeitungsartikel provoziert fühlte, in der Peshnic und Forsythe als perfektes Paar dargestellt wurden.“
Wieder antwortete Donatien mit einem Nicken.
„Was ist hier vorgefallen, zum Teufel?“, knurrte Howard und fasste in die Brusttasche seines Hemdes, doch überlegte es sich in letzter Sekunde anders und ließ das Zigarettenetui wo es war. Vermutlich wollte er den Tatort nicht mit Asche verfälschen, die irgendein armer Trottel als Beweismittel eintütete.
Mike Ruffalo gesellte sich zu ihnen. Sein Eintreten wurde von Geros Fiepen begleitet. „Myrtle kommt jeden Moment, um die Leiche in Augenschein zu nehmen“, verkündete der groß gewachsene Mann und sah sich forschend um. „Mr Goodfellow ist zurück.“ Die Treppe knarzte unter dessen leichtfüßigen Schritten.
„Mit Peshnic?“, fragte Howard hoffnungsvoll.
Goodfellow, der blutjunge Deputé Howards, erschien unter dem Türsturz und erwiderte grimmig: „Mit schlechten Nach-richten.“
„Raus damit“, forderte Howard und griff erneut an seine Brusttasche, nur um die Finger abermals sinken zu lassen.
„Peshnic war tief getroffen von den Neuigkeiten, die ich ihm überbrachte, lehnte es aber ab, mich zu begleiten. Er sagt, er möchte seine Geliebte in Erinnerung behalten, wie sie im Leben war, und nicht im Tode.“
Howard brummte missmutig und gab den Kampf gegen seine Sucht auf. Er zog ein Päckchen Golden Petiol hervor und steckte sich eine an. Mit der Zigarette zwischen den Lippen fragte er: „War herauszufinden, ob er ein Alibi für letzte Nacht hat?“
„In der Tat, Sir. Er verfügt über eines, das mir wasserdicht erscheint“, nickte Dean Goodfellow und verschränkte die Hände hinter dem Rücken, um eine vorbildliche Haltung anzunehmen. „Er behauptet, auf einer Versammlung von Politikern gewesen zu sein, die länger dauerte, als erwartet. Anschließend war er mit zwei Männern auf einen Drink. Alle genannten Zeugen bestätigen unabhängig voneinander seine Geschichte.“
„Ab wann war er nicht mehr in Gesellschaft?“
„Laut Aussage des Barmannes haben die Herrschaften den Club gegen vier Uhr morgens verlassen.“
„Das ist kaum eine halbe Stunde her“, stellte Howard fest und strich sich mit dem Daumennagel über die Lippen, während er die Leiche anstarrte. Der Glimmstängel in seiner Rechten setzte Rauchzeichen ab, als wolle er um Hilfe rufen.
Mike Ruffalo mischte sich ein: „Ich bin kein Arzt, wie meine Gattin, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass Miss Forsythe schon länger tot ist. Ich vermute, sie starb weit vor Mitter-nacht. Aber lassen wir Myrtle ihre Arbeit tun. Gewiss kann sie uns mehr dazu sagen.“
Howard nahm einen Zug und seufzte unterdrückt. „Meine Herren, ich muss daran erinnern, dass wir uns augenblicklich in Personalnot befinden. Sollte Eure Frau keinen Hinweis auf den oder die Täter finden, Ruffalo, tappen wir im Dunkeln.“ Er rieb sich die Stirn.
„Unser Opfer hatte einen Bruder. Peshnic fragte, ob er schon davon wisse“, meinte Goodfellow. „Ich verneinte und bat ihn um den Namen. Er muss bei der Eheschließung den seiner Gemahlin angenommen haben, denn er heißt jetzt Degwich. Peshnic nannte mir seine Adresse, doch ich wollte alles Weitere mit Euch abklären, ehe ich handle.“
„Gut gemacht, Dean. Nehmt Euch einen Constable und fahrt zu Degwich“, wies Howard an. „Doch befragt ihn nicht, sondern bringt ihn aufs Revier. Ich möchte selbst mit ihm sprechen, wenn ich schon Peshnic nicht haben kann.“
„Jawohl, Inspektor.“ Goodfellow verbeugte sich und eilte nach draußen.
Alle blickten ihm nach, bis Howard das Wort ergriff: „Und wir warten unten auf den Doktor.“
Donatien trat als Letzter aus dem Raum und Gero gesellte sich an seine Seite, um so dicht bei Fuß zu gehen, dass Donatien die Schulter des Hundes am Bein spürte.
In eine Decke gehüllt saß Drystane vor dem Kamin in seinem Büro und versuchte, die Kälte aus seinem Inneren zu vertrei-ben. Er fröstelte und seine Finger, die er um eine Tasse mit schwarzem Tee geschlungen hielt, schmerzten. Sein Mantel hing an einem Kleiderbügel nahe dem Feuer und würde sich mit dem unangenehmen Rauchgeruch vollsaugen.
„Das ist alles Giancovellis Schuld“, beschwerte er sich bei Neb, der irgendwo hinter ihm an einer Zeichnung arbeitete. „Der Mistkerl wird mich noch um all meine Besitztümer bringen. Und um den Verstand. Nicht zu vergessen um meine Anstellung. Ach was, das Arschloch wird mich ins Grab bringen!“
„Ihr reagiert über, Mr Marshall“, kam mit einem unter-drückten Seufzen zurück, welches Drystane daran erinnerte, dass er anderen Menschen schnell anstrengend wurde. Offen-bar war es nun auch bei Neb soweit, obgleich der Mann erst seit wenigen Wochen in seinen Diensten stand.
„Ich reagiere über? Du hast gesehen, wie er mit mir um-geht! Sehe ich wie jemand aus, mit dem man auf diese barsche Weise umspringen kann?!“
„Natürlich nicht, Sir. Giancovelli weiß es eben nicht besser. Weshalb hängt Ihr Euch derart an seinem Verhalten auf? Lasst es gut sein. Ihr müsst mit dem Kerl nichts zu schaffen haben, wenn Ihr ihn nicht ausstehen könnt.“
„Nichts zu schaffen haben?“, wiederholte Drystane. „Ich will ja gar nichts mit ihm zu schaffen haben, aber er sabotiert meine Arbeit!“
„Es gibt tausend andere Dinge, über die Ihr schreiben könnt. Die Leute lieben Eure Artikel um Eurer bissigen Wortwahl willen. Da ist es ganz gleich, worum es in den Berichten geht.“
Drystane rieb sich mit kalten Fingerspitzen die Schläfe, hinter der eine Ader kraftvoll pochte. „Ich möchte über Er-eignisse berichten, die von Bedeutung sind. Forsythe war die Geliebte eines wichtigen und ebenso zwielichtigen Politikers. Jetzt ist sie tot. Was würde ich nicht alles dafür geben, ihre Leiche zu sehen, um meine Eindrücke zusammenfassen zu können.“
Der unleidige Giancovelli machte seine Bemühungen immer öfter zunichte. Die Lage zwischen ihnen war seit jeher prekär, doch schien sich zuzuspitzen. Oder tat sie das nur in seinem Kopf? War es bloß wegen dieser Sache, die ihm nicht aus dem Schädel wollte?
„Neb, lass mich allein“, murmelte er.
Der Zeichner gehorchte offenbar nur allzu gerne und suchte das Weite.
Drystane erhob sich mitsamt seinem Überwurf und der Tasse, um die Jalousien seiner verglasten Wand in den Gang hinaus herunterzuziehen und die Tür abzuschließen. Dann nahm er erneut vor dem Kamin Platz und sah in die lodernden Flammen. Ein ungeheuerlicher Verdacht ließ ihn nicht los.
Es war noch keine drei Wochen her, seit man ihn zuletzt entführt hatte. Man hätte ihn umgebracht, aber dazu war es nicht gekommen. Sein Leben war gerettet worden und Gian-covelli war daran maßgeblich beteiligt gewesen. Und das war genau jener Teil, der ihn um den Schlaf brachte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Giancovelli aus Gutmütigkeit gehan-delt hatte. Da musste etwas dahinterstecken!
Die Männer, die für Drystanes Entführung verantwortlich gewesen waren, waren inzwischen entweder in die ewigen Jagdgründe vorausgegangen – darunter auch der ehemalige Polizeichef und Menschenhändler Hathaway – oder befanden sich in Verwahrung. So glaubte und hoffte er. Was aber, wenn das nicht stimmte? Was, wenn Giancovelli zu ihnen gehörte? Wenn er ein Verbrecher war und man Drystane nur verschont hatte, um ihm zu gestatten, Teil eines größeren Ganzen zu werden – und ihn später zu töten?
Als er jene Bedenken seinen Freunden Franco und Corvin gegenüber erwähnt hatte, hatten diese bloß gemeint, dass er sich in Wahnvorstellungen verstrickte. Daraufhin hatte er versucht, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Doch er konnte es nicht. Es ließ ihm keine ruhige Minute, nicht zu wissen, weshalb Giancovelli ihn nicht hatte sterben lassen, sondern alles in seiner Macht Stehende getan hatte, um sein Ableben zu verhindern.
Er brauchte Gewissheit und die würde er nur bekommen, wenn er sich an Giancovellis Fersen heftete und sich selbst davon überzeugte, dass der Mann kein Krimineller war, der ihm im richtigen Moment an den Kragen wollte.
Oder eben doch.
2
A
ngespannt und vor Kälte bebend stand Drystane hinter einem Baumstamm und beobachtete Gianco-vellis Haus. Es war mehr eine Hütte und sie stand direkt an einem kleinen See. Von der Veranda aus konnte man in das Wasser zu seinen Füßen spucken, wenn man es wollte. Die Umgebung war idyllisch und Drystane fragte sich, wozu Giancovelli all diese Ruhe brauchte.
Was trieb der Arsch hier draußen in der Wildnis? Nicht dass es ihn wahrhaftig interessieren würde, aber es war gut, seinen Feind zu kennen.
Drystane hatte das Frühstück ausgelassen, um vor dem Morgengrauen hier zu sein. Zwar war es keine Seltenheit, dass er die erste Mahlzeit des Tages nicht einnahm, doch an diesem Tag hatte er es wegen Giancovelli nicht getan. Denn er wusste aus sicherer Quelle, dass dieser heute nicht zur Arbeit gehen würde. Nun wollte er sehen, was der Mann stattdessen trieb und ob er dabei gegen das Gesetz verstieß.
Eine Ewigkeit hatte er bereits mit Warten verbracht und ihn beschlich das ungute Gefühl, dass ihm alsbald die Zehen abfrieren würden, obgleich er seine mit Fell gefütterten Winterstiefel trug. Er rieb sich die behandschuhten Hände und hauchte darauf, obwohl sich ihm dieses Bemühen als sinn-los erschloss.
Als einige eiskalte Tropfen von einem Ast direkt in seinen Kragen sprangen, hätte er am liebsten vor Wut geschrien. Er biss sich auf die Unterlippe und stampfte mit dem Fuß auf die Erde, um seinen Zorn zu dämpfen.
Das half. Ein bisschen.
Endlich – dem Himmel und der Hölle sei allergrößter Dank – kam der verfluchte, vermaledeite Giancovelli aus seinem ver-dammten Haus. Begleitet wurde er von seinem Hund, der un-gewohnt wild um seinen Herrn herumsprang.
Giancovelli strich sich das dunkelblonde Haar einseitig hinters Ohr. Es fiel ihm in sanften Wellen über die Schultern. Seine langen Beine steckten in – wieschrecklich passend – kleinkarierten Hosen in schwarz-weiß und sein Oberkörper war in ein weißes Hemd mit weiten Ärmeln und einem Kragen mit ein paar wenigen Spitzen gehüllt. Darüber trug er sein dunkelgrünes Gilet aus Brokatstoff. Den Kurzmantel hatte er sich aufgrund seiner Kälteunempfindlichkeit über den Arm geworfen.
Gut sah er aus, der Mistkerl...
Also, für ein Arschloch!
Unauffällig folgte Drystane dem Mann, der für einen ein-fachen Spaziergang zu fein gekleidet war. Es zog ihn offenbar in die Stadt. Hatte er vor, sich mit jemandem zu treffen? Viel-leicht mit einem Kriminellen, um mörderische Pläne auszu-hecken? Es würde sich bald zeigen.
Drystane hoffte, dass er belastende Dinge mitansehen würde. Dinge, die sich hervorragend in einem Artikel machen würden. Denn wenn Giancovelli ihn davon abhielt, fundiert über die aktuellen Geschehnisse der Stadt zu berichten, musste er wohl oder übel über Giancovelli schreiben. Was dessen Ruf nicht gut bekommen würde. Oh, dafür sorge ich...
Giancovelli war sich seiner Anwesenheit nicht bewusst, denn Drystane hatte Erfahrung darin, jemandem nachzu-schleichen. Sein Talent, Leute zu bespitzeln, hatte sich seiner Karriere als Journalist sehr zuträglich gezeigt und ihm bereits mehr als nur eine gute Story eingebracht.
Zum Glück bemerkte auch der Hund nicht, dass sie einen Verfolger im Genick sitzen hatten. Das Tier war zu beschäftigt damit, jeden einzelnen Grashalm mit Urin zu be-sprenkeln und anschließend daran zu riechen. Hin und wieder gesellte er sich an Giancovellis Seite, um den Kopf an seines Herrn Oberschenkel zu reiben und Streicheleinheiten einzu-fordern, die ihm stets bereitwillig gegeben wurden.
Ach, zu deinem Hund kannst du nett sein, ja? Aber mich wirfst du einfach in den Schnee, Blödmann!
Drystanes Mantel war im Übrigen wieder trocken ge-worden und wies keine Spuren mehr von dem gestrigen Zwischenfall auf. Beinahe bedauerte er das. Immerhin hätte er andernfalls Ersatz fordern und Giancovelli auf die Nerven fallen können. Zur Not hätte er den Kerl vor Gericht gezerrt! Er war zu allem bereit, sobald der Name Giancovelli fiel.
Geschickt schlüpfte er zwischen einigen Baumstämmen hindurch, um nicht gesehen zu werden, und musste sich darum bemühen, den Anschluss nicht zu verlieren, denn Giancovelli legte ein ziemliches Tempo vor. Er hatte auch die längeren Beine von ihnen beiden.
Die ersten Häuser der Stadt zeigten sich und bald würden sie in den Straßen Ascots verloren gehen. Drystane musste dafür sorgen, dass ihm Giancovelli nicht im Gedränge abhandenkam oder seine Anwesenheit bemerkte. Zumindest wäre ein Entdecktwerden in den Gassen nicht dermaßen peinlich wie draußen auf dem Land. Hier in der Stadt könnte er tausend Ausreden vorbringen, ohne Verdacht zu erwecken. Immerhin hatte er jedes Recht, sich frei zu bewegen – oder wollte Giancovelli ihm verbieten, spazieren zu gehen?
Drystane blieb dem Verdächtigen dicht auf den Fersen, die in kniehohen, schwarzen Lederstiefeln steckten. Diese waren frisch geputzt gewesen, als Giancovelli das Haus verlassen hatte, aber nun waren sie voll Schlamm und Matsch. Sahen seine eigenen Stiefel auch dermaßen grauenvoll aus? Er warf einen kurzen Blick auf seine Füße und fluchte innerlich, weil er die Frage mit Ja beantworten musste. Herrgott, wie kam er daher?! Er konnte nur hoffen, dass niemand von Bedeutung ihn in dieser Aufmachung zu sehen bekam.
Wenige Zeit später befanden sie sich mitten im Hand-werkerviertel, umgeben von Passanten, die mit dreckbesprit-zten Kleidersäumen und schmutzgesprenkelten Hosenbeinen ihrer Wege hasteten und den Kutschen auswichen, die noch mehr Dreck aus den zahlreichen Pfützen schleuderten. Ver-flucht, er hasste solche Tage – Tage, an denen er schmutzig werden konnte. Für gewöhnlich fuhr er dann in einer Kutsche dorthin, wo er hinwollte, doch auf diesen Luxus musste er heute verzichten. Immerhin konnte er Giancovelli schlecht in einem Wagen hinterherfahren. Obwohl...
Unvermittelt wandte Giancovelli sich um.
Drystane warf sich in einem riskanten Manöver hinter einen Gemüsestand und stieß gegen einen fetten, alten Händler, der gerade verfaulte Gurken aus einem Korb klaubte. „So pass doch auf, blöder Lackaffe!“, rief der Mann und schubste ihn auf die Straße zurück.
Kaum etwas hasste er mehr, als herumgestoßen zu werden. Lackaffe? Er trug seine schlichteste Kleidung und war ganz in schwarz gehüllt! „Na hört mal, Ihr...“ Mitten im Satz wurde er unterbrochen. Ein Gurkenstück traf ihn an der Schläfe, und er war zu perplex, um einen weiteren Ton vorzubringen.
„Verschwinde, du Stenz! Hier gibt’s nichts für dich!“
Stenz? Das wurde ja immer schöner.
Als ob ich deine fauligen Gurken kaufen würde!
Drystane entschied, sich eine Erwiderung zu verbeißen und stattdessen einen Artikel über den gurkenwerfenden Pöbel in Blackchurch zu verfassen. „Warte nur ab, Dicker, morgen stehst du in der Zeitung“, murmelte er, während er in die Gasse hinaustrat und sich mit einem Taschentuch angewidert den Gurkenschleim von der Schläfe wischte. „Was für eine Ekelhaftigkeit.“ Suchend sah er sich um und das Herz blieb ihm stehen.
Giancovelli war verschwunden. Das darf nicht wahr sein!
Hastig bahnte er sich einen Weg durch die Fußgänger, um die Kreuzung zu erreichen, an welcher der verdammte Bulle nur Sekunden zuvor eine Abzweigung genommen haben musste. Innerlich fluchend stellte er sich auf die Zehenspitzen und ließ den Blick fiebrig über die vielen behüteten und unbehüteten Köpfe schweifen, doch von Giancovelli keine Spur.
Er wollte bereits den Rückzug antreten, da entdeckte er den Hund, der sich mit seinem glänzenden, rotbraunen Fell von der tristen Masse abhob. Das Tier lag in einem Haus-eingang und hatte sich offensichtlich darauf eingestellt, eine Weile zu warten.
Misstrauisch musterte er Giancovellis treuen Begleiter. Aus welchem Grund ließ der Mann ihn hier draußen allein? Zögerlich ging er auf den Hund zu. Als dieser ihn bemerkte, setzte er sich auf und legte den Kopf schief. Offenbar er-kannte er ihn, denn er ließ ihn nicht aus den Augen. Drystane schluckte. Zugegebenermaßen hatte er Respekt vor Hunden dieser Größenordnung. Vor allem beunruhigte ihn jetzt die Abwesenheit Giancovellis. So unsympathisch er auch sein mochte, vertraute Drystane dem Kerl genug, um sich darauf zu verlassen, dass er seinen Hund davon abhalten würde, ein Stück aus ihm herauszubeißen. Aber Giancovelli war nicht da und der Hund schien höchst interessiert an ihm. Als wolle er diese Annahme bestätigen, kam er unvermittelt in die Höhe und schnurstracks auf ihn zu.
Drystane verharrte mitten in der Bewegung. „Halleluja. Herr im Himmel, sorg dafür, dass er mich nicht frisst. Bitte mach, dass er mich nicht frisst.“
Das Tier schnüffelte mit Begeisterung an seinen Hosen-beinen und wedelte mit dem Schwanz. Das war ein gutes Zei-chen. Oder?
Schließlich blickte der Hund zu ihm auf, leckte sich über die Schnauze und ließ sich auf den Hintern plumpsen, als wäre dieser ihm zu schwer geworden. Seine Rute bewegte sich in einer kleinen Pfütze hin und her und färbte sich dunkelbraun. Er fiepte leise und als Drystane nicht darauf reagierte, weil er schlichtweg nicht wusste, was der Hund wollte, hob er die rechte Pfote und tatschte ihm gegen den Oberschenkel.
Drystane fiel in Schockstarre und starrte für einige Mo-mente blinzelnd an sich hinab. Abwechselnd fiel sein Blick auf den Hund und den schlammigen Pfotenabdruck. „Das ist eine echte Caballieri. Wie soll ich den Fleck da wieder rausbekom-men?“
Der Hund bellte zur Antwort wenig hilfreich und wedelte noch wilder.
„Es tut mir sehr leid, Sir, aber ich verstehe Eure Sprache nicht“, erwiderte Drystane mit einem unwirschen Kopf-nicken.
Ein Gruppe Kinder, die an ihm vorüberging, lachte lauthals und einige der Bengel deuteten ihm einen Vogel.
Drystane rief sich zur Vernunft, weil er sich wie ein Trottel gebar. Er griff nach einem Taschentuch – nach jenem mit dem Gurkenschleim –, um den Abdruck an seinen Beinkleidern wegzuwischen.
Dabei begriff er, was der Hund begehrte.
Lächelnd wickelte er den Butterkeks, der sein Frühstück er-setzte, aus der Verpackung und brach ihn in zwei Hälften, um eine dem Hund zu reichen. Der war sogleich auf den staksigen Beinen und schob sich Drystanes Hand in den Mund, um den Keks vollzusabbern, ehe er ihn an sich nahm.
Drystane gab einen Laut der Schockierung von sich und war froh, dass er noch alle seine Finger sein Eigen nennen konnte. „Du scheinst genauso ungezogen wie dein Herr.“
Der Hund schmatzte zufrieden, während Drystane sich die andere Hälfte der Süßigkeit in den Mund schob und dann versuchte, seine Hand zu säubern. Es gelang ihm nicht gänzlich. Ein Bad war dringend angebracht – es würde nach diesem Ausflug erneut einen zivilisierten Menschen aus ihm machen.
Weswegen war er noch mal nach Blackchurch gekommen und stand jetzt mit Giancovellis Hund mitten auf der Straße?
„Giancovelli“, brachte er halblaut hervor, als ihm wieder einfiel, dass er den gerade verfolgte. „Wo ist dein Herrchen, Hund?“
Ein Bellen kam zur Antwort und abermals half es ihm nicht weiter. Er blickte zu dem Hauseingang hinüber, vor welchem das Tier gelegen hatte, und ging darauf zu, um das Schild zu lesen.
Peter S. Hallcox
Drystane starrte eine Ewigkeit auf diesen Namen. Hallcox war Psychiater, ein Therapeut. Zumindest auf dem gefälsch-ten Fetzen Papier, den er großspurig seine Zulassung nannte. In Wahrheit war er ein stadtbekannter Scharlatan.
Was hatte Giancovelli mit ihm zu schaffen? Trieben die beiden krumme Geschäfte miteinander? Das schien nicht zu Giancovelli zu passen. Andererseits kannte Drystane ihn ja eigentlich gar nicht. Woher also wollte er wissen, was zu ihm passte und was nicht?
Er war so in Gedanken versunken, dass er nur am Rande bemerkte, wie der Hund den Kopf an seiner Hüfte rieb, und er ganz von selbst die Hand nach ihm ausstreckte. Seine Finger bekamen weiches Fell zu fassen und verloren sich kraulend darin.
War Giancovelli von Howard hergeschickt worden, um zu reden? Also, um sich mit Gebärden verständlich zu machen?
Allerdings war es unwahrscheinlich, dass ausgerechnet Peter Hallcox als Psychiater der Polizei agierte. Drystane war sich nicht sicher, doch er glaubte, dass es Armistead Yearing aus Fortlock war, zu dem die Beamten geschickt wurden, wenn sie mit etwas nicht fertig wurden.
Was könnte Giancovelli derart belasten, dass er einen Nervenarzt aufsuchte?
Überlegend nahm Drystane auf den Stufen Platz. Der Hund gesellte sich zu ihm und drückte sich an ihn, um weiter gestreichelt zu werden. Er tat ihm den Gefallen – nicht nur weil das Tier ihm Wärme spendete.
Konnte es mit dem Mord an Eileen Forsythe zusammen-hängen? Doch derlei sah Giancovelli jeden Tag. Wie könnte ihn das dermaßen aufwühlen? Nein, gewiss lag ihm nichts auf dem Herzen. Schon gar nichts, was er mit einem Lebewesen besprechen würde. Mit seinem Hund vielleicht, aber doch nicht mit einem anderen Menschen! Das war nahezu ausge-schlossen. Obgleich sich in seiner stets kalten Miene ab und an so etwas wie innere Qual widerspiegelte und der Ausdruck in seinen Augen manchmal leidend anmutete.
Aber das bildete Drystane sich vermutlich bloß ein. Gewiss entsprang dieser Unsinn nur seiner Fantasie.
Giancovelli war ein Arschloch. Würde etwas Düsteres seine Seele peinigen, würde er nicht dermaßen grob sein, weil ihm dann bewusst wäre, dass andere Leute ebenfalls Gefühle hatten, die man verletzen konnte.
Was war dann der Grund für seinen Besuch bei Hallcox?
Unbewusst drängte er sich näher an den Hund. Der kalte Stein unter seinem Hintern brachte ihn zum Zittern. Warum war ihm immer so verdammt kalt, seit er darauf achtete, sein Gewicht zu...
„Eine Liebschaft vielleicht?!“, flüsterte er, als ihn dieser Geistesblitz traf.
Unvorstellbar! Hallcox war ein ausgesprochen unattraktiver Mann und seit Ewigkeiten mit seiner Gattin verheiratet. Der Kerl war ein Unsympath sondergleichen. Die einzig positive Eigenschaft an ihm – jene, die ihm die Kunden und somit das viele Geld einbrachte – war seine Verschwiegenheit.
Jedenfalls würde Giancovelli nicht mit so einem ins Bett steigen!
„Was tut er dann da drinnen, Herrgott noch mal?“, forderte er von sich selbst oder dem Hund zu wissen. Keiner von ihnen beiden gab eine Antwort.
Ihm wurde klar, dass er nicht hier warten konnte.
Giancovelli würde nicht ewig im Haus verweilen, sondern irgendwann rauskommen. Wenn es soweit war, wollte Drystane nicht starr vor Schmutz vor der Tür hocken, wie ein Bettler. Darüber hinaus rief ein ganzer Schreibtisch voll Arbeit nach ihm. Als er sich erhob, stand der Hund mit ihm auf und hechelte.
„Ich muss mich leider von Euch verabschieden, Sir. Es war mir eine Ehre, Eure Bekanntschaft gemacht zu haben“, meinte Drystane und deutete eine Verbeugung an. Der Hund sah mit hoch erhobenem Haupt zu ihm auf und gewährte ihm einen Blick auf die Marke an seinem Halsband. Drystane griff danach, um die Gravur zu lesen. „Gero, hm?“
Sein neu gewonnener Freund bellte zur Bestätigung.
„Was für ein hübscher Name.“ Er tätschelte ihm den Kopf, was Gero zu gefallen schien. Dann wandte er sich zum Gehen.
Gero folgte ihm einige Schritte, ehe er umkehrte und sich zurück in den Eingang setzte. Am nächsten Häusereck hielt Drystane noch einmal inne, um sich umzudrehen. Als könne er mit einem schlichten letzten Blick alle Fragen klären. Doch so einfach war es nicht.
Gero hatte es sich auf seinen Füßen unter dem Schreibtisch bequem gemacht, während Donatien seinen Bericht schrieb. Allzu viel gab es nicht zu sagen, aber Howard wollte dennoch eine Zusammenfassung für die Akten.
Ein Mädchen hatte an einem Stand in Pembroke einen Apfel gestohlen. Die Händlerin, ein arrogantes und bissiges Weibs-stück, hatte die Polizei gerufen. Offenbar glaubte sie, es gäbe in diesen Tagen nichts Wichtigeres als ein Stück abgängiges Obst, welches ein Kind vor dem Hungertod bewahrte.
Dabei war der Mord an Forsythe bei weitem nicht das einzig ungeklärte Verbrechen, das die Polizei Ascots aufzu-klären hatte. Allerdings war Degwich, der Bruder der Ermor-deten, nicht zu einer Kooperation bereit gewesen und hatte darüber hinaus ein Alibi. Zugleich wurde Peshnics Unschulds-beweis von den Untersuchungen des Doktors bestätigt. Sie hatten also keine Verdächtigen und keine weiteren Anhalts-punkte. Und so kam es, dass Gershwin und er sich auf den Weg zum Marktplatz gemacht hatten, um einen Apfeldieb-stahl zu untersuchen und unverrichteter Dinge ins Revier zurückzukehren, weil die Diebin bereits über alle Berge war.
„Benehmt euch, Leute, da kommt der Rufmörder“, grinste Moorland, die Beine lässig auf seinem Tisch, und nickte zum Eingang hinüber.
Donatiens Herzschlag beschleunigte sich einen Takt. Aus dem Augenwinkel beobachtete er Marshall, wie er durch den offenen Raum stolzierte – die Tür zu Howards Büro im Blick. Er trug einen königsblauen Anzug mit weinrotem Kragen, dazu einen weinroten Hut und Schuhe in derselben Farbe. Wie immer hatte er seine lederne Tasche geschultert, in der er seine Notizbücher und weiß Gott was noch alles mit sich herumschleppte.
Jeder andere Mann hätte in dieser Aufmachung wie ein Idiot ausgesehen, aber Marshall führte den Aufzug mit solch einem Selbstbewusstsein vor, dass er elegant wie immer wirkte. Sein Haar schimmerte so schwarz wie der Flügel der Wappenkrähe Ascots und sein blass gepudertes Gesicht bildete einen harten Kontrast dazu. Die Blessuren, die man ihm während seiner kurzen Gefangenschaft vor kaum drei Wochen zugefügt hatte, waren verheilt, doch Donatien rief sich unwillkürlich in Erinnerung, dass man Marshall beinah getötet hätte. Er vertrieb den Gedanken, weil er unerwünschte Gefühle in ihm auslöste, und widmete sich stattdessen dem subtilen Hüft-schwung des Journalisten, was ihm ebenfalls nicht gut bekam. Speichel sammelte sich in seinem Mund und das Schlucken fiel ihm zunehmend schwerer. Er musste nach einem Taschentuch greifen und sich die Mundwinkel abwischen. Innerlich fluchte er. Dass das immer wieder passieren musste! Gott, er hasste es – und verachtete Marshall dafür. Obgleich dieser nichts dafür konnte.
Endlich verschwand der Kerl aus seinem Blickfeld und er konnte sein erhitztes Gemüt abkühlen. Überrascht bemerkte er, dass Gero unter dem Tisch hervorgekommen war und die Nase schnuppernd in Marshalls Richtung hob. Was konnte er riechen? Marshalls Parfum überdeckte jeglichen Eigengeruch, was ihn noch unleidlicher wirken ließ. Jemand, der sich hinter teurem Duftwasser und auffälliger Kleidung versteckte und sich zugleich in den Mittelpunkt drängte, musste etwas zu verbergen haben – wohl vor allem die Tatsache, dass er über keinerlei Charakter verfügte.
Vermutlich wollte er bloß davon ablenken, dass er ein unsympathischer Mensch war und außer seinem ansehnlichen Äußeren nichts zu bieten hatte. Doch seine offen zur Schau gestellte Eitelkeit war nur ein weiteres Defizit, das die Leute dazu brachte, ihn zu meiden. Nicht dass sie das nicht ohnehin tun würden, um ihre Privatangelegenheiten und Reputationen zu schützen.
Sei’s drum. Das alles ging ihn nichts an. Deshalb hielt er sich von Marshall fern, soweit es möglich war. Doch dem Gecken fiel alle paar Wochen etwas Neues ein, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Mehr als einmal hatte er sich unerlaubt Zugang zu einem Tatort verschafft und im Nachhinein frech behauptet, Donatien hätte ihn reingelassen. Was nicht stimmte.
Auch Howard wusste inzwischen, dass es nie der Wahrheit entsprach, obgleich Donatien es nie über sich gebracht hatte, Marshall auffliegen zu lassen. Eine ziemlich idiotische Zurück-haltung, bedachte man, dass er wegen des verfluchten Journa-listen fast seine Anstellung verloren hätte.
Die Turmuhr rief zur Mittagsstunde und seine Kollegen packten ihre Sachen, um der elenden Schreibarbeit für eine Stunde zu entfliehen.
„Kommst du mit auf ein Bier, Giancovelli?“
Kopfschüttelnd lehnte er ab und blieb sitzen, während die anderen Reißaus nahmen. Das riesige Büro, dass sie sich zu acht teilten, wurde leer und glich einem verlassenen Schlacht-feld. Auf den Tischen türmten sich Papierstapel. Die meiste Arbeit blieb liegen, seit viele Polizisten unehrenhaft entlassen werden mussten, weil sie in kriminelle Machenschaften ver-wickelt gewesen waren. Zum Auswählen neuer Rekruten war noch keine Zeit gewesen, doch die Annonce würde morgen in allen Tagesblättern erscheinen.
Gero nahm mit einem Schnauben wieder Platz, als ihm klar wurde, dass sein Herr und er sich nicht vom Fleck rühren würden.
Die Zeit verging und Donatien gestattete sich ein befreites Seufzen, als er seine Unterschrift unter den Bericht setzte. Er pustete die Tinte trocken, um den Zettel schließlich zur Seite zu legen. Als er nach der nächsten Akte greifen wollte, öffnete sich die Tür zu Howards Büro und Marshall kam heraus.
Donatien sank tiefer in seinen Stuhl, obgleich er sich in Anbetracht der Tatsache, dass er der Einzige im Raum war, schlecht verstecken konnte.
Irgendeine böse Macht aus den tiefsten Abgründen der Hölle wollte ihn offenbar ärgern, denn Marshalls Augenmerk richtete sich auf ihn. Nicht genug damit, dass ihre Blicke sich kreuzen mussten, nein. Der eingebildete Lackaffe musste stehen bleiben und nach einem Zögern auf ihn zukommen. Was wollte der Geck von ihm?
Als er seinen Blick über den Mann schweifen ließ, musste er erneut nach dem Taschentuch greifen. Er schluckte einige Male bemüht.
Gero stand auf, um weiß der Teufel was zu tun, aber Donatien brachte ihn mit einem unwirschen Knurren dazu, sich Platz zu legen.
„Kann ich Euch sprechen?“, fragte Marshall heiser, während er vor dem Tisch innehielt und sich am Riemen seiner Tasche festkrallte.
Donatien schüttelte den Kopf und wollte sich seiner Arbeit zuwenden. Seine Antwort schien jedoch nicht von Bedeutung.
„Ich habe Euch gestern zufällig in Blackchurch gesehen.“
Die Worte ließen Donatien sich verspannen und er glaubte, sein Herz hätte aufgehört zu schlagen. Er sah zu Marshall auf und zuckte die rechte Schulter, um Gleichgültigkeit vor-zutäuschen. Marshall leckte sich die Lippen und zog eine Visitenkarte aus der Innentasche seines Jacketts. Er streckte sie Donatien entgegen, aber dieser dachte nicht daran, sie anzunehmen.
„Das ist die Adresse eines korrekten und sehr netten Mannes, an den Ihr Euch wenden könnt, wenn Ihr Probleme habt. Hallcox ist ein Quacksalber. Falls Ihr zu ihm geht, um Seelenheil zu finden, solltet Ihr dieses Ansinnen noch einmal überdenken.“
Mit einem Ruck war Donatien auf den Beinen und tat einen drohenden Schritt auf Marshall zu, der diesen zurückweichen ließ. Er ignorierte Geros Fiepen. Zwei Handbewegungen mussten ausreichen, um auszudrücken, was er sagen wollte.
Marshall verstand und zog die gepflegten Augenbrauen zusammen. „Ich soll schweigen oder Ihr bringt mich um?“
Donatien nickte knapp und ballte die Hände so fest zu Fäusten, dass ihn die Knöchel schmerzten. Am liebsten würde er seinem Gegenüber eine aufs Maul geben, aber er unterließ ein derart primitives Verhalten. Aus vielerlei Gründen.
Marshall betrachtete ihn mit einer Mischung aus Zorn und Ungläubigkeit. „Ihr wagt es nicht, die Hände an mich zu legen, Arschloch!“
Um das Gegenteil zu beweisen täuschte Donatien einen Angriff vor.
Marshall keuchte und brachte sich hinter einem Schreibtisch in Sicherheit, ehe er das Weite suchte. Erst als er an der Tür war, wagte er, in seine Richtung zu keifen: „Ihr verfluchter Mistkerl! Dann rennt doch zu Hallcox und lasst den Scharlatan das letzte bisschen Menschlichkeit vernichten, das noch in Euch ist!“ Damit verschwand er. Aber nicht, ohne noch einmal im Türrahmen zu erscheinen und ihm den Mittelfinger zu zeigen: „Und fickt Euch gefälligst selbst!“
Donatien blieb allein zurück und hob den rechten Mundwinkel in einem unwillkürlichen Lächeln, ehe er ernst wurde. Grob fuhr er sich durchs Haar. Im Stillen betete er, dass Marshall seine Drohung nicht als das leere Geschwätz, das sie war, abtun würde, sondern genug Angst vor ihm hatte, um den verdammten – verdammt hübschen – Mund zu halten.
Im Übrigen gab es für Peter S. Hallcox nichts mehr zu vernichten, denn in ihm war nach all den Jahren der Ver-zweiflung nichts geblieben, das es zu zerstören wert wäre. Kein noch so kleines Fünkchen... Dass ihm sein Hund der liebste Mensch auf der Welt war, sagte wohl genug über ihn aus.
Schwindel befiel ihn und er lehnte sich gegen Gero, der an seiner Seite auftauchte, als hätte er gespürt, dass sein Herr nach Halt suchte.
Der Magen drehte sich ihm um, als ihm bewusst wurde, dass Marshall etwas gegen ihn in der Hand hatte. Etwas, von dem er Gebrauch machen würde, sobald ein günstiger Zeit-punkt gekommen war und er sich genug davon versprach. Der Mann hatte mit Sicherheit nicht ausreichend Respekt vor ihm, um die Information für sich zu behalten, sollte sie ihm etwas einbringen.
So galt es, zum Gegenangriff überzugehen, solange er die Möglichkeit dazu hatte. Entschlossen setzte er sich, griff nach einem unbeschriebenen Blatt Papier und tauchte seine Schreibfeder ins Tintenfässchen, um einen Brief aufzusetzen, von dem Marshall alles andere als begeistert sein würde.
Oh ja, dieses Schreiben würde ihn lehren, sich nicht mit Donatien Alphonse Giancovelli anzulegen.
Die Freuden der Idiotie
Für all jene, die noch nie von ihm gehört haben, möchte ich heute über Kenny Doherty berichten. Als der studierte Psychiater vor einigen Jahren in die Stadt kam, war er voller Hoffnung und Potential, welches sich die Obrigkeiten Fortlocks zu Nutzen machen wollten. Er bekam eine feste Anstellung und ein Gehalt, das andere seiner Zunft hätte grün werden lassen vor Neid. Allerdings bekam ihm unsere Irrenanstalt nicht wohl und innerhalb weniger Monate wurde aus dem resoluten Mann, der Geisteskrankheiten heilte, selbst ein Wahnsinniger, der sich nächtens ans Bett seiner Patienten stellte, um sie zu betrachten, und am frühen Morgen durch die Gänge rannte und krähte wie ein Gockel.
Seine ehemaligen Kollegen versuchten erst auf sanfte Weise und dann mit all ihren fragwürdigen Mitteln, ihm die Irrheit auszutreiben, doch es war vergebens. Man konnte ihn nicht wieder zu dem machen, der er gewesen war, und ihn auch nicht davon überzeugen, dass man in Fortlock für ihn sorgen würde. Er verließ die Anstalt, was uns an dieser Einrichtung zweifeln lassen sollte.
Inzwischen verbringt Doherty seine Tage auf dem Marktplatz in Surrey – ausgerechnet im Polizeiviertel, was die nächste diffuse Ironie in seinem Leben darstellt. Dort ist er damit beschäftigt, von Gemüsekisten herunter zu predigen, Hunde zu jagen und mit ihnen Zungenküsse auszutauschen, und – nicht zu vergessen – seinen Mantel zu lüften und mitten auf die Straße zu masturbieren.
Warum ich Euch das erzähle, werter Leser? Nun, es ist weniger der bemitleidens-werte – oder vielleicht auch beneidenswerte – Doherty, sondern ein gewisser Politiker, der mich dazu treibt, diesen Artikel zu verfassen. Ich werde seinen Namen nicht nennen, aber wenn ich sage, dass er eine Statur hat, die seine abgetragene Kleidung als Notunterkunft für Soldaten qualifiziert, und eine Warze auf der Nase, die ebenso gut eine zweite Nase sein könnte, wird jeder wissen, um wen es sich handelt.
Jedenfalls sticht einem die Tatsache ins Auge, dass Kenny Doherty eine perfide Faszi-nation auf genannten Politiker auszuüben scheint. Vielleicht dient der arme Wahnsinnige ihm als Inspiration für neue Gesetzesentwürfe, die uns beunruhigen sollten. Oder gibt es eine weitere Verbindung zwischen Doherty und besagtem Politiker, die unser Misstrauen wecken sollte? Wie lange wird die Stadt noch ein derart durchtriebenes, verkommenes Subjekt als Volksvertreter dulden, bis sie einschreitet?
Aber vermutlich irre ich mich und es ist lediglich Erregung, die ihn in Dohertys Nähe treibt und dafür sorgt, dass er seinen Blick nicht von dessen Glied lösen kann, über welches eine fleißige Hand gleitet – genau im Takt der Schritte des Streifenpolizisten, der am jeweiligen Tage die Aufgabe hat, Dohertys Blöße zu bedecken und ihn vom Marktplatz zu führen. Um die Kinder nicht zu verstören.
Berichterstattung durch
D. Marshall
Postskriptum: Jeder aus Blackchurch, der nun über Surrey lachen möchte, soll erst vor seiner eigenen Haustür kehren, denn auf deren Markt wirft der Pöbel mit fauligen Gurken um sich, weil er die Kunst der verbalen Auseinan-dersetzung nicht beherrscht.
3
G
iancovelli ging ihm nicht aus dem Kopf. Also nicht der Mann an sich – obwohl, wenn er ehrlich war –, sondern die Tatsache, dass der Trottel zu einem Quacksalber wie Hallcox rannte. Was versprach er sich davon?
Und überhaupt war Drystane verdammt sauer, weil Gian-covelli ihn derart angegangen war, obgleich er ihm nur hatte helfen wollen. Weshalb maßte er sich ständig an, auf diese unwürdige Weise mit ihm umzugehen? Was glaubte er ei-gentlich, wer er war, ihn so forsch behandeln zu können?
Inzwischen waren einige Tage vergangen und Drystane hatte beim besten Willen nicht die Zeit gehabt, Giancovelli erneut zu beschatten. Es brachte ihn halb um den Verstand, nicht zu wissen, was der Kerl trieb.
„Drystane, hörst du mir überhaupt zu?“, holte Franco ihn in die Gegenwart zurück und tippte ihm auf die Schulter.
Corvin, Francos Ehemann, quittierte die Frage mit einem Lachen: „Offenbar tut er das eher nicht, Mann.“
„Huh?“, brachte Drystane schwach hervor und hob den Kopf, den er auf die Linke gestützt hatte, um ins Feuer zu starren.
Sie saßen im Salon seines Apartments, wo sie den Nachmit-tagstee gemeinsam eingenommen hatten. Wer hätte gedacht, dass sich zwischen seinem Verflossenen, dessen Ehemann und ihm eine Freundschaft entwickeln würde? Das gemeinsam Er-lebte hatte sie offenbar zusammengeschweißt.
„Ich habe dir gerade erzählt, dass wir verreisen“, erklärte Franco.
Drystane rang sich ein Lächeln ab und griff nach dem Wasserglas, um etwas in den Händen zu halten. „Wie schön für euch. Wohin?“
„Braddleneck. In irgendwelche Wälder, die Corey unbe-dingt sehen will.“ Franco warf seinem Gemahl einen neckisch provokanten Blick zu, der jedoch vor Zärtlichkeit funkelte.
„Das sind nicht irgendwelche Wälder“, warf Corvin empört ein, „sondern die gewaltigsten Wälder des gesamten Konti-nents.“
„Was gibt es dort zu sehen?“, fragte Drystane.
Corvin warf die Hände in die Luft. „Bäume natürlich!“
„Bäume?“, wiederholte Drystane.
„Bäume“, bestätigte Franco und verbiss sich ein Grinsen.
Corvin, der sich die Schwäche für Holz als Tischler wohl erlauben konnte, war Feuer und Flamme. „Aber nicht nur Bäume allein, sondern auch das Zusammenspiel der verschie-denen Pflanzenarten und Baumgattungen. Nicht zu vergessen die Tiere, die den Braddleneck Darkwood ihr Zuhause nennen.“
„Das klingt wahnsinnig spannend“, meinte Drystane voll Sarkasmus, der von Corvin unbemerkt blieb.
„Ja, ich weiß, es wird ziemlich aufregend. Stell dir vor, was wir dort alles erleben werden. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, all das Gesehene festzuhalten, um es immer und immer wieder anzusehen, auch wenn die Reise längst vorbei ist.“
„Muss ich in Erwägung ziehen, eine Truppe von Malern zu engagieren, die uns begleitet und alles auf Papier verewigt?“, lachte Franco.
Drystane grinste: „Ich kann euch ein paar Pressezeichner mitgeben.“
Corvin erkannte, dass man sich über ihn lustig machte, und schnitt eine Grimasse. „Ha ha ha. Ihr beiden seid ja so witzig. Für die Tatsache, dass ihr sonst meist einen Stock im Arsch habt.“
„Was?“, entfuhr es Drystane. „Ich?“ Er schüttelte den Kopf und deutete auf Franco: „Der da vielleicht, ich gewiss nicht.“
Empört stieß Franco Luft aus. „Das ist doch... also...“
„Ja, hat er auch“, zuckte Corvin mit den Schultern. „Meinen.“
„Corey!“, tadelte Franco errötend und wischte sich über die pockennarbigen Wangen, während Drystane laut auflachte.
Wie gewohnt zeigte Corvin sich von der Rüge seines Ehe-mannes unbeeindruckt. „Ist doch wahr.“
„Möchte noch jemand Tee?“, fragte Drystane und erhob sich, obgleich verneint wurde. Schwarze Flecken tanzten flüchtig vor seinen Augen, doch waren verschwunden, als er im Küchenbereich ankam. Unauffällig rieb er sich die halb erfrorenen Hände. Würde er sie jetzt zu Fäusten formen, würden ihm alle Knochen brechen – klirrend wie Eiszapfen.
„Jedenfalls möchten wir dich zum Dinner einladen, sobald wir wieder zuhause sind“, sagte Franco, als er seine Verlegen-heit verscheucht hatte. „Corey hat meine Möbel fertig-gestellt.“ Er senkte das Haupt und blinzelte. Sein Lächeln mutete dermaßen glücklich an, wie Drystane es nie zuvor an ihm gesehen hatte.
„Sehr gerne“, nahm er die Einladung an. Er kramte nach einer frischen Tasse und beobachtete unauffällig, wie Corvin nach der Hand seines Gatten griff, um sie zu streicheln. Wie liebevoll sie einander ansahen...
Drystane schenkte sich ein und warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Torte – dunkler, saftiger Teig mit weißer Schokoladen-Buttercreme. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen und sein Magen knurrte, aber sein Wille, mit der Mode mitzuhalten, war stärker und er verweigerte es sich, auch nur zu kosten. Er wollte das Gewicht, das er mühsam verloren hatte, nicht gleich wieder auf die Rippen bekom-men. Zum Trost gestattete er sich, ein halbes Löffelchen Zucker in seinen Mirabellentee zu rühren.
Gerade wollte er sich mit seinem Getränk, das ihm statt einer ordentlichen Mahlzeit den Bauch füllen sollte, wieder zu seinen Gästen vor den Kamin gesellen, da fiel jemand in sein Apartment ein.
Es war sein wichtigster Spitzel. Der Bursche war kaum zehn Jahre alt, doch konnte rennen, wie ein Wanderfalke das Fliegen beherrschte, und war schlau wie ein Fuchs – und er konnte die Stimme eines Singvogels nachahmen wie kein zweiter, was ihm seinen Spitznamen einbrachte.
„Eilbrief! Privat“, keuchte er und stützte sich an den Knien ab, um zu verschnaufen, ehe er das Schriftstück gegen ein Ascot Biscuit tauschte.
„Ich danke dir, Sperling.“ Damit entließ er den Jungen und schloss eilig die Tür, um nicht noch mehr von dieser ver-dammten Kälte einzulassen.
„Ruft die Arbeit?“, fragte Franco.
Drystane schüttelte den Kopf. „Meine Mutter.“ Für gewöhnlich meldeten sich seine Herrschaften zum Winterfest, zu seinem Geburtstag und ganz selten zum Frühlingsreigen. War etwas mit seinem alten Vater? War jemand krank ge-worden oder gar...?
Mit einem Anflug von Nervosität brach er das Siegel und holte eines der dicken Pergamentblätter hervor, die seine Mutter zum Schreiben von Briefen benutzte. In seinem Kopf hörte er ihre rauchige, gutmütige Stimme, während er die Worte las, die an ihn gerichtet waren.
Mein lieber Drystane,
zu meinem allergrößten Bedauern erreichte mich unlängst ein Brief von einem deiner Freunde, in dem er mir mitteilte, dass du dich ihm gegenüber unflätig benimmst. Ich hatte geglaubt, in deinem Alter nicht mehr in die Bedrängnis zu kommen, dir eine Predigt halten zu müssen, aber in Anbetracht der Schilderungen deines Freundes scheint mir eine solche angebracht. Ich habe dich nicht dazu erzogen, dich anderen gegenüber unfreundlich zu gebaren.
Wovon zur Hölle sprach sie? Drystane legte die Stirn in Falten und schüttelte abermals das Haupt, um seine Verwirrung zum Ausdruck zu bringen.
Sei immer lieb und nett, denn das macht auch die größten Makel wett.
Das habe ich dir stets eingebläut und gehofft, du würdest dich daran halten. Immerhin kannst du recht enervierend sein, das weißt du doch, mein Lieber. Ich möchte nicht, dass du einen Freund verlierst, weil du dich nicht zu benehmen weißt. Wenn du höflich zu jeder-mann bist, ist mit Sicherheit nicht jedermann höflich zu dir, aber diejenigen, auf die es ankommt, werden den angenehmen Charakter-zug zu schätzen wissen. Du weißt, dass ich nur dein Bestes im Si
Warte, Liebling. Dein Vater möchte ein paar Zeilen schreiben.
Mach mir keine Schande dort drüben! Sonst packt mich deine Mutter in eine Kutsche und ich komme und versohle dir den Hintern. Glaub mir, dazu bin ich noch nicht zu gebrechlich. Also benimm dich gefälligst!
So, mein Schatz, ich bin es wieder – deine Mutter. Nimm dir zu Herzen, was ich sage, und sei lieb zu Mr Giancovelli!
An dieser Stelle glaubte Drystane, gleich zu explodieren. Er stieß einen Laut des Zornes hervor und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. „Dieser verdammte Mistkerl!“, kreischte er und brauchte all seine Selbstbeherrschung, um nicht das Ge-schirr aus den Schränken zu reißen und zu Scherben zu zer-schlagen. „Was glaubt der eigentlich, wer er ist?! Was glaubt er, welche Freiheiten er sich herausnehmen kann?!“
„Um Himmels willen, was ist passiert?“ Franco war aufge-standen und kam näher – so zögerlich, als hätte er Angst, Drystane könnte ihm etwas antun.
„Giancovelli, dieser Bastard! Er hat meinen Eltern geschrie-ben! Meinen Eltern, kannst du dir das vorstellen?“
Corvin war nicht so zaghaft wie sein Ehemann. Er erhob sich und nahm ihm den Brief aus der Hand. Gleich darauf grunzte er amüsiert.
„Du findest das lustig?“, forderte Drystane zu wissen und brachte Franco mit seiner Tonlage dazu, das Gesicht zu ver-ziehen.
„Ein bisschen, ja. Und ziemlich kindisch für zwei Männer in eurem Alter“, gestand Corvin. „Warum hasst ihr beiden euch so sehr?“
„Drystane ist Journalist und Giancovelli jener Polizist, der die Presse von Tatorten fernhält. Sie sind natürliche Feinde“, klärte Franco auf.
Corvin gab sich damit nicht zufrieden. „Das kann doch nicht alles sein.“
War es auch nicht, aber Drystane würde sich hüten, ein einziges Wort darüber zu verlieren. „Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat.“
„Die Frage ist, was du getan hast, um ihn zu diesem, zugegeben recht ungewöhnlichen, Schritt zu zwingen“, schlug Franco sich auf Giancovellis Seite.
„Gar nichts habe ich getan, ich wollte bloß...“ Er hatte helfen wollen, aber das konnte er nicht offen gestehen. Derartiges würde seiner – von ihm gehegten und gepflegten – Repu-tation als Rufmörder schaden.
„Ihn fertigmachen?“, schlug Corvin erheitert vor.
Statt einer Antwort schlüpfte Drystane in seine Stiefel, wobei er wegen des Schwindels fast den Halt verlor und sich am Mauerwerk festkrallen musste.
„Drystane, geht es dir nicht gut? Wo willst du hin?“, fragte Franco.
„Nein, mir geht es ganz und gar nicht gut! Ich gehe zu Giancovelli! Jetzt ist er fällig“, donnerte Drystane, riss seinen Mantel vom Haken und schlüpfte hinein, wobei er sich zwei Mal verhedderte und fluchend von Neuem beginnen musste.
„Meinst du nicht, dass du überreagierst?“, warf Corvin ein.
„Nein! Nein, ich meine nicht, dass ich überreagiere! Der Mann ist so gut wie tot!“ Gerade wollte er nach der Türklinke greifen, doch noch ehe er das Metall in den Händen hielt, wurde ihm schwarz vor Augen.
Der See, der mehr einem Teich glich, schlug sanfte Wellen und das Wasser reflektierte die Sonnenstrahlen.
Gero pendelte von einem Baum zum gegenüberliegenden, um zu prüfen, welches Tier daran vorbeigekommen war, und anschließend eine hündische Nachricht zu hinterlassen. Seine Rute schwankte hin und her.
Ein kühler Windstoß zerzauste Donatien das Haar und fuhr ihm unters Hemd. Er trug keinen Mantel. Das stakische Blut seiner Vorfahren, das in seinen Adern pulsierte, machte ihn unempfindlich gegen Kälte. Und Gefühle.
Unvermittelt hielt Gero inne. Er erstarrte, den Schwanz gerade nach hinten gestreckt, ein Vorderbein angehoben. Er witterte eine Fährte.
„N-n“, warnte Donatien, um den Hund davon abzuhalten, auf die Jagd zu gehen. Dann begriff er, dass das gar nicht Geros Absicht war. Er hatte bloß etwas gehört, das Donatien erst jetzt vernahm.
Jemand brüllte seinen Namen durch den Wald.
„Giancovelli!“
Marshall, stellte er innerlich knurrend fest. Dann grinste er flüchtig. Sein Brief war also angekommen.
„Wo seid Ihr, durchtriebener Mistkerl?! Zeigt Euch! Oder habt Ihr Angst vor mir?“
Angst vor ihm? Der Kerl hatte offenbar seinen letzten Rest Verstand mit Puder überdeckt. Vielleicht hatte er auch zu viel Parfum eingeatmet und konnte nicht mehr klar denken. Wer wusste das schon? Niemand. Es interessierte auch niemanden. Am allerwenigsten ihn.
Mit einem Klopfen gegen seinen Oberschenkel wies er Gero an, an seiner Seite zu bleiben. Zu seiner Verwunderung glaubte er, Widerwillen zu spüren, obgleich Gero sonst ein gehorsamer Begleiter war. Er wich für gewöhnlich kaum von ihm, doch nun schien Marshalls Stimme ihn magisch anzuzie-hen. Merkwürdig und gar nicht nach seinem Geschmack.
Entschlossenen Schrittes marschierte er dem Journalisten entgegen, um sich ihm zu stellen und zu beweisen, dass er ihn ganz gewiss nicht scheute. Weder ihn noch seine flinke Federspitze, mit deren Hilfe er schon so manch bedauerns-werte Seele in den Abgrund getrieben hatte.
„Kommt endlich raus, verdammter Arsch!“, zeterte Marshall. „Ich sehe Eure Fußspuren und die Pfotenabdrücke Eures Hundes! Ich kann auch durch den Schnee waten und zu Euch kommen, aber glaubt mir: Das wollt Ihr nicht! Ihr wollt nicht, dass ich komme und Euch hole! Denn wenn Ihr mich zwingt, durch den Schnee zu wandern, werde ich verflucht wütend!“
Wahnsinnig beeindruckend. Donatien verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf über diese Idiotien. Wenig später hielt er inne, weil er Marshall zwischen den Bäumen er-blickte.
Ganz in schwarz gekleidet stand er an der Lichtung neben Donatiens Haus. Seine Kleidung schmiegte sich wie gewohnt an ihn und machte einen darauf aufmerksam, dass er dürr war. Seit es in der Stadt in Mode gekommen war, bis auf die Knochen abgemagert zu sein, hatte er abgenommen. In recht bedenklichem Maße, doch der Kerl war alt genug, um selbst zu wissen, was er tat. Er trug keine Kopfbedeckung und seine Frisur ließ die für ihn typische Sorgfalt vermissen. Sein Haar war zerzaust, anstatt ihm, mit reichlich Pomade dazu gebracht, wie geleckt am Kopf zu kleben. Sah gut aus...
Und schon wieder lief Donatien das Wasser im Mund zusammen. Er schluckte angestrengt und fluchte stumm über vielerlei Dinge.
Herrgott, Marshall war attraktiv, ja! Aber doch nicht in einem solch gewaltigen Ausmaß, das es rechtfertigen würde, dass Donatien jedes Mal sabberte wie ein Hund, wenn er ihn sah!
„Giancovelli!“, keifte Marshall. „Kommt raus!“
Als Gero den Zeitungsschreiber entdeckte, stürmte er ent-gegen des Befehls auf den Mann zu, um ihn wild wedelnd zu umkreisen und zu beschnüffeln. Er freute sich über dessen Anwesenheit! Ganz im Gegensatz zu einem völlig entsetzten Donatien, der sich nichts sehnlicher wünschte, als dass Marshall ganz einfach verschwinden würde – gleichgültig auf welche Weise. Seinetwegen könnte sich der Erdboden unter dem Trottel auftun und ihn verschlingen. Es wäre ihm gleich, solange er ihn nur nicht mehr vor sich hätte.
Marshall beugte sich vor und tätschelte Gero den Kopf, wobei er ihm etwas zuflüsterte. Nun machte der Dreckskerl ihm auch noch seinen Hund abspenstig!
Donatien klatschte in die Hände, um Gero auf sich auf-merksam zu machen. Dieser schien seine Wut zu spüren, denn er riss sich von Marshall los, und kam zu ihm, um sich brav bei Fuß einzufinden.
Marshalls dunkler Blick folgte Gero und traf gleich darauf auf jenen Donatiens. Seine Augen wurden schmal. Seine Wangen waren trotz des vielen weißen Puders merklich gerötet. „Ihr! Was bildet Ihr Euch ein? Was bildet Ihr Euch eigentlich ein?!“ Unwirsch trat er gegen einen kleinen Schnee-haufen, um die weiße Masse aufzuwirbeln.
Donatien kam näher und zeigte Marshall mit drei flinken Handbewegungen, was er von seinem Benehmen hielt.
„Ach, ich sehe aus wie ein Irrer, ja? Und das muss ich mir von dem Arschloch anhören, das einen Brief an meine Eltern geschrieben hat!“
Wieder reichten ein paar Gesten aus, um Marshall ver-stehen zu lassen.
„Ich soll schweigen, sonst werdet Ihr es wieder tun? Ich hatte nicht vor, jemandem von Eurem Besuch bei Hallcox zu erzählen, blöder Ochse! Wen würde das interessieren? Ihr geht zu einem Seelenklempner! Na und? Glaubt Ihr, Ihr seid dermaßen bedeutungsvoll, dass ich über Euch schreibe? Darauf könnt Ihr lange warten! Wie sollte der Artikel denn auch heißen? Der Inbegriff von Biederkeit? Ihr seid so langweilig, dass die halbe Stadt tot umfallen würde, müsste sie über Euch lesen!“
Der war gut, musste Donatien zugeben. Er ließ sich seine leise Belustigung jedoch nicht anmerken, sondern deutete Marshall, zu verschwinden.
„Ich soll abhauen? Ja, das würde Euch so passen. Aber erst werdet Ihr Euch entschuldigen. Und dann werdet Ihr mir schwören, meine Eltern aus diesem Krieg rauszuhalten. Vor-her rühre ich mich nicht vom Fleck!“
Donatien zog die Augenbrauen in die Höhe und ging mit einem unwilligen Gero im Schlepptau an einem verrückt gewordenen Marshall vorbei in sein Haus. Zur Beendigung der irren Diskussion knallte er die Tür so fest in die Angeln zurück, wie es ihm möglich war.
Und während er sich auf sein Bett fallen ließ, um mit zusammengebissenen Zähnen und geballten Fäusten an die Decke zu starren, verweilte Gero fiepend am Fenster, um Marshall zu beobachten.
Es dauerte eine geschlagene halbe Stunde, in welcher der durchgeknallte Reporter sein Durchhaltevermögen bewies, bevor er den Rückzug antrat. Seine inzwischen heiser ge-wordene Stimme entfernte sich immer weiter und als sie nicht mehr zu hören war, schnappte Donatien nach Luft, ehe er das Gesicht in seinem Kissen vergrub, um die Schluchzer der Wut zu dämpfen.
Gero sprang auf das Bett und kuschelte sich an ihn.
Donatien umarmte ihn und ließ zu, dass sein Hund ihm den langschnäuzigen Kopf in die Mulde zwischen Hals und Schul-ter legte, während draußen jene Stille einkehrte, die ihn dazu bewogen hatte, diesen abgeschiedenen Ort zu seinem Heim zu machen.
4
U
nruhig durchstreifte Drystane sein Büro. An diesem Tag war nicht einmal daran zu denken, ein Wort zu Papier zu bringen.
Es drängte ihn, mit jemandem zu reden. Darüber, was ihn beschäftigte und nicht losließ. Doch da war niemand, dem er sich anvertrauen konnte. Franco und Corvin waren in den frühen Morgenstunden abgereist. Und nach seinem Ohn-machtsanfall, nach dem Corvin sich nur mit Mühe und Not davon hatte abhalten lassen, einen Arzt zu holen, wäre es ohnehin klüger, sich zukünftig ein wenig zurückzuhalten. Nicht dass seine Freunde auf die Idee kamen, einen Nerven-doktor kommen zu lassen.
Nachdem Giancovelli ihm gestern jegliche Genugtuung verwehrt hatte, loderte das Feuer ihres gegenseitigen Hasses höher und heller als je zuvor. Drystane verlangte es nach Rache, doch Giancovelli verhielt sich allem gegenüber so – stakisch