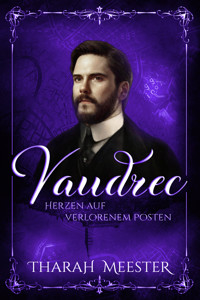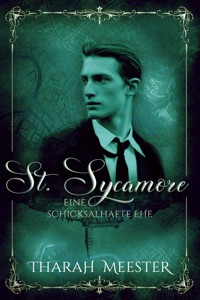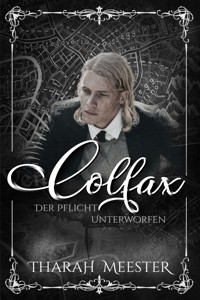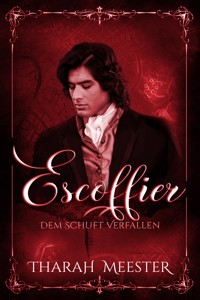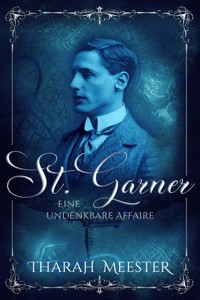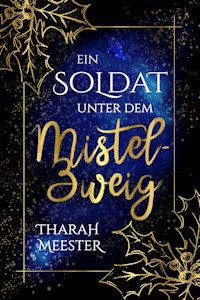6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einer öffentlichen Demütigung ist Hyacinthe Black kurz davor, von seinem Vater zu Tode geprügelt zu werden. Ausgerechnet der Mann, den die Leute nur 'Eure Abscheulichkeit' nennen, nimmt ihn in Schutz, doch sein Eingreifen hat einen Preis. Hyacinthe muss seinen Retter ehelichen. Seit dem Mord an seinem Bruder ist Gavrila Ardenovic einem Geheimbund auf der Spur, doch in der Stadt, in der er nur verspottet wird, hat er wenig Verbündete. So hält er sich von anderen Menschen fern und ist daran gewöhnt, jegliche Gefühlsregung zu unterdrücken. Werden Lügen und Intrigen die Oberhand gewinnen oder kann es Hyacinthe gelingen, die Schatten der Vergangenheit zu bekämpfen und die kaltherzige Fassade seines Mannes zu durchdringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tharah Meester
Der Liebreiz einer Hyazinthe
Ascot Crime and Drama
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Autorin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Zur Autorin
Impressum
Vorwort der Autorin
Lieber Leser, liebe Leserin!
Da ich schon des Öfteren jemanden mit einem Song-Tipp zu einem meiner Romane begeistern konnte, möchte ich dieses Mal gleich am Anfang das Wort an euch richten und sagen, dass Zombie von Maître Gims für mich DAS Lied zu diesem Buch ist. Es bedeutet mir unglaublich viel, ebenso wie dieser Roman mit seinen außergewöhnlichen Charakteren.
Wer wissen möchte, was ich sonst noch gehört habe, darf gerne nachlesen auf www.tharahmeester.com.
Ach ja, und noch etwas... Diese Geschichte ist ein wenig anders, als meine anderen.
Kapitel 1
Ascot, Jahr 599
In den riesigen Fenstern spiegelte sich der Kerzenschein. Der Schnee wirbelte hinter dem Glas. In seinem Rücken vergnügten sich die Leute, doch Hyacinthe hatte kein Interesse daran, mit jemandem zu tanzen oder sich zu unterhalten.
Er sah keinen Sinn darin. Diese Bälle, zu denen seine Familie nur geladen war, weil ein alter Freund seines Vaters diesem einen mächtig großen Gefallen schuldete, waren dazu da, jemanden zum Heiraten zu finden. Welcher dieser reichen, gebildeten Männer würde ihn heiraten wollen? Kaum jemand schenkte ihm Beachtung und er würde es gar nicht anders wollen.
So stand er von den Menschen abgewandt am Rande des großen Saales und beobachtete die Gäste, indem er ihre fahlen Ebenbilder in den Fenstern musterte. Einer davon stand wie immer etwas abseits.
Es war Gavrila Ardenovic, den sie meist nur mit 'Eure Abscheulichkeit' betitelten. Seine auffallende Hässlichkeit war der Grund dafür. Sie veranlasste ihn dazu, seinen Blick etwas länger auf dem Mann mittleren Alters ruhen zu lassen. Das schulterlange, tiefschwarze Haar war wie stets zu stark geölt und verdeckte sein halbes Gesicht. Jedoch konnte es nicht die überlange Nase verbergen, die...
Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie Inspektor Hathaway die Bühne betrat. Das Herz setzte ihm einen Schlag aus, als die Musik unheilvoll verstummte. Der Mann war ihm letzte Nacht in den Gossen untergekommen, hatte ihn... hatte ihn gesehen.
»Ich bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit!«, brüllte der braunhaarige Mann mit dem buschigen Schnurrbart und es wurde ruhig im Saal. »Ich habe eine Verkündung zu machen, die gewiss alle hier brennend interessiert!«
Der Chef de police hatte ihn dabei gesehen, wie er mit dessen merkwürdigem Sohn gestritten hatte. Einem Freier, den Hyacinthe abgewiesen hatte, wie er es seit Monaten mit jedem tat, weil er nicht mehr anders konnte.
Schwer atmend klammerte er sich an die Stuhllehne seines Vaters, der ihn in wenigen Momenten nach draußen zerren und auf ihn losgehen würde. Seine Mutter, die missmutig zu Inspektor Hathaway hinübersah, würde ihn nicht vor seinem Schicksal bewahren. Eher würde sie froh sein, ihn endlich loszuwerden.
Es gab nur zwei Arten, auf die diese Sache hier enden konnte. Entweder würde sein Vater ihn auf der Stelle umbringen. Oder er würde ihn auf die Straße werfen. Im letzteren Falle würde es Hyacinthe noch dreckiger gehen als bisher.
In seinen Augen sammelten sich Tränen. Tränen, die er seit Jahren nicht mehr geweint hatte. Doch in dieser Sekunde quälten sie ihn heiß und brennend.
»Bedauerlicherweise musste ich mit eigenen Augen sehen, dass einer der hier Anwesenden sich auf ekelhafteste Weise kompromittieren ließ«, fuhr der Inspektor fort und sein Blick traf ihn auf unangenehmste Weise.
Dreckiger Lügner! Gar nichts hast du gesehen! Es gab gar nichts zu sehen! Innerlich schrie er den rachsüchtigen Mann an, der ihn vielleicht das Leben kostete, bloß weil er sich in seinem Stolz gekränkt fühlte.
Ein Raunen ging durch die Menge. Hyacinthe hielt den Atem an, als die Leute sich neugierig umsahen. Mit einem Mal hatte er das Gefühl, dass alle Blicke auf ihn gerichtet waren. Stechend, schmerzend, beschämend.
»Letzte Nacht wurde ich zu einer Absinthbar gerufen, da sich dort ein Verbrechen zugetragen hatte. Als ich durch die Gassen eilte, entdeckte ich einen jungen Mann, der sexuelle Dienste für finanzielle Gegenleistungen anbot.«
Nun zogen die Leute scharf Luft ein und begannen zu tuscheln. Hyacinthe hatte das Gefühl, er müsse sich auf den Marmor übergeben. Ihm war so schwindlig, als hätte er wieder getrunken, um all diese Dinge leichter zu ertragen.
»Es tut mir leid, seinen Namen aussprechen zu müssen, doch ich möchte die anwesenden Damen und Herren davor bewahren, um den Mann zu freien, der so große Schuld auf sich geladen hat. Josephinian Hyacinthe Black ist der Schandfleck auf seines Vaters weißer Weste.«
Plötzlich war es schrecklich still um ihn herum. Sein Vater straffte die Schultern und wischte sich über die Stirn, ehe er sich langsam erhob.
»Es tut mir leid«, wisperte Hyacinthe tränenerstickt und vermied es, seiner hasserfüllten Mutter in die Augen zu sehen. Was sie von ihm denken musste? Dabei war es eben diese, seine kaputte Familie, für die er sich erniedrigt hatte.
»Das ist Denunziation, Hathaway! Habt Ihr Beweise für diese Anschuldigung?«, mischte sich Gavrila Ardenovic unvermittelt und zur Überraschung aller ein.
Hyacinthe warf dem stets kränkelnden und leichenblassen Mann einen flüchtigen Blick zu, sah ihn jedoch bloß verschwommen. Die langgliedrigen Finger umschlossen den Stiel seines Champagnerglases so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten.
»Die Tränen der Schuld sind Beweis genug!«, gab der Inspektor lautstark zurück. »Schande über Euer Haupt, Black! Hiermit seid Ihr aus der guten Gesellschaft verbannt. Lebt Euer Leben als Gebrandmarkter, als Gefallener in den Gossen der Stadt, doch lasst Euch hier nicht mehr blicken.«
Unvermittelt packte sein Vater ihn am Oberarm und schleifte ihn nach draußen, in die kalte Nacht hinaus. Der große Mann warf ihn gegen eine Wand aus dunklen Ziegelsteinen und legte ihm die Hand an den Hals, um zuzudrücken.
»Zur Hölle, was habe ich für ein verdammtes Stück Dreck großgezogen?«
Hyacinthe wurde die Möglichkeit zum Atmen geraubt und er sah voll Schock in die dunklen, beinah schwarzen Augen seines Vaters.
»Joseph!«, zischte seine Mutter und wollte seines Vaters Arm zurückziehen, was dieser ihr nicht gestattete. »Du bringst ihn noch vor aller Leute Augen um! Die bringen dich ins Gefängnis und was soll dann aus mir werden?!«
Es ging ihr nicht um ihn, sondern nur um den guten Ruf, den sie nicht besaß.
»Bitte hör auf«, keuchte Hyacinthe mühsam und versetzte seinem Gegenüber einen Stoß gegen die breite Brust. Ihm wurde langsam schwarz vor Augen. Die Schneeflöckchen, die wild durch die Luft tanzten, brachten ihm weiteren Schwindel ein.
»Was hast du dir dabei gedacht, verfluchtes Miststück?« Sein Vater schüttelte ihn kräftig und ignorierte die panische Gegenwehr. Würde er ihn tatsächlich vor all diesen Menschen und dem Inspektor, der dort drinnen im Ballsaal stand und vermutlich seine Rache genoss, umbringen? Er traute es ihm zu. Diesem Mann traute er alles zu.
»Ich wollte euch doch nur helfen.« Es war die Wahrheit. Er hatte es gut gemeint, ihnen ein wenig Geld beschaffen wollen, das er auf anderem Wege nicht hätte bekommen können. Weil er dumm war. Ohne Ausbildung, ohne Talent.
»Du hast uns ruiniert! Sie nur, wie sie uns anstarren. Du hast ihre Vorurteile bestätigt und dich wie das Gesindel aufgeführt, das sie erwarteten!«
Alles drehte sich immer schneller, immer heftiger. Gewiss würde er alsbald das Bewusstsein verlieren und durch die Hand seines eigenen Vaters das Leben lassen. Der Mann verabscheute ihn so sehr, dass er ihn lieber in aller Öffentlichkeit und ohne Rücksicht auf die Konsequenzen tötete, als ihn rauszuwerfen. Und seiner Mutter war alles einerlei. So gleichgültig wie es den Gästen war, von denen ihnen manche nach draußen gefolgt waren und andere sich an den Fenstern versammelt hatten. Er war ihnen egal, sie wollten nur mitverfolgen, wie diese Sache ausging. Und sie würde es bitterböse tun.
»Genug«, beendete eine harte, kalte Stimme die Szene.
Hyacinthe vernahm, wie der Hahn eines Revolvers gespannt wurde und in der plötzlichen Stille danach hörte er nur noch seinen eigenen Herzschlag.
Nach einem kurzen Zögern wurde er freigegeben und wäre kraftlos zur Erde gesunken, wenn nicht eine knochige Hand nach seinem Oberarm gegriffen und ihn in die Höhe gezogen hätte. Eine nahende Ohnmacht bekämpfend sank er gegen Ardenovic, der sich hier einmischte, als würden ihn diese Belange etwas angehen.
Sein Vater schien kurz davor, auf den Mann loszugehen. Die Ader an seiner Schläfe pochte wild. »Was bildet Ihr Euch ein? Ich kann über meinen missratenen Sohn verfügen, wie es mir beliebt.«
»Dann versucht es, Black. Wenn Ihr allerdings glaubt, ich hätte Skrupel, Euch zu erschießen, irrt Ihr Euch«, gab Ardenovic zurück und hielt die Pistole völlig ruhig gegen Hyacinthes Vater gerichtet. »Ich werde den Jungen ehelichen.«
Hyacinthe stockte der Atem. Ardenovic wollte die Schande von ihm nehmen? Ihn unter seinen Schutz stellen? Was hatte er davon?
Die Menge murmelte aufgebracht, schien nicht zu glauben, was sie hörte und was hier vor sich ging. Ebenso wenig wie er.
Diese Nacht hatte sich in einen Albtraum verwandelt, der schlimmer schien als die vielen Nächte zuvor. Und er wusste, er würde nicht aufwachen.
Immer noch schloss er die Finger um den schwarzen Stoff Ardenovics Anzugs und barg das Gesicht an dessen Brust, in der ein Herz viel ruhiger klopfte, als es das in Anbetracht der Situation tun sollte. Ardenovic hatte den schlanken Arm um seine Taille geschlungen und hielt ihn fest.
»Ihr wollt was?«, forderte sein Vater ungläubig zu wissen und legte die Stirn in tiefe Falten, die ihn furchterregend aussehen ließen.
»Ihr habt mich gehört. Ich zahle die übliche Ehegabe.«
Wieder keuchte die Menge, weil der Mann dazu bereit war, für einen kompromittierten Jungen zu zahlen. Hyacinthe wünschte, sie würden einfach alle verschwinden, anstatt zu lauschen und ihn weiter zu demütigen.
Seine Eltern wechselten einen irritierten Blick und seine Mutter ergriff das Wort: »Wir akzeptieren Euer Angebot.« Nun war es letzten Endes ihre Gier, die ihm das Leben rettete.
Sein Vater knurrte leise. »Lasst uns das Geld zukommen und macht schnell, damit ich nicht mehr mit diesem dreckigen Ding in Verbindung gebracht werde. Keinen Tag länger soll der Bastard meinen Namen tragen.«
Mit diesen Worten, die sich Hyacinthe ins Herz bohrten, wandte er sich um und packte seine Frau am Arm. Keiner von ihnen wandte sich noch einmal zu ihm um und obgleich er sie ebenso verabscheute, wie sie ihn, schmerzte es tief in seinem Inneren, dass er ihnen weniger als nichts bedeutete.
Zögerlich betrat er das enge Reihenhaus, das zwischen vielen weiteren eingeklemmt schien. Ardenovic hatte einen Priester aus dem Bett geläutet und sie hatten ihren Schwur geleistet.
Wie in Trance hatte Hyacinthe nachgesprochen, was man ihm vorgesagt hatte. Er hatte nicht nachgedacht, weil er wusste, dass diese Eheschließung seine einzige Möglichkeit war, nicht auf der Straße zu landen. Und dort würde er keine Woche überleben...
Nun stand er in einem düsteren Raum, der vollgestopft war mit Büchern, Zeitschriften und Papieren. Die Sachen lagen wild verstreut am Boden herum. Die Tapete löste sich an einigen Stellen von den Wänden. Die Fenster waren völlig verdreckt, ließen das Mondlicht kaum durch. Als Ardenovic eine Lampe entzündete, warfen die Bücherstapel dunkle, unheimliche Schatten.
»Wirf nichts um«, wies der Mann ihn kühl an. »Ins Schlafzimmer.« Er deutete mit der Lampe in Richtung der offenen Tür.
Nach einem trockenen Schlucken setzte Hyacinthe sich in Bewegung, wobei er darauf achten musste, wohin er trat. Die Stellen, an denen man in dieser Unordnung das Parkett hervorblitzen sah, waren rar.
Zumindest das kleine Schlafgemach schien aufgeräumt und er nahm auf dem Bett Platz.
Ardenovic stellte die Lampe auf die Kommode, auf der sich kein Spiegel befand. Seine Finger nestelten an der Krawatte. »Ich sollte ein paar Regeln aussprechen, um sie klarzustellen.«
Hyacinthe nickte, doch es blieb dem anderen verborgen.
»Kein Absinth mehr, kein Opium mehr und keine anderen Männer mehr. Du bist jetzt mein Eigentum und ich erwarte Loyalität.« Er hustete hinter vorgehaltener Hand und entledigte sich seines Jacketts, um dann etwas Medizin zu nehmen. Es war ein dunkles Fläschchen, das beinah leer war. »Nachdem du dich in den Gossen fremden Männern hingibst, wird es wohl kein Problem für dich sein, wenn ich meine ehelichen Rechte einfordere?«
Ihm wurde schwindlig. Wäre nun der Moment gekommen, zu sagen, dass er Jungfrau war? Sollte er erklären, dass er diese Kerle lediglich in die Hand oder in den Mund genommen hatte? Würde Ardenovic darauf Rücksicht nehmen?
Im Grunde kannte er die Antwort. Dieser Mann würde ihn ebenso wenig schonen, wie sein Vater es all die Jahre getan hatte.
»Nein«, würgte er mühsam hervor und drängte bittere Tränen zurück.
»Gut, dann zieh das an und leg dich hin«, forderte man rau und reichte ihm ein weißes Nachthemd.
Erbebend tat er, wie ihm geheißen, um sich unter der Decke zu verkriechen. Unter dem Stück Stoff, das ihm keinen Schutz bot.
So viele Nächte, in denen er geglaubt hatte, vor Abscheu und Ekel gegen sich selbst sein Leben nicht mehr zu ertragen und dann wurde ihm eine, in der nichts geschehen war, zum Verhängnis.
Seit Monaten hatte er keinen Mann mehr an sich herangelassen. Er war in jener Nacht nur auf der Suche nach einem Tropfen Absinth gewesen, als Hathaways Sohn ihn angesprochen hatte, um von ihm abgewiesen zu werden.
Ardenovic legte sich zu ihm ins Bett und er starrte stur an die weiße Wand. Er zuckte nicht zusammen, als sich eine kalte Hand an seine Hüfte legte. Die Finger, die ihn berührten, zitterten kaum merklich, während sie über seine Taille strichen und tiefer glitten, um das Nachthemd hochzuschieben. Er ging behutsam vor, doch strahlte zugleich etwas aus, das ihn wissen ließ, dass der Mann keine Gegenwehr dulden würde. Er erkundete seine Oberschenkel und drückte ihm die Beine auseinander.
Hyacinthe hatte Angst, dass es wehtun würde, und versuchte sich zu entspannen. Eiskalte, geölte Fingerspitzen befeuchteten seinen Eingang, drangen in ihn ein, was er beinah mit einem scharfen Einziehen von Luft beantwortet hätte. Er konnte sich beherrschen und ließ Ardenovic gewähren, als dieser sich auf ihn legte.
Wie konnte ein lebendiger Körper nur so schrecklich ausgekühlt sein?
Er erschauderte unter dem Gewicht des Mannes, der ihn vorsichtig in Besitz nahm und schnappte nach Atem, als er bemerkte, diesen angehalten zu haben.
Der andere stöhnte, als er tiefer glitt, und hustete gleich darauf verkrampft.
Der Schmerz, den es Hyacinthe einbrachte, auf diese ihm unbekannte Weise gedehnt zu werden, war beinah unerträglich und die Scham brachte ihm heiße Wangen ein. Um einen Schrei zu dämpfen, vergrub er die Zähne in dem weißen Kissen unter sich.
Er war nie zuvor jemandem so nahe gewesen und obgleich ihn die Nächte in den Gossen eines besseren belehrt haben sollten, hatte er die Hoffnung gehegt, er würde sein erstes Mal mit einem Mann erleben, den er liebte...
Nun war die Bürde, diesem Wunschtraum nachzuhängen, von ihm genommen worden – Ardenovic nahm diese Last von ihm, indem er sich zurückzog und ein weiteres Mal in ihn stieß, um aufkeuchend in ihm zu kommen.
Alles in ihm brannte und er wollte nur noch, dass man von ihm abließ. Ihm war übel und vor seinen Augen drehte sich alles.
Erst als sein Ehemann sich von ihm löste und auf seine Seite des Bettes legte, gewahrte er, dass dieser ihn während des kurzen Zusammenseins kaum berührt hatte.
Eine seltsame, nie zuvor gefühlte Emotion flutete ihn und Tränen liefen ihm unvermittelt über die Wangen. Er weinte sie lautlos, um sich nicht zu verraten, um Ardenovic nicht wissen zu lassen, wie schrecklich schwach und verzweifelt er war.
Verstohlen zog er die Beine an, um sie zu umfassen und sich zu einem Bündel zusammenzurollen. Er wünschte, er könnte sich im Nichts auflösen.
Tat er nicht. Stattdessen lag er den Rest der Nacht in dem fremden Bett mit dem fremden Mann, dessen Husten und Röcheln ihn wachhielt.
Kapitel 2
»Gavrila!«, brüllte Perkovic und hämmerte mit der Faust gegen die verglaste Front des versifften Reihenhauses. »Gavrii!«
Mit einem Knurren wälzte er sich aus dem Bett und warf sich die verrauchte Kleidung des gestrigen Abends über.
Der Junge lag unter der Decke. Er rührte sich nicht, doch seine ungleichmäßigen Atemzüge verrieten, dass er wach war. Er war es seit einer Weile, doch hatte sich offenbar bemüht, sich nicht zu bewegen.
Anstatt ihn anzusprechen, wusch Gavrila sich das Gesicht in der Waschschüssel und ließ dann den Verrückten ein, der sonst wohl eines der verstaubten Fenster zertrümmern würde.
Perkovic stolperte herein und wankte zur Küchentheke hinüber, um seine Weinflasche auf den Tresen zu donnern. »Ich bin zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen!«
»Wenn es nicht die Erkenntnis ist, dass du nicht mehr früh morgens an meine verschissenen Fenster klopfst wie ein Irrer, will ich nichts davon hören.«
»Halt's Maul und hör mir zu! Unten in der Morgue haben wir einen, der ist in der Meln ersoffen.«
»Was interessiert mich das?«, stieß er zwischen zusammengepressten Zähnen hervor und wischte sich über die feuchte Stirn, um sich mit den Fingern durchs Haar zu fahren. Ihm wurde übel, wenn er nur an das verdammte Leichenschauhaus dachte. Er wollte nichts von den Toten darin hören.
Perkovic setzte die Flasche an, um zu trinken, doch bemerkte murrend, dass er sie bereits geleert hatte. »Das wird dich interessieren, wenn ich dir sage, was ich bei ihm gefunden habe.«
»Vielleicht rückst du mit der Sprache raus, bevor mir die Geduld ausgeht, hm?« Er gesellte sich zu Perkovic an die Theke und lehnte sich dagegen, um dem Schwindel nicht zu erlauben, ihn von den Füßen zu reißen.
»Ich hab den aufgedunsenen Kerl mal ein wenig genauer befühlt und dabei...« Der Verrückte unterbrach sich und sah wie vom Donner gerührt Richtung Schlafzimmertür, in deren Rahmen der Junge aufgetaucht war.
Seine blonden Locken waren ungekämmt, seine Miene leidend und seine Kleidung so derangiert, so als hätte er sich nicht viel Mühe damit gemacht oder nicht die Kraft dazu gehabt.
Gavrila wurde bewusst, was er ihm letzte Nacht angetan hatte, und ihn überkam das Gefühl, sich auf seine Schuhspitzen übergeben zu müssen.
Der Gedanke, was sein Bruder hiervon halten würde, drängte sich ihm auf unangenehmste Weise auf und schnürte ihm die Kehle zu.
»Zügle deine Blicke, Perkovic«, knurrte er dem Mann zu, dessen Augen fiebrig über den Körper des jungen Mannes wanderten. »Red endlich weiter.«
»Nun, ich hab den Leichnam durchsucht und das hier entdeckt.« Er zog etwas aus der Tasche seiner zerrissenen Beinkleider und streckte es ihm entgegen.
Gavrila zögerte. Ihm graute bei der Vorstellung, dass diese dreckverschmierten Finger einen Leichnam berührt hatten. Schließlich warf er einen Blick darauf und war schockiert von dem, was er sah. »Das ist...«
»Ich weiß, was das ist. Deswegen bin ich gekommen. Dachte mir, du willst vielleicht mit mir runter in die Morgue.«
Die Morgue. Nein, er wollte dort nicht hin. Er fühlte sein eigenes Kopfschütteln und hörte sich zugleich ein 'Lass uns gehen' murmeln.
Wenn Perkovic eine Kette mit diesem ganz besonderen Anhänger bei dem Ertrunkenen gesehen hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als nachzusehen, ob er den Mann nicht vielleicht gekannt hatte.
»Wusst ich's doch, dass dich das interessiert«, grinste Perkovic zufrieden und griff nach einer vollen Flasche Wein, um sie als Wegzehrung mitzunehmen.
Gavrila ließ ihn gewähren, weil er wusste, dass er sie nicht trinken würde, und warf sich seinen Gehrock über, ehe er sich dem Jungen zuwandte: »Schließ die Tür hinter mir und lass niemanden ein.«
Der Bursche nickte knapp und kaum merklich, doch Gavrila gab sich mit dieser Antwort zufrieden und verließ an Perkovics Seite das Haus.
Als sie das Ende der schmalen, verdreckten Gasse erreicht hatten, warf er einen Blick über die Schulter. Sein Ehemann drehte gerade den Schlüssel im Schloss.
»Wer ist der Hübsche?«, fragte Perkovic und sah ebenfalls höchst interessiert zurück.
»Lass das jetzt«, warnte Gavrila grimmig und stieß ihm gegen den Oberarm. »Er ist mein Angetrauter, also erwarte ich, dass du dich zusammennimmst.«
»Sag ihm bloß nie, dass du ihn liebst. Damit fängt die Misere immer an«, lachte Perkovic freudlos und nahm einen Schluck.
»Ich liebe ihn nicht.« Gavrila vergrub die Hände tiefer in den Taschen seines Rockes. Zu einer solch heftigen Gefühlsregung war sein kaltes Herz gar nicht fähig.
Perkovic sah ihn misstrauisch an. »Warum hast du ihn dann geheiratet?«
»Um ihn zu beschützen.« Seine Stimme klang heiser und er musste husten.
»Warum ist dir seine Sicherheit wichtig, wenn du ihn nicht magst?«
»Ich sagte nicht, dass ich ihn nicht leiden kann, und jetzt Schluss mit dieser sinnlosen Diskussion«, forderte er in einem Ton, der den Säufer tatsächlich zum Schweigen brachte.
Statt ihn weiter zu ärgern, begutachtete er die Kette. »Denkst du, hatte der Typ was mit Dimitrij zu tun?«
Als der Name seines Bruders fiel, schluckte er hart. »Wir werden es herausfinden.« Zumindest erhoffte er sich neue Erkenntnisse. Vielleicht würden ihn diese vor dem nahenden Absturz bewahren. Sein Leben war ein Haufen Dreck. Wenn er bloß herausfinden könnte, was damals geschehen war, hätte er vielleicht die Kraft, umzukehren, ehe er in den Abgrund stürzte, der sich vor ihm aufgetan hatte und seit einer Ewigkeit nach ihm gierte.
Nachdem er noch eine Weile im Bett gelegen und an die weiße, von Rissen durchzogene Decke gestarrt hatte, stand er auf, um seine neue Bleibe zu erkunden.
Der Hintern tat ihm immer noch weh und ließ ihn die Scham kaum vergessen. Er hatte ein wenig geblutet, was ihm Sorgen machte. Er wusste nicht, ob das normal war. Ob es jedem jungen Mann beim ersten Mal passierte oder ob er sich darüber ernsthafte Gedanken machen musste.
Das Schlafzimmer war ein winziger Raum. Bis auf das Bett mit den Nachttischen, die Kommode mit den Medizinfläschchen darauf und einem schmalen Kleiderschrank war es leer. Vor dem Fenster hing ein schwarzer Vorhang, den man nicht vorziehen konnte, weil er an die grauverschleierte Wand genagelt war. Trostlos.
Der Wohnraum war groß, doch vollgestopft mit all dem Papierkram, durch den er letzte Nacht hatte wandern müssen. Die Fenster waren so verdreckt, wie sie im Dunkeln gewirkt hatten. Die Vorhangstangen waren leer, so konnte jeder Mensch von der Gasse aus einen Blick hereinwerfen.
In der Mitte der Fensterfront befand sich die ebenfalls verglaste Eingangstür. Auf dieser hatte einmal etwas gestanden, bis man die schwarzen Buchstaben bis zur Unkenntlichkeit zerkratzt und teilweise entfernt hatte.
Die Wand zu seiner Rechten bestand, bis auf den Kamin, beinah gänzlich aus Bücherregalen. Sie waren in die Mauer eingearbeitet und reichten von der Erde bis zur Decke. Sie waren leer, was ihm ein freudloses Lachen abverlangte, weil er sich fragte, warum zum Teufel der Mann die Bücher nicht ins Regal stellte, sondern sie am Boden stapelte, sodass kaum ein Zentimeter freiblieb.
Er beugte sich hinab und griff nach einer der Zeitungen. Das Datum lag beinah ein Jahr zurück. Neun Monate.
Wozu sammelte Ardenovic alte Tagesblätter? Und warum konnte er sie nicht irgendwo einräumen, wenn er sie schon nicht wegwerfen wollte?
Vor dem Kamin befand sich ein Esstisch samt Sitzgelegenheiten und gegenüber der Fensterfront stand ein Sofa an der Wand. Davor zwei alte Lehnstühle und dazwischen ein Tischchen. Ohne Ausnahme war das Mobiliar zugemüllt mit Zeitungen, losen Zetteln und Büchern.
Zu seiner Linken wurde die Verglasung irgendwann von weißem Mauerstein abgelöst, um den Küchenbereich vor den Leuten draußen abzuschirmen. Sie war ein kleines U. An der Wand standen Kästen samt Arbeitsfläche, an der Außenmauer befand sich der Ofen und rechts die kleine Theke, die an eine Bar erinnerte. Alles in einem vergilbten weiß. Vielleicht könnte man mit viel Geduld und noch mehr Seifenlauge wieder etwas Glanz in dieses verdreckte Heim bringen, doch er war nicht Ardenovics Hausmädchen!
Mit einem Seufzen wandte er sich von dem Chaos ab, das kein Gefühl von Gemütlichkeit aufkommen ließ.
Eine schmale Tür führte ihn in die Speisekammer, deren Inhalt zu wünschen übrig ließ. Er griff nach einem Stück Brot und bemerkte, dass es bereits hart war. Dennoch kaute er darauf herum, weil sein leerer Magen dringend nach Nahrung verlangte.
Umso mehr er entdeckte, umso weniger verwunderlich fand er die Tatsache, dass Ardenovic ihn aus den Fängen seines Vaters befreit hatte. Der Mann erwartete wohl tatsächlich, in ihm eine Haushaltshilfe gefunden zu haben, die das alles in Ordnung brachte. Hyacinthe würde sich jedoch weigern, einen Finger zu rühren! Er war nicht der Diener seines Ehemannes!
In einer unwirschen Bewegung wischte er sich kalten Schweiß von der Stirn und nahm einen weiteren Bissen von dem Brot, das ihn beinah die Zähne kostete.
Hinter einer Tür neben dem Sofa fand er das Badezimmer samt Wanne. Er schenkte dem Raum nicht viel Beachtung, weil es nichts zu sehen gab.
Einzig die Tatsache, dass Ardenovic nicht mal einen Spiegel besaß, war erwähnenswert.
Eine schmale, schmiedeeiserne Wendeltreppe führte ihn nach oben und er erblickte die vielen Kisten auf dem Boden. Es schien, als wäre Ardenovic gerade dabei, umzuziehen. Dabei war es in Wirklichkeit wohl eher so, dass er sich nach seinem Umzug nicht die Mühe gemacht hatte, seine Sachen auszupacken. So, als hätte er nicht vorgehabt, lange zu bleiben.
Neben einer der Holzkisten ging er in die Hocke. Wahllos griff er hinein und zog etwas Seltsames hervor. Es war ein hohles Rohr aus feinem Holz. An einem Ende des Dings befand sich ein Loch und er hielt es sich ans Auge, um hineinzusehen. Nichts. Nur Dunkelheit. Interessiert befühlte er die Gerätschaft, deren Zweck er sich nicht vorstellen konnte. Er schob das Rohr in die Tasche seines Gehrocks und kramte weiter in Ardenovics Sachen, verlor jedoch das Interesse, als er nur weitere Bücher fand, deren fremdsprachige Titel ihm so absonderlich vorkamen, dass er sie nicht mal aufschlug.
Ein Seufzen entrang sich seiner Kehle, als er sich kurz auf den kalten Holzboden setzte, um nachzudenken. Er hasste es hier. Und er hegte den Verdacht, dass er auch Ardenovic hassen würde, sobald sie sich näher kennenlernten.
Der Mann war mehr als sonderbar. Schon früher hatte ihm die Erscheinung des Staken ein Gefühl der Mulmigkeit eingebracht. Er schien in sich gekehrt, war unfreundlich und verschlossen. Auf den Bällen erschien er zwar seit einiger Zeit, doch er unterhielt sich niemals mit jemandem. Es wirkte, als würde er nur kommen, um jemanden zu beobachten.
Sein Hang zum Kränkeln war besorgniserregend, denn Hyacinthe wollte sich mit nichts anstecken. Doch das war unvermeidbar, wenn sie auf so engem – und dreckigem – Raum zusammenlebten.
Nein, so wie es jetzt war, konnte es nicht bleiben!
Übelkeit stieg in ihm auf, als er die Morgue betrat. Um den Geruch davon abzuhalten, ihm in die Nase zu dringen, hielt er sich ein Taschentuch vor.
Der gepflasterte Boden unter seinen Füßen war nass – eine Mischung aus geschmolzenem Schnee, Seifenlauge und Verwesungswasser, das nun an seinen Schuhsohlen klebte. Sein Magen drehte sich unaufhörlich.
Die Leute nahmen keine Notiz von ihnen. Man konnte hier ein und aus gehen, wie einem beliebte. Es gab keine Türen, keine Fenster, alles war offen, um den Gestank in die Stadt zu entlassen und ihn nicht zwischen den Wänden festzuhalten.
Perkovic trieb sich oft hier unten rum, um sich nützlich zu machen und ein paar Münzen zu verdienen – und nebenbei die Leichname zu bestehlen.
Gavrila hingegen hatte die städtische Morgue zuletzt besucht, als Dimitrij hier gelegen hatte. Hier unten, wo er nicht hingehörte. Er war ein feiner Mann gewesen und hätte in einem feinen Leichenschauhaus – in einem für die Reichen – aufgebahrt werden müssen, doch...
»Das ist er. Von dem hab ich die Kette«, riss Perkovic ihn aus seinen düsteren Gedanken, die ihn kaum atmen ließen, und deutete auf eine aufgedunsene Leiche mit bläulich verfärbter Haut und grauenvoll aufgerissenen Augen.
Gavrila näherte sich dem leblosen Körper und warf einen Blick in das Gesicht des Ertrunkenen. »Ich kenne ihn nicht«, brachte er kaum hörbar hervor und bemühte sich darum, das Beben seiner Finger zu unterdrücken. Er wollte sich abwenden, aber er konnte nicht. Stattdessen starrte er den Fremden an, als stünden in dessen undefinierten Zügen die Antworten auf seine Fragen. Dieser glanzlose Blick schien ihn zu durchbohren, wie ihn damals jener Dimitrijs durchstochen hatte, um ihn vorwurfsvoll zu fragen, wo er in jener Nacht gewesen war. Wo er gewesen war, anstatt seinem Bruder das Leben zu retten und an seiner Stelle in der Morgue zu liegen. Mit leicht geöffneten Lippen, über die niemals wieder ein Wort, ein Atemzug kommen würde.
Es hätte ihn treffen sollen statt Dimitrij.
Unvermittelt legte ihm jemand die Hand an die Schulter. Beinah hätte sich seiner Kehle ein Schrei entrungen, doch die hochkommende Magensäure ertränkte diesen und ließ ihn schmerzhaft schlucken.
»Was treibt ihr beiden denn hier?« Es war der alte Haggard, der plötzlich neben ihm stand. Haggard war ein Kerl wie Perkovic – ohne Zuhause, ohne Familie, ohne richtige Arbeit. Er kam her, um den Morgisten zu helfen, die Toten zu waschen. »Bist du wegen Dimitrij gekommen?«
Gavrila brachte kein Wort hervor und schüttelte bloß die kräftige Hand ab, die er nicht fühlen wollte. Wie war es dazu gekommen, dass er nur noch von gescheiterten Existenzen umgeben war? Er wusste die Antwort. Es war Dimitrijs Tod gewesen, der sein Leben in diese schmutzige Sackgasse geführt hatte.
Nachdem er seinen Bruder auf diesem Tisch hatte liegen sehen, war er in eine Art Schockzustand gefallen. Tagelang hatte er auf den Treppen vor der Morgue geschlafen, neben den breiten Säulen. Er hatte nichts gegessen und nichts getrunken.
Perkovic und Haggard hatten sich schließlich seiner angenommen und sich um ihn gekümmert, bis er wieder ansprechbar war. Seither standen sie ihm bei seinem Vorhaben, den Mord an Dimitrij aufzuklären, zur Seite. Sie taten es nicht uneigennützig, doch man musste wohl offen gestehen, dass diese Männer seine Freunde waren. Obgleich er sich zumeist wünschte, sie würden ihn einfach in Ruhe lassen.
»Wir haben da was gefunden.« Perkovic wedelte mit der Kette vor Haggards breiter Nase herum.
Der bullige Mann folgte dem Anhänger mit dem Blick, als wolle er sich davon hypnotisieren lassen. »Diese verdammte Kette. Wir sollten fragen, ob die schon wissen, wer der Kerl ist.«
»Der werte Inspektor wird nicht begeistert sein, wenn er hört, dass Gavrii sich wieder hier herumtreibt, um Nachforschungen anzustellen.«
»Mir ist scheißegal, was Hathaway davon hält«, gab Gavrila bissig zurück und hielt nach einem der Morgisten Ausschau. Nach jenem, den er bereits des Öfteren bestochen hatte und der es ihm leicht machen würde, das ein weiteres Mal zu tun.
Der große, junge Mann mit dem strohblonden Haar und dem Namen Andrew Petticoa schenkte ihm seine Aufmerksamkeit und kam gehorsam näher, als er ihn zu sich nickte. »Ja, Sir? Darf ich Ihnen erneut behilflich sein?«
»Wisst Ihr, wer dieser Tote ist?«, forderte Gavrila, ohne Umschweife und ohne das Tuch von Nase und Mund zu nehmen, zu wissen.
»Es tut mir leid, Mister Ardenovic, aber wir kennen ihn nicht. Bis jetzt ist niemand gekommen, um ihn anzusehen.«
Gavrila zog ein paar Scheine aus der Brusttasche seines Gehrocks und reichte sie dem Mann. »Sobald sich jemand meldet, will ich wissen, wie dieser Bastard heißt. Kein Wort zu Hathaway.«
Damit stürmte er aus dem Leichenschauhaus und sog die frische Luft tief in seine Lungen, um die eine eiserne Hand zu liegen schien.
Die Fenster waren frisch geputzt und ließen endlich das düstere Tageslicht ein, in dem er die Bücher sortierte und sie fein säuberlich in die Regale stellte.
Zwei Meter Wand waren bereits voll und doch lagen noch immer so viele Werke auf dem Boden verstreut. Zumindest die Sitzgelegenheiten hatte er freibekommen und mit Essigwasser gewaschen, um den Staub und den Antiquitätengeruch zu verscheuchen. Er war ein klein wenig stolz auf sich, denn es sah schon beinahe wohnlich aus. Die Zeitungen hatte er alle vor den Ofen geschoben, um dem Feuer stetig Nachschub geben zu können. Es würde sich eine Weile mit altem Papier zufriedengeben müssen.
Als sich ein Schlüssel im Schloss drehte, wandte er sich zu Ardenovic um, der zögerlich hereinkam und ein Gesicht machte, als stünde er vor den Trümmern seines Hauses. Dabei sah es jetzt besser aus als zuvor. Allerdings verriet ihm die Miene seines Ehemannes, dass Hyacinthe nicht mit einem Lob oder großer Dankbarkeit zu rechnen hatte.
»Was hast du getan, törichtes Ding?!«, forderte Ardenovic zwischen zusammengepressten Zähnen zu wissen, während er sich mit Entsetzen umsah. Eilig ging er zum Ofen hinüber und keuchte, als er die darin brennenden Zeitungen bemerkte. Schneller, als Hyacinthe seine Stimme wiederfand, hatte Ardenovic den Gürtel aus den Ösen gezogen und die Distanz zwischen ihnen überwunden. Grob packte er ihn am Kragen und riss ihn auf die Beine, um ihn zu schütteln. »Was hast du getan, verdammter Bastard?!«
»Deinen Saustall aufgeräumt«, biss Hyacinthe zurück und wollte sich aus dem festen Griff befreien, was ihm nicht gelang. Zu seinem Leidwesen und seiner Beunruhigung war Ardenovic viel stärker als sein abgemagerter Körper vermuten ließ. Gleich würde er zum ersten Mal den Zorn seines Gemahls zu spüren bekommen und wusste nicht einmal, womit er sich diesen verdient hatte.
Sein Gegenüber, das nur ein klein wenig größer war als er, drückte so fest zu, dass es schmerzte. »Ist dir klar, was du angerichtet hast?!«
Tränen der Wut stiegen ihm in die Augen, doch er hielt sie zurück. »Ich habe nur aufgeräumt, zum Teufel!« Plötzlich begriff er, was Ardenovic so wütend machte. Sein Blick fiel auf die Kiste hinter dem Mann, doch er sagte nichts, weil man ihn gar nicht danach fragte, sondern ihn sofort des Verbrechens bezichtigte. »Jetzt schlag endlich zu!«, forderte er stattdessen spuckend, stieß dem anderen gegen die Brust und nickte in Richtung des Gürtels. »Nur keine falsche Schüchternheit! Ich bin doch jetzt dein Eigentum! Los, tu es, ich bin nicht zimperlich! Denkst du, du bist der Erste, der mich schlägt?!« Er widerstand dem Drang, sein zu Hemd öffnen, um Ardenovic die hässlichen Andenken zu zeigen, die sein Vater und so mancher Freier auf seiner Haut hinterlassen hatten. »Bist du nicht, also bloß keine Skrupel, verdammter Schlappschwanz!«
Ardenovic stieß ihn bäuchlings auf das freigeräumte Sofa, um ihm das Leder über den Hintern zu ziehen. Es brannte wie die Hölle, doch Hyacinthe gab keinen Laut von sich. Er hatte gelernt, die Zähne zusammenzubeißen und seinen Schmerz nicht zu zeigen. Auch die Schläge, die dem ersten folgten, ließ er ohne einen Mucks über sich ergehen.
»Du weißt gar nicht, was du angerichtet hast!«, donnerte Ardenovic und knallte den Gürtel mit Gewalt gegen die Wand, um sich mit dem Rücken gegen diese sinken zu lassen. Er glitt daran hinab und hockte auf dem Boden.
Hyacinthe fühlte erst in diesem Moment seinen rasenden Herzschlag und wie er sich langsam beruhigte. Nach einem kurzen Zögern erhob er sich und schob Ardenovic mit dem Fuß die Kiste entgegen, die er ausgeräumt hatte, um sie mit etwas anderem zu füllen. Dann ging er ins Schlafzimmer, um sich aufs Bett zu setzen und an die Wand zu starren.
Schwer atmend sah er dem Jungen nach, der aus dem Raum eilte, um die Tür lautstark hinter sich in den Rahmen zu werfen.
Mit einem verzweifelten Knurren raufte er sich das Haar, bis es wehtat. Dann griff er nach der Kiste und warf einen Blick hinein. Etwas in seiner Brust verkrampfte sich schmerzhaft, als er die vielen Zeitungsartikel entdeckte, die der Bursche sorgsam herausgesucht und ausgeschnitten hatte. Er hatte sich die Mühe gemacht, all diese Tagesblätter zu durchsuchen und die markierten Zeilen aufzubewahren.
Es waren die Artikel, die von Dimitrijs Tod berichteten und die er nicht wegwerfen konnte, weil er in seinem Irrsinn glaubte, er würde in den Berichten der Journalisten Hinweise finden. Informationen, die er übersehen hatte.
Dabei war ihm längst klar, dass er nichts finden würde. Nicht in diesen verlogenen, lückenhaften Bruchstücken. Dennoch konnte er sich nicht davon trennen, weil dort in schwarzen Lettern der Name seines toten Bruders stand.
Wie panisch er geworden war, als er die Berichte verloren geglaubt hatte, war nicht in Worte zu fassen. Doch sie waren nicht verloren, sondern bloß ordentlich und fein säuberlich in einer Kiste verstaut.
Ihm wurde bewusst, dass er seinen Angetrauten nicht nur viel zu hart, sondern völlig umsonst bestraft hatte. Dieser hatte nur etwas erledigt, wozu er nicht fähig gewesen war. Hyacinthe hatte lediglich Ordnung in dieses Chaos gebracht und er hatte nichts besseres zu tun, als ihn dafür zu schlagen. Gott, er war ein schrecklicher Mensch... So nahe am Abgrund, seine Seele so fest in den Fängen des dreckig grinsenden Teufels. Er war ein kaltherziges Monster, das nur Hass zu geben hatte und nur Hass verdiente. Auch in den Augen des Jungen hatte er diesen gesehen. Es wunderte ihn nicht.
Mit einem trockenen Schlucken und einem tiefen Atemzug vertrieb er all die Gefühle, die in ihm hochkommen wollten, doch die er nicht haben wollte. Stattdessen schloss er sie fort, wie er sich vor einer Ewigkeit angewohnt hatte, es zu tun.
Mühsam erhob er sich und setzte fort, was Hyacinthe angefangen hatte, indem er die verstreuten Bücher in die Regale räumte, die restlichen Zeitungen verbrannte und eine Suppe aus dem wenigen vorrätigen Gemüse aufsetzte.
In seinem Kopf kreisten die Gedanken um den Toten in der Morgue und um die geheimnisvolle Kette, deren Anhänger ihm so vertraut und doch so fremd war.
An Dimitrijs Körper hatte man Kampfspuren und unter seinen Fingernägeln Blut und Haut gefunden. In seiner Rechten hatte die Kette geruht. Er musste sie seinem Mörder vom Hals gerissen haben.
Seine Fantasie gaukelte ihm die hässlichsten Bilder vor, wie sie es immer tat. Die Vorstellung davon, wie sein Bruder den letzten Atemzug getan hatte, ließ ihm keine Ruhe. »Keine Ruhe«, murmelte er und griff sich hustend an die heiße Stirn, hinter der die seltsamsten Dinge vor sich gingen, um ihn zu quälen und ihn langsam in den Wahnsinn zu treiben.
Wie viel Zeit vergangen war, wusste er nicht, doch irgendwann kam der Junge aus dem Schlafzimmer gestürzt und zeigte mit dem Finger auf ihn. »Ich will, dass hier aufgeräumt wird! Nur damit das klar ist! Und ich will Vorhänge, damit die Leute von der Straße mich nicht dauernd anstarren, wenn sie vorübergehen!«
Gavrila, der ja gerade dabei gewesen war aufzuräumen, wandte sich wütend um. »Wenn du glaubst, du hast hier irgendetwas zu sagen, hast du dich geirrt! Und du schreist mich nicht an! Hast du verstanden?«
»Du schlägst mich, so viel du willst, und ich schreie, so viel ich will!« Hyacinthe schüttelte sich die blonden Locken aus dem Gesicht, das noch schrecklich kindlich anmutete.
»Lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster«, knurrte Gavrila und bedachte sein zierliches Gegenüber mit einem warnenden Blick, der ignoriert wurde.
»Kauf Vorhänge, dann komme ich vielleicht nicht auf den Gedanken, mich aus den Fenstern zu lehnen! Ich will Vorhänge«, fügte er noch einmal – beinah verzweifelt – hinzu.
»Mich interessiert nicht, was du willst! Und jetzt geh mir aus den Augen, zum Teufel!« Diesem Befehl wurde Folge geleistet.
Als er allein war, wischte er sich aufstöhnend übers Gesicht und setzte sich auf den Stuhl, auf dem er seit Monaten nicht gesessen hatte, weil er zu vollgeräumt gewesen war. Benommen starrte er gegen die Fensterfront ohne Vorhänge. Ein Passant warf einen verstohlenen Blick herein und zog sich die Krempe seines Hutes tiefer ins Gesicht, als er bemerkte, dass Gavrila ihn ansah.
Es gab so viele Leute, die ihn hassten – ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte – und ihm vielleicht schaden wollten. Sollten sie falsche Schlüsse aus dieser Heirat ziehen und fälschlicherweise annehmen, Hyacinthe bedeute ihm etwas, würden sie unter Umständen auf den Gedanken kommen, sie könnten den Jungen benutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Seine Kehle wurde eng.
Vermutlich waren Vorhänge keine allzu schlechte Idee.
Kapitel 3
Jemand klopfte hart gegen die Tür und Hyacinthe schrak vom Bett hoch, auf dem er seit Stunden verweilte. Er war nicht einmal aufgestanden, als Ardenovic etwas später das Haus verlassen hatte, um kurz darauf zurückzukehren.
Inzwischen war es dunkel draußen.
»Kommst du essen?«, ertönte die dunkle Stimme seines verfluchten Ehemannes und obwohl er keine Lust auf dessen Gesellschaft hatte, so hatte er doch unbändigen Hunger. Dieser lockte ihn aus dem düsteren Raum.
Überrascht hielt er inne, als er die blickdichten Vorhänge bemerkte, welche die Gläserfront vor ihm verbarg und ihn wiederum vor den neugierigen Gaffern dort draußen.
Ein kleines Lächeln ergriff von seinen Lippen Besitz, doch er verscheuchte es, als Ardenovic ihm seine Aufmerksamkeit schenkte, um in Richtung des Tisches zu nicken.
Hyacinthe setzte sich und ließ sich einen Teller mit heißer, herrlich duftender Suppe und zwei Scheiben Weißbrot reichen. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, doch er wartete mit dem Kosten, bis Gavrila sich in den Stuhl zu seiner Rechten gesetzt hatte.
»Ich habe die Speisekammer aufgefüllt«, meinte der Mann leise und stellte seine Suppe auf den Tisch, um mit dem Essen zu beginnen.
Hungrig tat Hyacinthe es ihm gleich und ließ sich jeden Tropfen dieser Mahlzeit auf der Zunge zergehen. Wann hatte er zuletzt etwas so Gutes gehabt?
Es war Jahre her, seit seine Mutter für ihn gekocht hatte. Dann war sie zu krank geworden, um den Haushalt zu führen und sich um ihren Sohn zu kümmern. Es war ihre Seele gewesen, die erkrankte, um ihr jegliches Interesse an ihrer Umwelt zu rauben. Nicht, dass sie davor allzu viel Interesse an ihm gezeigt hätte.
»Warum hast du mir nicht gesagt, dass du die Artikel nicht verbrannt hast?«, forderte Ardenovic unvermittelt zu wissen und Hyacinthe war ihm trotz des feindseligen Tonfalls dankbar, dass er die Gedanken an seine Mutter verscheuchte.
»Du hast mich nicht danach gefragt.«
»Die Schläge wären dir erspart geblieben, wenn du den Mund aufgemacht hättest«, knurrte der andere und er fragte sich, was für einen Grund der Mann hatte, deswegen wütend zu sein. Immerhin war es nicht dessen Hintern, der jetzt schmerzte. Warum beschwerte er sich überhaupt?
Zur Antwort zuckte er nur mit den Schultern und legte den Löffel beiseite, als er aufgegessen hatte.
»Hol dir Nachschlag, wenn du magst.« Es war verwunderlich, wie schnell dieser grimmige Unterton verschwinden konnte.
Hyacinthe erhob sich, um sich den Teller erneut zu füllen. Als er sich wieder setzte, bemerkte Ardenovic das Holzrohr in seinem Rock.
»Du schnüffelst eindeutig zu viel in meinen Sachen herum«, meinte er und zog ihm das Ding aus der Tasche, um ihm damit eins überzuziehen. Allerdings nicht mit annähernd so viel Kraft und Gewalt, wie sein Vater stets angewandt hatte.
Hyacinthe rieb sich trotzdem mit zwei Fingern über die Stelle und murmelte ein Au, ehe er seine Neugier zu stillen versuchte: »Was ist das?«
»Ein Stethoskop«, erwiderte der Mann, der das Rohr in seine Rocktasche schob und sich seinem Essen widmete. Er war immer noch beim ersten Teller. Offenbar hatte er keinen Appetit.
»Wozu ist das gut?«
»Zur Auskultation«, erklärte man ihm wenig hilfreich.
»Was ist das?«
»Auskultieren. Von auscultare, was so viel bedeutet wie abhorchen. Damit kann man feststellen, ob im Körper alles in Ordnung ist und wenn nicht, was nicht in Ordnung ist. Man kann zum Beispiel die Lungen oder das Herz abhören.«
»Kultierst du mich nach dem Essen aus?«, fragte er hoffnungsvoll, weil er sehen wollte, wie das Stethoding funktionierte.
»Auskultierst du mich. Das Wort wird nicht getrennt.«
Über so viel Pingeligkeit konnte er nur die Augen verdrehen. »Meinetwegen. Tust du es?«
»Nein.« Zur Bekräftigung schüttelte Ardenovic das Haupt und strich sich die Haare hinters Ohr, wo er sie meist zu beiden Seiten hatte. Er tauchte den Löffel noch einmal in die Suppe, ohne ihn danach zum Mund zu führen. Stattdessen ließ er ihn gegen das Porzellan sinken und lehnte sich zurück.
»Warum nicht?«
Ardenovic hustete hinter vorgehaltener Hand und – überraschenderweise – höflich von ihm abgewandt. »Weil du nicht krank bist.«
Im Gegenzug schien es allerdings er zu sein. »Darf ich dich auskultieren?«
»Ganz gewiss nicht, Junge.«
»Du bist also Arzt?«
»Ich war Militärarzt«, kam knapp zurück und es wurde offensichtlich, wie ungern Ardenovic darüber sprechen wollte.
»Du warst Militärarzt?«, fragte er dennoch.
»Wir leben von meinen Ersparnissen und meiner Veteranenpension. Es wird dir an nichts fehlen, wenn es das ist, was dir Sorgen bereitet.«
Hyacinthe hatte keinen Gedanken an Geld verschwendet. Er war bloß neugierig, doch er schwieg, anstatt den anderen zu korrigieren.
Sein Blick fiel erneut auf die Vorhänge und er fragte sich, ob er sich bedanken sollte, doch ließ es bleiben. Verstohlen betrachtete er die harten Gesichtszüge Ardenovics. Seine Wangen wirkten eingefallen, viel zu knochig. Dunkle Schatten lagen um seine ebenso dunklen Augen, ließen ihn düster aussehen. Ganz offen gestanden war der Mann ausgesprochen hässlich. Sein Aussehen war geradezu grotesk. Man mochte ihn nicht gerne ansehen und auch Hyacinthe wandte sich mit einem Schaudern von ihm ab. Er fragte sich, ob es nicht nur Ardenovics Äußeres, sondern auch dessen Verhalten war, welches ihn so widerlich wirken ließ.
Seine Gedanken waren böse, das war ihm klar, doch es geschah nicht mit Absicht. Es war nicht sein Bestreben, abwertend zu sein, denn er verdankte Ardenovic sein Leben. Hätte dieser sich nicht eingemischt, läge Hyacinthe jetzt wahrscheinlich in einer Kiste ein paar Meter unter der kalten, gefrorenen Erde.
Schweigend aß er den Rest seiner Suppe. Wo hatte Ardenovic nur so herrlich zu kochen gelernt? Und würde er nun jeden Abend eine Mahlzeit für ihn zubereiten? Das schien ihm purer Luxus und eine Wohltat für seinen Magen, der für gewöhnlich leer zu bleiben pflegte, um ihn nächtelang wachzuhalten, selbst wenn er sich nicht in den Gossen der Stadt herumgetrieben, sondern auf dem harten Boden seiner winzigen Kammer gelegen hatte.
Irgendwann brach Gavrila das Schweigen: »Ich erwarte noch Gäste und möchte, dass du dich während ihres Besuchs im Hintergrund hältst.«
»Etwa wichtige Leute, die ich mit meiner Tölpelhaftigkeit zum Naserümpfen brächte, wenn ich den Mund aufmachte?«
»Sehr weit von der Wahrheit entfernt«, gab Ardenovic in seltsamem Tonfall zurück und musterte ihn aus seinen schlammfarbenen Augen, die etwas Scharfes, Gefährliches an sich hatten. »Tu es einfach, anstatt meine Befehle zu hinterfragen.«
»Bist du sicher, dass du Militärarzt warst und nicht der Feldwebel?« Er sprach so leise, dass man meinen müsste, der andere könne ihn nicht hören.
Zu seiner Überraschung hatte Ardenovic ihn jedoch vernommen. »Ja, ich bin mir sicher und würde es bevorzugen, wenn du deine freche Zunge in Schach halten könntest.«
Hyacinthe musste aus unerfindlichen Gründen ein Lächeln unterdrücken, während er halbherzig salutierte. »Zu Befehl, Sir.«
Sein Gegenüber schüttelte kaum merklich den Kopf, sagte aber nichts.
Wenig später saßen sie um den Esstisch herum und gaben für neugierige Passanten, die dank der neuen Vorhänge ohnehin kaum mehr hereinsehen konnten, vor, Karten zu spielen.
Sie hockten jede Woche beisammen. Nicht, weil sie Freunde waren, sondern weil sie dieselben Geheimnisse teilten. Und dasselbe Ziel vor Augen hatten.
Perkovic und Haggard bedienten sich an der Suppe und schenkten ihren Blättern wenig Aufmerksamkeit. Pierce Fletcher, ein dicker, nervöser Mann, ließ den Blick kaum von Hyacinthe, der in der Ecke auf dem Sofa saß und tat, als würde er in einem Buch lesen. Gavrila fragte sich, ob der Bursche überhaupt lesen konnte oder sie bloß belauschen wollte. Anstatt den Witwer zu ermahnen, schwieg er still. Der Kerl trauerte seiner Frau nach und Gavrila wusste, dass von Fletcher keine Gefahr für den Jungen ausging – in keinster Weise.
Dann war da noch der alte Bartholomew Urly, der sich ebenfalls sehr für Hyacinthe interessierte. »Wie heißt der Bursche gleich nochmal?«, fragte er zum gewiss fünfzigsten Mal nach, seit er eingetreten war – was keine zehn Minuten her war.
»Hyacinthe, Sir«, gab eben dieser amüsiert zurück, ehe Gavrila antworten konnte. »Ha-ya-sint. Es ist ja eigentlich ganz einfach.«
Bartholomew lachte und mischte seine Hand. Es war eine schreckliche Angewohnheit, die der Mann fürchterlich laut und schrecklich leidenschaftlich pflegte.
»Bartie, ist gut jetzt, ja?«, ermahnte Fletcher und schob an seiner Brille herum, ehe er sich aufgebracht umsah, als wären düstere Schatten in seinem Blickfeld, die er verscheuchen konnte, indem er sich ihnen widmete.
»Kommen wir zur Sache«, meinte Perkovic mit vollem Mund und schluckte hinunter, ehe er die Kette aus der Tasche zog und sie in der Mitte des Tisches platzierte.
Fletcher keuchte verängstigt auf und rückte seinen Stuhl einen halben Meter nach hinten. »Diese verdammten Bastarde! Sind sie hinter uns her?«
»Niemand ist hinter uns her und jetzt beruhigt Euch!«, knurrte Gavrila, dem die viele Gesellschaft – und die Art dieser Gesellschaft – bereits zu viel wurde.
Hyacinthe ließ das Buch in den Schoß sinken und sah neugierig herüber.
»Wo habt ihr sie her?«, wollte Bartholomew wissen und nahm das golden glänzende Schmuckstück an sich, um es genauer zu betrachten.
»Ein Toter in der Morgue hatte sie in den Fingern, die er darum verkrampft hielt, als würde ihm das Stück mächtig viel bedeuten«, klärte Perkovic die Runde auf und griff unbekümmert nach einer weiteren Scheibe Brot. Das Essen war der einzige Grund, weshalb er an diesen Treffen teilnahm.
Fletcher wimmerte zwischen zusammengepressten Lippen und wollte sich über die nass gewordenen Augen wischen, wobei er gegen die Brille stieß. Er nahm sie ab und gab vor, sie zu putzen, um den Kopf senken zu können. Der Verlust seiner Gattin hatte ihn zu einem angsterfüllten, nervösen Wesen gemacht und würde ihn auf ewig davon abhalten, wieder ein normales Leben zu führen.
»Wir müssen die Augen offen halten«, meinte Haggard, nachdem für eine Weile keiner etwas gesagt hatte. Er rieb sich die breite Nase.
»Wonach die Augen offen halten?«, fragte Hyacinthe, der unvermittelt hinter Gavrila stand und sich mit den Händen an dessen Stuhllehne festhielt. Der Junge musterte die Kette in Bartholomews Fingern.
»Das geht dich nichts an. Vielleicht ziehst du dich besser ins Schlafzimmer zurück«, erwiderte Gavrila hart und nickte in Richtung Tür.
»Warum darf er nicht wissen, worum es geht?« Haggard legte die Stirn in Falten. »Vielleicht kann er uns helfen.«
Gavrila hasste es, wenn man seine Autorität in Frage stellte, und ballte die Hände zu Fäusten. »Ich will nicht, dass er da reingezogen wird!«
»Der Junge ist doch kein Kind mehr«, lachte Bartholomew und strich sich durch den schlohweißen Bart, ehe er Hyacinthe bereitwillig das Beweisstück reichte.
»Richtig, Sir. Das bin ich nicht«, pflichtete der Bursche ihm bei, mit einem triumphierenden Seitenblick auf Gavrila, der sich heftig darüber ärgerte.
Fletcher mischte sich mit zittriger Stimme ein: »Gavrila hat recht. Der junge Mann sollte nicht anwesend sein. Was, wenn er ein Spitzel ist?«
Mit dieser Anschuldigung wurde es schrecklich still in dem Raum, der dank des Jungen beinah gemütlich wirkte. Gavrila knirschte mit den Zähnen und starrte feindselig in die trüben Augen des Dicken, der nervös schluckte.
»Pass auf, was du sagst, Fletcher«, warnte er ihn leise.
Diese Idioten drängten ihn in eine Ecke. Er hatte Hyacinthe erneut ins Schlafzimmer schicken wollen – noch dringlicher, als Bartholomew sich eingemischt und auf dessen Seite gestellt hatte. Gavrila wollte zeigen, wer dem Jungen die Befehle erteilte. Doch Fletchers dumme Aussage zwang ihn dazu, seinen Gemahl hierzubehalten, um das übergewichtige Nervenbündel in die Schranken zu weisen.
»Setz dich«, knurrte er dem Burschen zu, der gehorsam an seiner Seite Platz nahm und einen Ausdruck von tiefster Befriedigung zur Schau trug. Das kleine Lächeln, das dabei seine vollen Lippen umspielte, brachte Gavrila durcheinander. Mit einem Räuspern klärte er seine Kehle. »Haggard hat recht. Wir müssen Acht geben. Offenbar sind diese Bastarde erneut aus der Versenkung aufgetaucht, um Teufels Werk in den Straßen zu verrichten.«
»Diese dreckigen Hurensöhne«, brachte Bartholomew ungewohnt unfein hervor und schloss die Finger so fest um sein Glas, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Wer weiß, ob sie es nicht mit Absicht tun.«
Fletcher zuckte zusammen und sah über die Schulter. »Was mit Absicht tun?«
»Unsere Aufmerksamkeit erregen«, klärte Bartie ihn auf und stierte auf die Karten, mit denen sie nicht spielen würden. Zumindest nicht, solange nicht Hathaway oder einer seiner Speichellecker hier auftauchte. Dann würden sie nach den Blättern greifen und eine perfekte Ausrede für ihr Zusammenkommen parat haben. Eine, die der Inspektor ihnen nicht abkaufen, doch die ihm jegliche Handlungsgrundlage entziehen würde.
»Warum sollten sie das tun? Die wissen doch, dass wir ihnen nichts anhaben können«, mischte Perkovic sich kauend ein.
»Ich werde die Mörder meines Bruders zur Rechenschaft ziehen.« Gavrila ließ seinen Blick schmal werden und fixierte den Säufer mit den zerzausten Locken, die ihm bis zur Brust reichten.
»Ich weiß, dass du das nicht hören willst, Gavrii.«
»Wenn du das so genau weißt, hältst du vielleicht einfach dein Schandmaul.«
»Wieso sollten sie unser Augenmerk auf sich lenken wollen, Bartie? So sag doch«, forderte Fletcher und strich sich durchs lichte Haar.
»Ich weiß es nicht, Pierce«, schüttelte Bartholomew sachte das Haupt und es wurde wieder still, weil jeder seinen eigenen Gedanken nachhing.
»Wer sind denn die?«, fragte Hyacinthe plötzlich in das Schweigen und kam ihm vor, wie ein neugieriges Kind – was von der Wahrheit nicht weit entfernt war. Der Junge war kaum achtzehn und interessiert war er definitiv.
»Ein Geheimbund«, gab Bartie leise zurück. »Wir alle haben etwas Wertvolles an diese Mörder verloren und sinnen auf Rache.«
»Mir haben sie nichts genommen, aber ich bin stets bereit, meinen Freunden beizustehen«, grinste Perkovic und setzte die Whiskeyflasche an, während er mit der anderen Hand an seinem schmalen, roten Schal nestelte, sich daran festkrallte.
Gavrila hielt sich die Hand vor, um zu husten. Sein Hals schmerzte, sein Mund war irrsinnig trocken und der Kopf tat ihm weh. Der Tag war lang gewesen und er sehnte sich nach etwas Einsamkeit.
Mit einem Mal fragte er sich, weshalb er so an dieser Kartenrunde festhielt. Sie waren damals nicht vorangekommen und würden ewig auf der Stelle treten.
Sein Ehemann war mit der knappen Erklärung nicht zufrieden. »Ein Geheimbund welcher Art? Und was bedeutet diese Kette?«
Alle hüllten sich in Schweigen, welches so unerträglich wurde, dass Gavrila sich schließlich dazu genötigt fühlte, zu antworten: »Wir wissen es nicht.«
Müde lag er auf dem Bauch in ihrem schmalen Ehebett und dachte nach, während Gavrila sich behutsam in ihn schob.
Der Mann hatte kurz zuvor die Hand nach ihm ausgestreckt und rau gefragt, ob es ihm recht sei. Hyacinthe hatte mit einer leisen Bejahung geantwortet.
Diesmal tat es nicht so weh und seine Scham ließ ihm seinen Frieden. Immerhin war er mit anderen Dingen beschäftigt. Mit wichtigeren Dingen als seinem Ehrgefühl und der Tatsache, dass sein Ehemann es auf diese Weise verletzte.
Er unterdrückte einen Laut, der sich seiner Kehle aufgrund des unangenehmen Gefühls entringen wollte. Stattdessen stellte er eine Frage, die ihm auf der Zunge brannte, seit Ardenovics Freunde gegangen waren: »Wie kann es sein, dass ihr euch so oft getroffen und doch nichts herausgefunden habt?«
»Es handelt sich um einen Geheimbund, Junge. Informationen sind nicht einfach zu bekommen«, gab der ausgekühlte Mann, der auf ihm lag, keuchend zurück.
»Du sammelst die Artikel, was mich wissen lässt, dass du fieberhaft bei der Sache bist. Wie kommt es, dass du nichts in Erfahrung bringen konntest? Ihr alle nicht?« Schwach schüttelte er den Kopf und biss die Zähne aufeinander, als sich eine harte Länge langsam zurückzog, um gleich darauf wieder in ihn zu gleiten.
»Es ist eben schwierig«, erwiderte Gavrila atemlos und schien ungeduldig mit ihm. »Vielleicht können wir diese Unterhaltung auf einen gelegeneren Zeitpunkt verschieben? Es wäre mir genehm, wenn du kurz den Mund halten und dieser Sache hier mehr Konzentration schenken würdest.«
Gegen seinen Willen musste Hyacinthe grinsen. »Was sollte hierbei meine Konzentration erfordern? Du bist derjenige, der sich in Behutsamkeit und Zurückhaltung üben muss. Obwohl ich nichts dagegen habe, wenn du wieder so schnell bist wie gestern.«
»Hyacinthe«, stieß sein Ehemann hervor und benutzte nun also zum ersten Mal seinen Vornamen, dessen Silben er auf eine seltsame Weise betonte.
Es klang nicht so übel, wie er erwartet hatte, dass sich sein Name aus diesem Mund anhören würde.
»Was denn?«, forschte er nach, weil er nicht begriff, was den anderen so entsetzt nach Luft schnappen ließ. Er drehte den Kopf, um in dieses groteske Gesicht sehen zu können. Gavrilas Wangen waren zu seiner Verwirrung gerötet. Es mutete bei seiner Blässe merkwürdig an. Der Mann streckte die Finger nach seiner Wange aus, um ihn – nicht unsanft – wieder in den Polster zu drücken und auf diese Weise davon abzuhalten, ihn zu mustern. Was war es denn nun?
Er verstand nicht, doch hielt gehorsam den Mund, bis Gavrila sich heiß in ihm verströmte, um ihn freizugeben und ihm den Rücken zu kehren.
Hyacinthe wandte sich ihm zu und bemerkte, wie sich seine Schultern in einem zittrigen Atemzug hoben und erneut senkten. »Deine Finger sind immer so kalt. Vielleicht kannst du sie das nächste Mal vorwärmen?«
»Ich will es mir merken«, kam mit heiserer, beinah sanfter Stimme zurück.
»Darf ich dir dabei helfen, den Mord an deinem Bruder aufzuklären?«
»Ich glaube kaum, dass du dazu imstande bist«, wurde erwidert und obgleich die Worte verletzend waren, verriet der Tonfall, dass sie nicht auf boshafte Weise gemeint waren.
»Ich möchte es versuchen«, beharrte Hyacinthe darauf, weil es ihm wichtig war. Er hatte die Zeitungsberichte gelesen und Mitgefühl empfunden. Gavrilas Eifer nach zu urteilen, hatte ihm sein Bruder viel bedeutet.
»Wie ich schon sagte, möchte ich nicht, dass du in diese Sache hineingezogen wirst. Du hältst dich raus.« Ardenovic dehnte diesen Satz und sprach langsam.
Hyacinthe wollte die Ablehnung nicht akzeptieren. Er stützte den Ellenbogen in das Kissen. »Warum nicht? Ich bin nicht so dumm, wie ich vielleicht wirke. Ich...«
»Schluss mit diesem Unsinn! Leg dich schlafen.«
»Nein, wirklich!«, begehrte er auf und wollte dem anderen klar machen, dass er durchaus einige Qualitäten an sich hatte. »Ich kann ein wenig lesen und schreiben. Ich habe gelernt, was ich allein lernen konnte. Ich strebte an, eines Tages auf die Akademie zu gehen, so war ich fleißig. Auch im Rechnen bin ich gut, was uns vermutlich nicht weiterhilft, aber ich bin durchaus in der Lage, meine Ohren zu spitzen und vielleicht bin ich gar zum Bespitzeln zu gebrau...«
»Genug jetzt! Du wirst nichts von alledem tun!« Das laute Gebrüll ließ ihn innehalten und brachte ihn schließlich dazu, sich wieder hinzulegen.
Betrübt drehte er sich zur Wand, um sie anzustarren. Er wollte helfen, wollte eine Aufgabe und einen Sinn haben. Er hatte die Hoffnung gehegt, von Nutzen zu sein. Zumindest einmal in seinem Leben. So viele Träume und kein einziger davon würde sich erfüllen. Das mochte bitter klingen, doch er war sich gewiss, dass es der Wahrheit entsprach.
Das halbe Frühstück lang schwieg der Junge ihn nun schon an und widmete sich ganz dem Essen, welches Gavrila aufgetischt hatte.
Schließlich räusperte er sich und erregte so die Aufmerksamkeit des sturen Blondschopfs. »Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast.«
»Worüber genau?«, kam fragend und etwas unsicher zurück. Schlanke Finger schlossen sich um die Tasse mit heißer Milch.
»Du sagtest, du wollest etwas lernen. Ich kenne da jemanden, der dich ein wenig unterrichten könnte.« Kaum hatte er zu Ende gesprochen, bemerkte er das intensive Leuchten in Hyacinthes smaragdgrünen Augen und verspürte ein seltsames, unerwartet aufkommendes Gefühl – beinah so etwas wie Freude darüber, dass seine Idee bei seinem Ehemann Anklang fand. »Seymour Wiplay ist ein leidlicher Greis, der sich gewiss gerne deiner annehmen würde. Er besitzt das kleine Antiquariat drei Häuser weiter. Wenn du möchtest, dann...«
»Ja! Bitte!«, nickte Hyacinthe eifrig und schien wahrhaft begeistert von der Aussicht, sich ein wenig Wissen aneignen zu können.
Gavrila war erleichtert, dass er den Jungen offenbar vom Geheimbund und dem Mord an Dimitrij abgelenkt hatte. Es war nicht gut für den Burschen, in diese Sache verwickelt zu werden, so wollte er das vermeiden, so gut es ging. »Ich kann dich ihm nach dem Frühstück vorstellen.«
Erneut kam ein Nicken zur Antwort, welches die blonden Locken seines Ehemannes in Bewegung versetzte. Ein sehr anziehender Anblick... und er senkte das Haupt, um ihn nicht mehr sehen zu müssen.
»Kann ich auch so ein Ding haben?«, fragte er, während sie nebeneinander die schmale Gosse entlanggingen. Hyacinthe gab sich dabei alle Mühe, den tiefen Pfützen auszuweichen, um seine löchrigen Schuhsohlen nicht mit dem Wasser zu überfordern.
Gavrila beantwortete seine Bitte mit einem verständnislosen Blick. Um ihn darüber aufzuklären, was genau er haben wollte, tippte er mit zwei Fingern gegen jene Stelle Gavrilas Jacketts, an der sich der Revolver befand. Er fühlte das Holz des Griffs und das Zurückzucken seines Ehemannes.
»Eine Waffe?«, hakte Gavrila heiser nach, obgleich es klar sein sollte. »Wenn du eine haben möchtest, werde ich dir eine kaufen.«
Hyacinthe grinste begeistert, sagte jedoch nichts, da Gavrila in diesem Moment gegen die gläserne Tür des Antiquariats klopfte und somit die Aufmerksamkeit eines alten Mannes erregte. Dieser hatte über ein Pult gebeugt in der Mitte des Raumes gestanden und wandte sich ihnen zu, um sie verwirrt zu mustern.
Schließlich breitete sich ein Lächeln auf seinen Lippen aus und er griff nach einem Stock, um sich auf diesen zu stützen, während er langsam näher kam.
Neugierig erhaschte Hyacinthe einen Blick auf den mit allerlei Absonderlichkeiten vollgestopften Laden und konnte es kaum erwarten, diese Dinge zu erkunden.
Endlich wurde ihnen geöffnet und man ließ sie ein. »Gavrii, welch eine Freude, dich zu sehen. Du hast dich seit Sonnabend nicht blicken lassen, Junge.«
Junge? Hyacinthe musste grinsen und gleich noch breiter, als Gavrilas Wangen sich röteten.
»Viel zu tun«, murmelte der Mann abwehrend und räusperte sich.
Der Greis wandte sich Hyacinthe zu und musterte ihn interessiert. »Und das muss dein frisch angetrauter Gemahl sein. Ich habe bereits davon gehört.«
»So? Reden sie schon?«, warf Gavrila wenig begeistert ein und knirschte hörbar mit den schief stehenden Zähnen, ehe er zwei Schritte zur Seite tat und vorgab, eine kleine Holzfigur genauer zu betrachten.
»Gewiss, mein Sohn«, nickte der grauhaarige Alte mit den tiefen Furchen im Gesicht, die allesamt Lach und Grübelfältchen markierten. Kein Zorn war in diesen Zügen zu erkennen, so als hätte der Mann noch nie in seinem Leben welchen empfunden. »Die Leute sprechen gern über dich, wie du weißt.«
»Wieso?«, forschte Hyacinthe verwirrt nach.
Während Wiplay zittrig abwinkte, gab Gavrila ihm eine verbitterte Antwort, ohne sich zu ihm umzudrehen: »Vielerlei Dinge. Hauptsächlich wegen meiner abstoßenden Gestalt, meiner Eigenbrötlerei und meiner Kaltherzigkeit.«
»Na na«, schüttelte Mister Wiplay sanft den Kopf und wollte noch etwas sagen, doch Gavrila fiel ihm ins Wort, um diese Diskussion zu unterbrechen.
»Nun, weswegen ich hier bin. Ich möchte, dass du Hyacinthe unter deine Fittiche nimmst und ihn unterrichtest. Mir scheint, er ist sehr wissbegierig.«
»Gewiss doch! Gib mir einen Tag mit ihm und wir finden heraus, woran wir arbeiten müssen«, stieß der Alte hervor und ließ das Ende seines Gehstocks mit der Erde aneinandergeraten. »Zum Lehren bin ich nie zu müde! Ich war einst Schulmeister in Levona, musst du wissen, Jungchen. Ich kann dir vieles beibringen und dir ein paar nette Geschichten erzählen.« Damit nahm er Hyacinthe am Arm und steuerte mit ihm die Treppe an.
»Keine alten Geschichten, die mich betreffen, Seymour!«, warnte Gavrila eindringlich und stellte eine düstere Miene zur Schau – noch grimmiger als seine gewöhnliche Grimasse.
»Vielleicht interessieren sie den Jungen«, lachte der Greis provokant.
»Keine alten Geschichten«, wiederholte Ardenovic und legte die Stirn in tiefe Falten. »Ich meine es ernst.« Dann wandte er sich Hyacinthe zu. »Ich erwarte dich spätestens um halb sechs zum Abendessen. Solltest du früher nach Hause kommen und ich nicht da sein, schließ die Tür ab und lass niemanden ein.«
»Dieses Misstrauen in alle Welt ist typisch für ihn«, amüsierte sich Wiplay über Gavrila, welcher entnervt die Augen verdrehte und tief Luft holte.
»Hyacinthe, hast du mich gehört?«, forderte sein Gatte ungeduldig zu wissen.
»Ja«, erwiderte er gedehnt. Er war doch nicht taub.
»Wirst du tun, was ich sage?«
»Jawohl, Sir«, grinste er und salutierte zum Spott, was Gavrila mit einem schwachen Heben seiner Augenbrauen quittierte. Anschließend verschwand er und Hyacinthe blickte ihm nach, bis er nicht mehr zu sehen war.
»Werdet Ihr mir trotz dieses Verbots die alten Geschichten erzählen?«
»Vielleicht, mein Junge. Doch erst werden wir deinen Wissensstand einer Probe unterziehen, damit wir erfahren, wo wir mit dem Lernen ansetzen sollen.«
Bäuchlings auf dem Boden liegend las er in einem großen, schweren Buch, das ihm die Geschichte des Landes näherbrachte.
Er tat sich schwer mit den klein geschriebenen Buchstaben, in verschlungener, enger Handschrift zu Papier gebracht, doch er gab sich die größte Mühe, die sich ein Schüler je gegeben hatte.
»... kam es d-d... aber, dass man den Kö-König zum Galgen führen musste«, beendete er den letzten Satz der Seite und wollte umblättern.
»Genug für heute«, lächelte Mister Wiplay und nickte ihm lobend zu. »Sehr gut gemacht. Du bist ausgesprochen gelehrig. Es ist eine Schande, dass man dich nicht in eine Schule gesteckt hat. Aber es ist niemals zu spät. Ich schlage vor, wir treffen uns jeden Morgen für zwei Stunden. Noch vor dem Frühstück, denn da ist der Geist am wachsten. Aber vergiss nicht, auch tagsüber, ohne mich, zu lesen und dich im Schreiben zu üben.«
»Einverstanden.« Hyacinthe behielt für sich, wie gerne er zur Universität gehen würde und wie wenig er daran glaubte, dass sein Traum sich erfüllen würde. Er klappte das Geschichtsbuch zu und rieb sich die müden Augen. »Nun, Sir? Denkt Ihr, habe ich mir für meinen Fleiß eine Geschichte über meinen Ehemann verdient?«
»Wenn du mir noch eine Tasse von diesem herrlichen Tee bringst, werde ich darüber nachdenken«, kam neckisch zurück und Hyacinthe war so schnell auf den Beinen, dass der Alte lachte.
Er eilte in die Küche hinüber, um Wasser aufzusetzen.