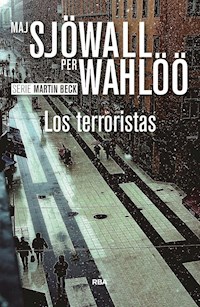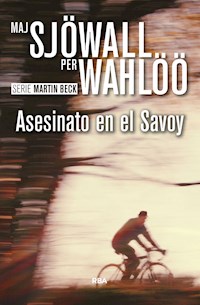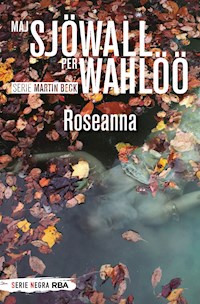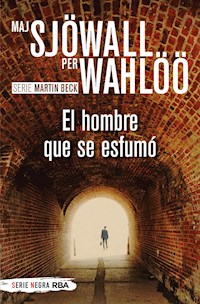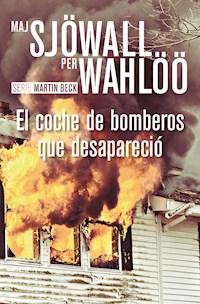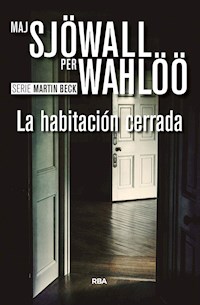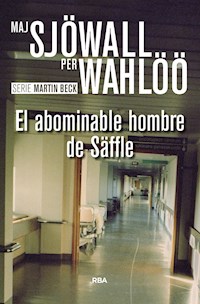9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martin Beck ermittelt
- Sprache: Deutsch
Band 9: Ein Sexualverbrecher. Ein Polizistenmörder. Ganz Schweden jagt das Böse Eine Frau ist verschwunden. Zum Kreis der Verdächtigen zählt auch Folke Bengtsson, ein entlassener Sexualstraftäter. Die Polizei gräbt sein Grundstück komplett um, doch zur Enttäuschung der versammelten Reporter wird die dort vermutete Leiche nicht gefunden. Hat der Mann sie woanders verscharrt? Doch während Martin Beck immer mehr Zweifel an Bengtssons Schuld kommen, jagt die Presse schon einer neuen Sensation hinterher: Nach einer Schießerei zwischen Streifenpolizisten und zwei jugendlichen Dieben kann einer der beiden entkommen. Und nun fahnden Presse und Polizei im ganzen Land nach dem Polizistenmörder. Dies ist der neunte Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Liza Marklund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maj Sjöwall • Per Wahlöö
Der Polizistenmörder
Ein Kommissar-Beck-Roman
In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Liza Marklund.
Über dieses Buch
Ein Sexualverbrecher. Ein Polizistenmörder. Ganz Schweden jagt das Böse
Eine Frau ist verschwunden. Zum Kreis der Verdächtigen zählt auch Folke Bengtsson, ein entlassener Sexualstraftäter. Die Polizei gräbt sein Grundstück komplett um, doch zur Enttäuschung der versammelten Reporter wird die dort vermutete Leiche nicht gefunden. Hat der Mann sie woanders verscharrt? Doch während Martin Beck immer mehr Zweifel an Bengtssons Schuld kommen, jagt die Presse schon einer neuen Sensation hinterher: Nach einer Schießerei zwischen Streifenpolizisten und zwei jugendlichen Dieben kann einer der beiden entkommen. Und nun fahnden Presse und Polizei im ganzen Land nach dem Polizistenmörder.
Dies ist der neunte Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Liza Marklund.
Vita
Das schwedische Autorenduo Maj Sjöwall und Per Wahlöö schrieb einen Zyklus von zehn Kriminalromanen um Kommissar Martin Beck, die zu einem einzigartigen Welterfolg wurden. Mit ihrer Mischung aus Gesellschaftskritik, Spannung und Unterhaltung haben Sjöwall/Wahlöö die Spannungsliteratur revolutioniert und eine ganze Generation von Krimiautoren geprägt. Sie gelten als Eltern des skandinavischen Kriminalromans und sind erklärte Vorbilder von Autoren wie Henning Mankell und Håkan Nesser. Die zehn Bände der Kommissar-Beck-Reihe sind in 35 Sprachen übersetzt worden und erreichten bisher eine Gesamtauflage von über 10 Millionen Exemplaren. Alle Romane wurden außerdem sehr erfolgreich fürs Fernsehen verfilmt.
Maj Sjöwall, 1935 in Stockholm geboren, studierte Graphik und Journalismus und arbeitete für verschiedene Zeitschriften. Mit ihrem Mann Per Wahlöö schrieb sie die erfolgreiche Krimiserie um Kommissar Martin Beck, die auch verfilmt wurde. 1996 erhielt Sjöwall für die erste Serienverfilmung von Kommissar Beck den Adolf-Grimme-Preis (zusammen mit Gösta Ekmann). Zuletzt arbeitete Maj Sjöwall als Übersetzerin in Stockholm, wo sie im April 2020 verstarb.
Per Wahlöö, 1926 im schwedischen Lund geboren, machte nach dem Studium der Geschichte als Journalist Karriere. In den Fünfzigerjahren ging er nach Spanien und wurde 1956 vom Franco-Regime ausgewiesen. Nach verschiedenen Reisen um die halbe Welt ließ er sich wieder in Schweden nieder und arbeitete dort als Schriftsteller. Per Wahlöö starb 1975 in seiner Heimatstadt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1974 unter dem Titel «Polismördaren» bei P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2025
Copyright © 1976, 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Polismördaren» Copyright © 1974 by Maj Sjöwall und Per Wahlöö
Redaktion Dagmar Lendt
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München, Unter Verwendung eines Motivs von Adobe Photoshop KI
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-02293-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Liza Marklund
Ich weiß nicht mehr, wann ich den Polizistenmörder zum ersten Mal gelesen habe. Genau wie Maj Sjöwalls und Per Wahlöös andere Kriminalromane begleitet er mich schon, seit ich denken kann. Die Serie über Martin Beck ist Teil meiner Kindheit und Jugend, meiner Beziehung zu Schweden und zur Wirklichkeit.
Im Laufe der Jahre bin ich immer wieder auf die Serie zurückgekommen. Zuletzt vorige Weihnachten, da habe ich alle zehn Bände in der Taschenbuchausgabe auf eine Weltreise mitgeschleppt. Den Polizistenmörder habe ich auf Rarotonga gelesen, einer der Cookinseln im südlichen Pazifik. Er hat auch dort ganz ausgezeichnet funktioniert.
Seit ich selbst Romane über Verbrechen schreibe und Journalisten mich interviewen, sind mir oft Fragen zu diesem ganz speziellen Typ von Kriminalgeschichten gestellt worden, der da in Skandinavien entstanden ist.
In meinen Augen wurde der moderne Polizeiroman von niemand anderem geschaffen als von Maj Sjöwall und Per Wahlöö mit ihrer Serie über Martin Beck, Gunvald Larsson, Kollberg und all die anderen. Das Paar Sjöwall-Wahlöö hat einen völlig neuen Standard für kriminalpolitisches Erzählen gesetzt, die beiden verbanden hohe literarische Qualität mit einer dramaturgisch geschickten Handlung – und einem sozialen Engagement, das die Seiten zum Glühen brachte.
Die Erklärung für ihren großen Erfolg liegt meines Erachtens in der Kombination dieser drei Faktoren, wobei der dritte wahrscheinlich der entscheidende ist.
In den skandinavischen Ländern, und vielleicht allen voran in Schweden, ist die Haltung zur eigenen Vortrefflichkeit schon lange ambivalent. Wir haben einen Hang zur Selbstgefälligkeit, die nur zum Teil gerechtfertigt ist. Sicherlich, unser Lebensstandard ist einer der höchsten der Welt, die Säuglingssterblichkeit ist gering, und Frauen sind in der Politik stark vertreten: Uns geht es sehr gut. Gleichzeitig aber weist das schwedische «Volksheim» deutliche Risse auf, und das nicht erst seit gestern.
Segregation und Klassenunterschiede nehmen zu, wir leben in einer gewalttätigen Gesellschaft. Welches andere Land der westlichen Welt hat in den vergangenen zwanzig Jahren mit ansehen müssen, dass zwei seiner führenden Politiker auf offener Straße ermordet werden? Außer Schweden keines. Man wird in Stockholm eher beraubt als in New York, die Gewalt gegen Frauen ist in Schweden viel brutaler als in Spanien.
Gleichzeitig wollen wir der Welt gern etwas von unserer idyllischen Überlegenheit erzählen. Das schwedische Modell wird den übrigen Nationen des Erdballs noch immer als utopische und vorzügliche Alternative angepriesen: Würden alle so handeln wie wir, gäbe es keine Probleme auf der Welt.
Irgendwo in dieser Lücke zwischen Utopie und Wirklichkeit haben Maj Sjöwall und Per Wahlöö eine Wahrheit gefunden, die zu erforschen für sie als Schriftsteller außerordentlich interessant war – und für die Leser, daran teilzuhaben.
Die Serie mit dem Untertitel «Roman über ein Verbrechen» wurde in der politisch bewussten Zeit Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre geschrieben. Sjöwall-Wahlöö leuchteten den deutlichen Riss zwischen den Visionen der Gesellschaft und der Realität der Menschen aus, wiesen auf die Folgen des Scheiterns hin.
Nach ihnen kam eine ganze Reihe skandinavischer Krimiautorinnen und -autoren, die mit gleichem Anspruch in dieser Tradition schreiben: Jan Guillou, Henning Mankell, Anne Holt und ich selbst, um nur einige wenige zu nennen.
Die Form ist natürlich genial. Kein Mensch ist eine Insel, jedes Verbrechen ist Resultat einer Gesellschaft, deren Mitglieder wiederum von ihr geprägt werden. Deshalb stellen Kriminalromane vermutlich die beste Form für politisches oder gesellschaftskritisch inspizierendes Erzählen dar.
Das bringt mit sich, dass Kriminalromane in aller Regel ein sehr deutliches Zeitbild vermitteln. Das Erzählen baut wesentlich auf Details auf, das liegt in der Natur des Genres. Um das Verbrechen aufzuklären, muss der Held, und mit ihm der Leser, das Augenmerk gleichzeitig auf den groben Kontext wie auf das Kleingedruckte, auf das Sublime wie auf das Konkrete richten.
Der Polizistenmörder ist der vorletzte Roman in der Serie von Sjöwall-Wahlöö. Er ist erstmals 1974 erschienen und trägt sehr deutlich die Färbung und Stimmung seines Ortes und seiner Zeit.
Gleichzeitig wirkt der Roman extrem modern. Was mir bei der neuerlichen Lektüre auffällt, sind seine hyperaktuellen Fragen nach der Verteilung der Ressourcen dieser Gesellschaft, nach den Folgen von Verbrechen und Strafe, danach, was Außenseitertum und Vorurteile mit uns Menschen anstellen.
Darüber hinaus gibt es darin unheimlich wirkliche Szenarien, praktisch Voraussagen über die Zukunft, von der die Autoren selbstverständlich keine Ahnung hatten.
In einer Szene des Romans wird ein mutmaßlicher Polizistenmörder in einem gestohlenen Auto durch Schweden gejagt. Er hat mit einem Komplizen Einbrüche verübt, das Auto ist voller Diebesgut. Sie werden von der Polizei angehalten, es kommt zum Schusswechsel, ein Polizist stirbt. Der gejagte Polizistenmörder flieht mit dem Auto. In dem kleinen Ort Malexander in Östergötland, mitten im Nirgendwo, legt er einen Zwischenstopp ein, bevor er in Richtung Stockholm weiterfährt.
Dies spielt sich, im Roman, Anfang der siebziger Jahre ab.
Gut fünfundzwanzig Jahre später, am 28. Mai 1999, wurden auf derselben Strecke, wie sie Sjöwall-Wahlöös Romanfigur fährt, drei Bankräuber gejagt. Sie legten in Malexander einen Zwischenstopp ein, wurden von der Polizei eingeholt, es kam zum Schusswechsel. Zwei Polizisten wurden ermordet, die Verbrecher fuhren anschließend in Richtung Stockholm weiter.
Auch die im Roman nun folgende Jagd stimmt mit der Wirklichkeit mehr als dreißig Jahre später auf entsetzliche Weise überein.
In der Nacht zum 28. Juli 2004 brach einer der Polizistenmörder von Malexander zusammen mit ein paar anderen Gefangenen aus der außerhalb Stockholms gelegenen Strafanstalt Hall aus. Ihre Flucht gestaltete sich genauso tollpatschig wie die des Polizistenmörders im Buch; die Ausbrecher hatten zu wenig Wasser dabei und drohten in der Sommerhitze auszutrocknen. Sie waren hungrig und erschöpft. Am Ende gerieten sie in Streit, wer die Karte und den Kompass halten sollte, und so konnten sie gefasst werden.
Auch die über jedes Maß und Ziel hinausgehende Jagd der Polizei ist in dem Roman exakt beschrieben.
Zusammengenommen vermittelt das alles eine Art Sicherheit.
Verbrechen hat es immer schon gegeben.
Die Polizei hat sich schon oft dumm angestellt.
Trotzdem ist auch heute Morgen die Sonne aufgegangen.
Darin, so glaube ich, liegt der Kern des Kriminalromans.
Der Polizistenmörder
1
Sie war frühzeitig an der Haltestelle. Der Bus würde erst in einer halben Stunde kommen. Dreißig Minuten sind keine sonderlich lange Zeit im Leben eines Menschen. Außerdem war sie es gewohnt, zu warten und immer frühzeitig dran zu sein. Sie dachte darüber nach, was sie kochen könnte, und ein bisschen auch, wie sie aussah. Wie sie es immer tat.
Aber wenn der Bus kam, würde sie überhaupt nicht mehr denken. Sie hatte nur noch siebenundzwanzig Minuten zu leben.
Das Wetter war schön, die Luft klar, und im Wind lag ein Hauch früher Herbstkühle, doch ihre Haare waren viel zu gut präpariert, als dass ihnen das Wetter etwas anhaben konnte.
Wie sah sie aus?
So, wie sie dort am Straßenrand stand, mochte sie in den Vierzigern sein, eine ziemlich große, kräftig gebaute Frau mit geraden Beinen, breiten Hüften und geheimen Fettpölsterchen, die sie ängstlich zu kaschieren trachtete. Ihre Art, sich zu kleiden, war in erster Linie modisch bedingt, was oft auf Kosten der Bequemlichkeit ging, und an diesem windigen Herbsttag trug sie einen hellgrünen Mantel im Stil der dreißiger Jahre, Nylonstrümpfe und dünne braune Lackstiefel mit Plateausohlen. Über ihrer linken Schulter hing eine kleine viereckige Tasche mit großem Messingschloss, auch sie braun, desgleichen die Nappahandschuhe. Das blonde Haar war ordentlich gesprayt und das Make-up mit Sorgfalt aufgetragen.
Sie bemerkte das Auto erst, als es hielt. Der Mann am Steuer beugte sich über den Beifahrersitz und öffnete die Tür.
«Willst du mitfahren?», fragte er.
«Ja», sagte sie ein wenig verwirrt. «Ja, sicher. Ich hätte nicht gedacht …»
«Was hättest du nicht gedacht?»
«Na ja, ich habe nicht erwartet, dass mich jemand mitnimmt. Ich wollte mit dem Bus fahren.»
«Ich wusste doch, wo du bist», sagte er. «Und es passt zufällig gerade. Nun mach schon!»
Mach schon. Wie viele Sekunden brauchte sie, um einzusteigen und sich neben den Fahrer zu setzen? Mach schon. Er fuhr schnell, und im nächsten Moment waren sie zum Ort hinaus.
Sie hatte die Tasche auf dem Schoß und saß leicht angespannt da, vielleicht verwundert oder ein wenig überrascht. Ob positiv oder negativ, war schwer zu entscheiden; sie wusste es selbst nicht.
Sie sah ihn von der Seite an, doch der Mann schien seine Aufmerksamkeit ganz aufs Fahren zu konzentrieren.
Er bog von der Landstraße nach rechts ab und gleich darauf noch einmal. Wiederholte die Prozedur. Die Straße wurde immer schlechter. Man hätte darüber diskutieren können, ob es überhaupt noch eine Straße war.
«Was hast du vor?», fragte sie und kicherte ein wenig ängstlich.
«Muss was erledigen.»
«Wo denn?»
«Hier», sagte er und hielt an.
Vor sich sah er seine eigenen Reifenspuren im Moos. Sie waren erst wenige Stunden alt.
«Da drüben», sagte er und nickte. «Hinter dem Holzstapel. Da ist es gut.»
«Soll das ein Scherz sein?»
«Über so was scherze ich nie.»
Die Frage schien ihn verletzt oder aufgebracht zu haben.
«Aber mein Mantel», wandte sie ein.
«Lass ihn im Auto.»
«Aber …»
«Da ist eine Decke.»
Er stieg aus, ging ums Auto herum und hielt ihr die Tür auf.
Sie stützte sich an ihm ab und zog den Mantel aus. Packte ihn ordentlich zusammengelegt neben die Handtasche auf den Sitz.
«Also dann.»
Er wirkte ruhig und gelassen, nahm sie aber nicht bei der Hand, sondern ging langsam zu dem Holzstapel hinüber. Sie folgte ihm.
Dahinter war es windgeschützt, warm und sonnig. Die Luft war erfüllt von Fliegengesurr und dem Duft nach frischem Grün. Immer noch fast Sommer, und dieser Sommer war der wärmste in der Geschichte des Wetterdienstes gewesen.
Es war kein Holzhaufen, sondern ein ungefähr zwei Meter hoher Stapel aus zersägten Buchenstämmen.
«Zieh die Bluse aus.»
«Ja», sagte sie verlegen.
Er wartete geduldig, während sie die Bluse aufknöpfte.
Dann half er ihr behutsam heraus, ohne ihren Körper zu berühren.
Sie stand mit der Bluse in der Hand da und wusste nicht, wohin damit.
Er nahm sie ihr ab und legte sie vorsichtig über den Rand des Holzstoßes. Ein Ohrenkneifer lief im Zickzack über den Stoff.
Sie stand im Rock vor ihm, mit schweren Brüsten in einem hautfarbenen BH, den Rücken an die glatten Sägeflächen der Holzstämme gelehnt.
Nun war der Augenblick des Handelns gekommen, und der Mann handelte so schnell und überrumpelnd, dass sie gar nicht erfasste, was geschah. Sie hatte noch nie sonderlich schnell reagiert.
Er griff ihr genau am Nabel mit beiden Händen in den Bund und riss mit einem heftigen Ruck den Rock und die Strumpfhose entzwei. Er war stark, und der Stoff zerriss sofort mit einem ratschenden Geräusch, als zerfetzte man ein altes Markisengewebe. Der Rock rutschte ihr bis zu den Waden, Strumpfhose und Slip zerrte er ihr bis zu den Kniekehlen, dann zog er das linke BH-Körbchen hoch, sodass die Brust schlaff und schwer herabfiel.
Erst in diesem Moment hob sie den Blick und sah ihm in die Augen. Sie waren voller Abscheu, Hass und wilder Begierde.
Der Gedanke zu schreien konnte nicht mehr reifen. Außerdem wäre es zwecklos gewesen. Der Ort war sorgfältig gewählt.
Er streckte die Arme aus, legte seine kräftigen, braungebrannten Finger um ihren Hals und würgte sie.
Ihr Hinterkopf wurde gegen die Stämme gepresst, und sie dachte: Meine Frisur.
Das war das Letzte, was sie dachte.
Er umklammerte ihren Hals ein wenig länger als nötig.
Dann löste er seine rechte Hand, und während er die Frau noch aufrecht hielt, rammte er ihr mit aller Gewalt die Faust in den Unterleib.
Sie fiel zu Boden und lag so gut wie nackt zwischen Waldmeister und Vorjahreslaub.
Aus ihrer Kehle drang ein Röcheln. Er wusste, dass dies normal und sie schon tot war.
Der Tod ist nie sonderlich schön; abgesehen davon war sie zeit ihres Lebens nicht schön gewesen, nicht einmal in ihrer Jugend.
Wie sie jetzt inmitten von Pflanzen und Blättern auf dem Waldboden lag, war sie höchstens pathetisch.
Er wartete ungefähr eine Minute, bis sich sein Atem und sein Herzschlag normalisiert hatten.
Dann war er wieder wie immer, ruhig und rational.
Hinter den aufgestapelten Stämmen war seit dem großen Herbst sturm von 1968 ein unzugänglicher Windwurf, und dahinter befand sich eine sehr dichte, knapp mannshohe Fichtenschonung.
Er packte sie unter den Achseln und spürte mit Unbehagen ihre borstigen, schweißnassen Haarstoppeln in den Handflächen.
Es dauerte einige Zeit, sie durch das unwegsame Gelände aus umgestürzten Stämmen und ausgerissenen Baumwurzeln zu schleppen, doch er hatte keine Eile. Ein paar Meter weiter war eine schlammige Senke, gefüllt mit lehmgelbem Wasser. Dort stieß er sie hinein und trat den schlaffen Körper in den Morast. Doch vorher betrachtete er sie noch einen Augenblick und stellte fest, dass ihre Haut nach dem sonnigen Sommer immer noch braun war, die linke Brust dagegen blass und hellbraun gesprenkelt. Leichenblass, konnte man fast sagen.
Er ging zum Auto zurück und holte den grünen Mantel. Überlegte einen Moment, was er mit der Tasche machen sollte. Dann nahm er die Bluse vom Holzstapel, wickelte sie um die Handtasche und brachte alles zu dem Schlammpfuhl. Die Farbe des Mantels war ziemlich auffällig, also holte er einen starken Ast und drückte Mantel, Tasche und Bluse so tief wie irgend möglich nach unten.
Die nächste Viertelstunde verbrachte er damit, Fichtenzweige und große Moosstücke zusammenzutragen. Damit deckte er den Pfuhl so sorgfältig ab, dass jemand, der zufällig vorbeikam, ihn gar nicht bemerken würde.
Er studierte das Ergebnis einige Minuten und nahm ein paar Korrekturen vor, bis er zufrieden war.
Er zuckte mit den Schultern und kehrte zum Auto zurück. Holte ein Knäuel Putzwolle aus dem Kofferraum und wischte sich die Gummistiefel ab. Als er damit fertig war, warf er das Knäuel auf die Erde. Und da lag es, nass, lehmverschmiert, deutlich sichtbar. Das spielte keine Rolle. Putzwolle kann überall herumliegen. Sie beweist nichts und kann mit nichts Speziellem in Verbindung gebracht werden.
Dann setzte er sich ins Auto und fuhr davon.
Unterwegs dachte er, dass alles gutgegangen war und sie genau das bekommen hatte, was sie verdiente.
2
Vor einem Mietshaus am Råsundavägen in Solna parkte ein Auto. Es war ein schwarzer Chrysler mit weißen Kotflügeln, und auf den Türen, der Motorhaube und dem Kofferraum stand in massiven weißen Blockbuchstaben das Wort POLIZEI. Jemand hatte auf dem hinteren Kennzeichen mit einem weißen Klebeband den unteren Bogen des B in der Buchstabenkombination BIG überklebt und dadurch die Identität des Fahrzeugs noch deut licher gemacht.
Scheinwerfer und Innenbeleuchtung waren ausgeschaltet, doch auf dem Vordersitz des Wagens reflektierten blanke Uniformknöpfe und weiße Koppeln schwach das Licht der Straßenlaternen.
Obwohl es erst halb neun war und der Oktoberabend schön, sternenklar und nicht sonderlich kalt, lag die lange Straße zeitweise völlig verwaist da. Die Fenster der Mietshäuser auf beiden Straßenseiten waren erleuchtet, und in manchen sah man den kalten blauen Schein eines Fernsehers.
Der eine oder andere Passant, der auf seinem Abendspaziergang vorbeikam, betrachtete das Polizeiauto neugierig, verlor aber das Interesse gleich wieder, weil dessen Anwesenheit mit keiner merklichen Aktivität verbunden zu sein schien. Zwei ganz normale Polizeibeamte, die müßig in ihrem Auto saßen – mehr gab es nicht zu sehen.
Die Männer im Auto hätten ebenfalls nichts gegen ein bisschen Aktivität gehabt. Sie standen schon über eine Stunde dort und beobachteten unentwegt eine Haustür schräg gegenüber und ein erleuchtetes Fenster rechts davon im Erdgeschoss. Aber sie konnten warten. Darin hatten sie Routine.
Bei näherer Betrachtung wäre einem vielleicht der Gedanke gekommen, dass sie eigentlich doch nicht wie ganz normale Streifenpolizisten aussahen. Ihre Ausstattung war völlig in Ordnung, sie waren vorschriftsmäßig gekleidet, und es fehlten weder Koppel noch Schlagstock, noch die Pistole im Holster. Etwas seltsam war dagegen, dass der Fahrer, ein korpulenter Mann mit jovialer Erscheinung und wachem Blick, und sein schlankerer Kollege, der leicht zusammengesunken mit der Schulter am Seitenfenster lehnte, eher um die fünfzig zu sein schienen. Streifenpolizisten sind in der Regel durchtrainierte junge Männer, und wenn es mal eine Ausnahme von dieser Regel gibt, wird dem älteren Polizisten meistens ein jüngerer Kollege zur Seite gestellt.
Eine Funkstreifenbesatzung, deren Alter, wie in diesem Fall, zusammengerechnet hundert Jahre überstieg, war zweifellos ein einzigartiges Phänomen. Doch es gab dafür eine Erklärung.
Die Männer in dem schwarzweißen Chrysler hatten sich ganz einfach als Streifenpolizisten verkleidet, und hinter dieser listigen Maskerade verbargen sich keine Geringeren als der Chef der Reichsmordkommission Martin Beck und sein engster Mitarbeiter Lennart Kollberg.
Die Idee zu dieser Verkleidung stammte von Kollberg und entsprang seinem Wissen über den Mann, den sie ergreifen wollten. Der Mann hieß Lindberg, wurde Limpan genannt und war ein Dieb. Er hatte sich auf Einbrüche spezialisiert, aber auch den einen oder anderen Raubüberfall begangen und sich, allerdings weniger erfolgreich, an einem Betrug versucht. Viele Jahre seines Lebens hatte er hinter Gittern verbracht, war aber, nachdem er eine Strafe abgesessen hatte, derzeit ein freier Mann. Eine Freiheit, die nur von kurzer Dauer sein würde, falls Martin Beck und Kollberg mit ihrem Vorhaben Erfolg hatten.
Drei Wochen zuvor war Limpan im Zentrum von Uppsala in einen Juwelierladen marschiert und hatte den Inhaber mit vorgehaltenem Revolver gezwungen, ihm Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von insgesamt rund 200000 Kronen auszuhändigen. So weit war alles ganz schön und gut, und Limpan hätte sich mit seiner Beute aus dem Staub machen können, wenn aus den hinteren Räumen nicht plötzlich eine Verkäuferin aufgetaucht wäre und Limpan, von Panik ergriffen, nicht einen Schuss abgefeuert hätte, der die Verkäuferin mitten in die Stirn traf und sie auf der Stelle tötete. Limpan konnte entkommen, und als die Stockholmer Polizei ihn zwei Stunden später in der Wohnung seiner Verlobten in Midsommarkransen suchte, lag er im Bett. Die Verlobte behauptete, er sei erkältet und in den vergangenen vierundzwanzig Stunden nicht vor die Tür gegangen, und die Hausdurchsuchung förderte weder Schmuck noch Uhren, noch Geld zutage. Limpan wurde vernommen und dem Juwelier gegenübergestellt, der sich bezüglich der Identität des Räubers nicht ganz sicher war, weil dieser eine Maske getragen hatte. Die Polizei dagegen war nicht im Zweifel; zum einen konnte man davon ausgehen, dass Limpan nach dem langen Gefängnisaufenthalt blank war, außerdem hatte ein Spitzel erzählt, dass Limpan etwas von einem geplanten Bruch «in einer anderen Stadt» gesagt habe, und zum anderen hatte ein Augenzeuge Limpan zwei Tage vor dem Raub vermutlich auf Erkundungstour durch die Straße schlendern sehen, in der das Juweliergeschäft lag. Limpan stritt ab, jemals in Uppsala gewesen zu sein, und musste schließlich mangels Beweisen freigelassen werden.
Drei Wochen lang hatte man Limpan nun überwacht, in der Überzeugung, dass er früher oder später den Ort aufsuchen würde, wo er die Beute aus dem Coup versteckt hatte. Limpan schien sich jedoch darüber klar zu sein, dass er beschattet wurde; ein paarmal hatte er den Zivilfahndern, die ihn überwachten, sogar zugewinkt, und wie es schien, verfolgte er nur das eine Ziel, sie zu beschäftigen. Offensichtlich hatte er kein Geld, zumindest gab er keins aus, denn seine Verlobte hatte Arbeit und versorgte ihn über das hinaus, was er jede Woche an regulärer Unterstützung beim Sozialamt abholte, mit Kost und Logis.
Zu guter Letzt beschloss Martin Beck, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und Kollberg kam auf die glänzende Idee mit der Verkleidung als Funkstreife. Da Limpan einen Polizisten, egal wie zivil gekleidet, schon von weitem erkannte, auf uniformierte Beamte aber von jeher mit verächtlicher Nonchalance reagierte, durfte in diesem Fall eine Uniform wohl die beste Verkleidung sein. So Kollbergs Überlegung, und Martin Beck gab ihm recht, wenn auch mit leisem Zweifel.
Keiner der beiden hatte sich von der neuen Taktik ein schnelles Ergebnis erhofft, und sie waren positiv überrascht, als Limpan, sobald er sich unbeobachtet fühlte, in ein Taxi stieg und zu der Adresse am Råsundavägen fuhr. Allein schon die Wahl des Verkehrsmittels schien auf eine gewisse Zielstrebigkeit hinzudeuten, und sie waren überzeugt, dass etwas im Busch war. Falls es ihnen gelang, ihn mitsamt der Beute aus dem Raubüberfall und womöglich auch der Mordwaffe zu erwischen, wäre er mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen und der Fall für sie erledigt.
Limpan war jetzt schon anderthalb Stunden in dem Haus schräg gegenüber; vor einer Stunde hatten sie ihn flüchtig am Fenster rechts von der Haustür gesehen, seitdem war nichts passiert.
Kollberg bekam allmählich Hunger. Er hatte oft Hunger und sprach oft vom Abnehmen. Hin und wieder begann er eine Abmagerungskur, gab aber meistens bald wieder auf. Er wog mindestens zwanzig Kilo zu viel, war aber durchtrainiert und gut in Form und für seine Körperfülle und seine bald fünfzig Jahre notfalls erstaunlich schnell und gelenkig.
«Verdammt lange her, dass man was zu futtern gekriegt hat», sagte Kollberg.
Martin Beck schwieg dazu. Er war nicht hungrig, sehnte sich aber plötzlich nach einer Zigarette. Nach einer ernsten Schussverletzung in der Brust vor zwei Jahren hatte er eigentlich aufgehört zu rauchen.
«Ein Mann mit meinem Körperumfang braucht wirklich etwas mehr als nur ein hartgekochtes Ei am Tag», fuhr Kollberg fort.
Würdest du nicht so viel essen, hättest du keinen solchen Körperumfang, und dann müsstest du auch nicht so viel essen, dachte Martin Beck, sagte aber nichts. Kollberg war sein bester Freund, und dies war ein heikles Kapitel. Er wollte ihn nicht verletzen, und er wusste, dass Kollberg, wenn er Hunger hatte, besonders schlecht gelaunt war. Außerdem wusste er, dass Kollberg seine Frau eindringlich gebeten hatte, ihn auf eine Diät zu setzen, die lediglich aus hartgekochten Eiern bestand. Diese Diät hielt er allerdings nicht sehr streng ein, weil das Frühstück oft die einzige Mahlzeit war, die er zu Hause aß; die anderen nahm er in einem Lokal oder in der Kantine des Polizeipräsidiums zu sich, und da gab es nicht nur hartgekochte Eier, das konnte Martin Beck bezeugen.
Kollberg nickte in Richtung einer erleuchteten Konditorei, zwanzig Meter von ihrem Wagen entfernt.
«Möchtest du nicht …»
Martin Beck öffnete die Tür zum Gehsteig und setzte einen Fuß hinaus.
«Doch, natürlich. Was willst du haben? Kopenhagener?»
«Ja, und ein Mandeltörtchen», sagte Kollberg.
Martin Beck kehrte mit einer Tüte voll Gebäck zurück, und sie beobachteten schweigend das Haus, in dem sich Limpan aufhielt, während Kollberg aß und seine Uniform vollkrümelte. Als er aufgegessen hatte, schob er den Sitz eine Raste weiter zurück und lockerte das Koppel.
«Was hast du denn in deinem Holster?», fragte Martin Beck.
Kollberg knöpfte das Holster auf und reichte ihm die Waffe. Eine Spielzeugpistole italienischen Fabrikats, massiv, gut gearbeitet und fast so schwer wie Martin Becks Walther, aber zu etwas anderem, als Zündplättchen zu verknallen, nicht brauchbar.
«Tolles Ding», sagte Martin Beck. «So was hätte man als kleiner Junge haben müssen!»
Unter den Kollegen war allgemein bekannt, dass Lennart Kollberg sich weigerte, eine Waffe zu tragen. Da er am eifrigsten von allen dafür eintrat, dass im normalen Polizeidienst überhaupt keine Waffen getragen werden sollten, glaubten die meisten, seine Weigerung beruhe auf einer Art Pazifismus und darauf, dass er mit gutem Beispiel vorangehen wolle.
Das stimmte zwar, war aber nur die halbe Wahrheit. Martin Beck war einer der wenigen, die den tieferen Grund für Kollbergs Waffenverweigerung kannten.
Lennart Kollberg hatte einmal einen Menschen erschossen. Das war schon mehr als zwanzig Jahre her, aber er hatte es nie vergessen, und seit etlichen Jahren trug er allenfalls bei kritischen und gefährlichen Einsätzen eine Waffe.
Der Vorfall hatte sich im August 1952 ereignet, als Kollberg im zweiten Revier auf Söder in Stockholm Dienst tat. Spätabends war in der Strafanstalt Långholmen Alarm ausgelöst worden, weil dort drei bewaffnete Männer beim Versuch, einen Gefangenen zu befreien, einen Wärter angeschossen hatten. Als das Einsatzfahrzeug, in dem Kollberg saß, am Gefängnis ankam, hatten die flüchtenden Männer ihr Auto auf der Västerbron an einem Brückengeländer zu Schrott gefahren, und einer der drei war gefasst worden. Die zwei anderen waren über die Brücke in den Långholmspark entkommen. Beide standen unter dem Verdacht, bewaffnet zu sein, und da Kollberg als guter Schütze galt, wurde er der Gruppe von Polizisten zugeteilt, die versuchen sollte, die Männer im Park einzukreisen.
Mit der Pistole in der Hand war er zum Wasser hinuntergestiegen und am Ufer entlanggegangen, und während er sich vom Lichtschein oben auf der Brücke entfernte, horchte und spähte er in die Dunkelheit. Nach einer Weile war er auf einer glatten Felsplatte, die in die Bucht hinausragte, stehengeblieben, hatte sich hinuntergebeugt und die Hand ins Wasser getaucht, das sich lau und weich anfühlte. Als er sich wieder aufrichtete, knallte ein Schuss, und bevor die Kugel ein paar Meter hinter ihm ins Wasser schlug, hatte er gespürt, wie sie ihn am Ärmel streifte. Der Schütze war irgendwo im Dunkel des Gebüsches am Abhang über ihm. Kollberg warf sich sofort flach auf den Boden und robbte in die schützende Ufervegetation. Dann kroch er langsam nach oben zu einem Felsblock, der schräg über der Stelle aufragte, wo er den Schützen vermutete. Als er den großen Stein erreicht hatte, sah er wie erwartet den Mann, der sich gegen die offene helle Bucht abzeichnete. Er stand, Kollberg halb zugewandt und mit schussbereiter Waffe in der erhobenen Hand, nur etwa zwanzig Meter von ihm entfernt und bewegte langsam den Kopf von einer Seite zur anderen. Hinter ihm fiel der Steilhang zum Riddarfjärden ab.
Kollberg hatte auf die rechte Hand des Mannes gezielt. Im selben Moment, als sein Finger auf den Abzug drückte, tauchte hinter dem Mann plötzlich jemand auf, warf sich auf dessen Arm und in Kollbergs Kugel hinein und verschwand so plötzlich, wie er gekommen war.
Kollberg begriff erst gar nicht, was geschehen war. Der Mann lief los, Kollberg schoss erneut und traf ihn diesmal in die Kniekehle. Dann ging er zu der Stelle und schaute den Abhang hinunter.
Unten am Rand des Wassers lag der Mann, den er getötet hatte. Es war ein junger Polizist vom selben Revier wie er. Sie hatten oft zusammen Dienst gehabt und waren außerordentlich gut miteinander ausgekommen.
Die Sache wurde vertuscht und Kollbergs Name im Zusammenhang damit nie erwähnt. Offiziell war der junge Polizist durch einen Irrläufer gestorben, einen ziellosen Schuss aus dem Nirgendwo, abgefeuert bei der Jagd auf einen gefährlichen Desperado. Kollbergs Chef hatte ihm einen kleinen Vortrag gehalten, worin er ihn vor Grübeleien und Selbstvorwürfen warnte und den er mit dem Hinweis schloss, dass selbst Karl XII. einst aus Versehen und Nachlässigkeit seinen Stallmeister und guten Freund erschossen habe; ein Unglücksfall, der folglich den Besten passieren konnte. Damit sollte die Sache aus der Welt sein, aber Kollberg hatte den Schock nie richtig überwunden und trug darum seit vielen Jahren eine Zündplättchenpistole, wenn er sichtbar bewaffnet sein musste.
Weder Kollberg noch Martin Beck dachten an diese Geschichte, als sie in dem Streifenwagen saßen und darauf warteten, dass Limpan auftauchte.
Kollberg gähnte und rutschte unruhig hin und her. Er saß unbequem hinter dem Steuer, und die Uniform war ihm zu eng. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt eine Uniform getragen hatte, es war jedenfalls sehr lange her. Im Moment trug er eine geliehene, die zwar zu klein war, aber nicht annähernd so eng wie seine eigene alte, die zu Hause im Schrank hing.
Er sah Martin Beck an, der noch tiefer in seinen Sitz gesunken war und durch die Windschutzscheibe starrte.
Sie sagten beide nichts, sie kannten sich schon lange, waren seit vielen Jahren im Dienst und in der Freizeit zusammen und brauchten nicht zu reden, nur damit geredet wurde. Unzählige Male hatten sie so wie jetzt dagesessen: in einem Auto nachts auf einer Straße, wartend.
Seit Martin Beck Chef der Reichsmordkommission war, brauchte er sich eigentlich kaum noch persönlich mit Dingen wie Beschattung und Überwachung abzugeben, dafür hatte er seine Leute. Er tat es trotzdem oft, obwohl solche Aufträge im Allgemeinen todlangweilig waren. Er wollte den Kontakt zu dieser Seite seiner Arbeit nicht verlieren, auch wenn er jetzt Chef war und die zunehmende Bürokratie mit all ihren Unannehmlichkeiten immer mehr von seiner Zeit beanspruchte. Obwohl das eine das andere leider nicht ausschloss, saß er doch lieber mit Kollberg zusammen in einem Auto und gähnte, als dass er in einer Sitzung mit dem Reichspolizeichef versuchte, nicht zu gähnen.
Martin Beck mochte weder Bürokratie noch Sitzungen, noch den Reichspolizeichef. Kollberg dagegen mochte er sehr, und es fiel ihm schwer, sich seine Arbeit ohne ihn vorzustellen. Kollberg hatte seit langem hin und wieder den Wunsch geäußert, seinen Beruf als Polizist an den Nagel zu hängen, doch in jüngster Zeit schien er immer fester entschlossen zu sein, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Martin Beck wollte ihn weder dazu ermuntern noch ihm davon abraten; er wusste, dass Kollbergs Solidaritätsgefühl gegenüber der Polizei mittlerweile gegen null ging und er immer öfter mit seinem Gewissen in Konflikt geriet. Er wusste auch, dass er nur sehr schwer eine befriedigende und einigermaßen gleichwertige Arbeit finden würde. In einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit, in der Akademiker und gut ausgebildete Fachkräfte aus allen möglichen Berufen und vor allem Jugendliche keine Beschäftigung hatten, waren die Aussichten für einen fünfzigjährigen Expolizisten nicht gerade rosig. Aus rein egoistischen Gründen wollte er natürlich, dass Kollberg blieb, aber Martin Beck war kein ausgesprochener Egoist, und die Vorstellung, Kollberg irgendwie zu beeinflussen, war ihm fremd.
Kollberg gähnte wieder.
«Sauerstoffmangel», sagte er und kurbelte das Fenster herunter. «Ein Glück, dass man seinen Streifendienst zu einer Zeit gemacht hat, als Polizisten ihre Füße noch zum Gehen benutzt haben und nicht nur dazu, Leute zu treten. Diese Herumhockerei macht einen ja klaustrophobisch!»
Martin Beck nickte. Auch er fühlte sich nicht gern eingeschlossen.
Sowohl Martin Beck als auch Kollberg hatten ihre Polizeilaufbahn Mitte der vierziger Jahre in Stockholm begonnen. Martin Beck hatte auf Norrmalm das Straßenpflaster abgewetzt, und Kollberg war durch die Gassen von Gamla Stan gestiefelt. Damals hatten sie sich noch nicht gekannt, aber ihre Erfahrungen aus jener Zeit waren im Großen und Ganzen die gleichen.
Es wurde halb zehn. Die Konditorei schloss, und in immer mehr Fenstern entlang der Straße ging das Licht aus. Die Wohnung, in der Limpan sich aufhielt, war nach wie vor erleuchtet.
Plötzlich ging schräg gegenüber die Haustür auf, und Limpan trat auf den Gehsteig heraus. Er hatte die Hände in den Manteltaschen und eine Zigarette im Mundwinkel.
Kollberg legte die Hände ans Steuer, und Martin Beck setzte sich auf.
Limpan blieb vor der Haustür stehen und rauchte in aller Ruhe seine Zigarette.
«Er hat keine Tasche bei sich», stellte Kollberg fest.
«Er kann das Zeug in den Manteltaschen haben», sagte Martin Beck. «Oder er hat es verkauft. Wir müssen überprüfen, bei wem er war.»
Minuten vergingen. Nichts geschah. Limpan schaute zum sternübersäten Himmel hinauf und schien die Nachtluft zu genießen.
«Er wartet auf ein Taxi», meinte Martin Beck.
«Scheint ewig zu brauchen», sagte Kollberg.
Limpan zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und schnippte die Kippe auf die Straße. Dann schlug er den Mantelkragen hoch, steckte die Hände in die Taschen und kam quer über die Straße auf das Polizeiauto zu.
«Er kommt hierher», sagte Martin Beck. «Verdammt. Was machen wir jetzt? Ihn ins Auto laden?»
«Ja», antwortete Kollberg.
Limpan trat langsam auf den Wagen zu, bückte sich, schaute Kollberg durchs Seitenfenster an und begann zu lachen. Dann ging er ums Heck herum auf den Gehsteig. Er öffnete die Beifahrertür, wo Martin Beck saß, beugte sich vor und lachte aus vollem Hals.
Martin Beck und Kollberg schwiegen und ließen ihn lachen, weil sie schlicht nicht wussten, was sie machen sollten.
Nach einer Weile erholte sich Limpan etwas von seinem Lachkrampf und fragte:
«Hat man euch endlich degradiert? Oder soll das eine Maskerade sein?»
Martin Beck seufzte und stieg aus. Er öffnete die hintere Tür.
«Rein mit dir, Lindberg», sagte er. «Wir nehmen dich mit nach Västberga.»
«Prima», erwiderte Lindberg gutmütig. «Dann habe ich es nicht so weit nach Hause.»
Auf dem Weg zum Polizeipräsidium Süd erzählte Limpan, dass er in Råsunda seinen Bruder besucht habe, was kurz darauf von einer Funkstreife bestätigt wurde, die dorthin beordert worden war. Waffen, Geld oder Diebesgut fanden sich nicht in der Wohnung. Limpan selbst hatte 27 Kronen bei sich.
Um Viertel vor zwölf wurde es Zeit, Limpan laufenzulassen, und Martin Beck und Kollberg konnten allmählich daran denken, Feierabend zu machen.
Bevor Limpan ging, sagte er:
«Hätte übrigens nie gedacht, dass ihr so viel Humor habt. Zuerst das mit der Verkleidung – das war schon saukomisch. Aber das Beste war, dass ihr das mit dem PIG auf eurem Auto gebracht habt, das hätte glatt von mir stammen können!»
Sie waren nur mäßig amüsiert, hörten aber sein lautes Gelächter noch, als er schon weit die Treppen hinunter war. Er klang fast wie «Der lachende Polizist».
Eigentlich war es ziemlich egal. Limpan würde bald gefasst werden. Er gehörte zu denen, die immer gefasst wurden.
Und sie selbst sollten sehr bald an ganz andere Probleme zu denken haben.
3
Der Flughafen war ein nationaler Skandal und machte seinem Ruf alle Ehre. Die eigentliche Flugzeit von Arlanda aus hatte zwar nur fünfzig Minuten betragen, doch mittlerweile kreiste die Maschine schon anderthalb Stunden über dem südlichsten Teil des Landes.
Nebel, lautete die lakonische Erklärung.
Und genau das war zu erwarten gewesen. Das Flugfeld war, nachdem man die Bevölkerung zwangsumgesiedelt hatte, an einem der nebligsten Flecken Schwedens angelegt worden. Sicherheitshalber mitten in einem berühmten Vogelzuggebiet und in äußerst unbequemer Entfernung zur Stadt.
Obendrein war dadurch ein Stück Landschaft zerstört worden, das eigentlich unter Naturschutz gehört hätte. Der Schaden war umfassend und irreparabel und stellte ein schweres Umweltverbrechen dar, das für den antihumanen Zynismus, der zunehmend die «menschliche Gesellschaft» kennzeichnete, typisch war. Dieser Ausdruck stand seinerseits für einen derart grenzenlosen Zynismus, dass Normalsterbliche ihn nur mit Mühe fassen konnten.
Schließlich wurde der Pilot es leid und setzte, Nebel hin, Nebel her, zur Landung an. Eine Handvoll blasser, schwitzender Passagiere defilierte in lichter Reihe in die Ankunftshalle.
Die Farbgebung im Inneren der Halle, Grau und Safrangelb, schien den Geruch nach Pfusch und Korruption noch zu unterstreichen.
Jedenfalls hatte jemand einige Millionen auf seine Schweizer Bankkonten beiseiteschaffen können. Jemand, der ein so hohes Amt bekleidete, dass sich jeder Bürger seiner eigenen geringen, rein formalen Teilhabe an der schwedischen Pseudodemokratie und ihrem bald totalen Bankrott schämte.
Martin Beck konnte auf ein paar unangenehme Stunden zurückblicken. Fliegen war ihm schon immer zuwider gewesen, und die neuen Triebwerke machten die Sache nicht besser. Der Jet vom Typ Douglas DC-9 war gleich zu Beginn steil in eine für gewöhnliche, erdgebundene Menschen unbegreifliche Höhe aufgestiegen und anschließend mit abstrakter Geschwindigkeit über das Land gedüst, nur um am Ende monoton zu kreisen. Die Flüssigkeit in den Pappbechern war angeblich Kaffee und rief unverzüglich Übelkeit hervor. Die Luft in der Kabine war ungesund und schweißtreibend. Bei den wenigen Mitreisenden handelte es sich um abgehetzte Technokraten und Geschäftsleute, die pausenlos auf die Uhr schauten und nervös in ihre Aktentaschen schielten.
Die Ankunftshalle konnte man noch nicht einmal als ungemütlich bezeichnen. Sie war vielmehr monströs, eine Umweltkatastrophe, die einen staubigen Busbahnhof irgendwo in der Einöde als lebendig und menschlich erscheinen ließ. Es gab einen Würstchenstand, der eine ungenießbare, nährwertfreie Parodie auf Essen feilbot, einen Zeitungskiosk mit Kondomständern und vulgären Magazinen, leere Gepäcklaufbänder und etliche Stühle, die vermutlich aus den Glanzzeiten der Inquisition stammten. Dazu ein Dutzend gähnende und schier zu Tode gelangweilte Polizisten und Zollbeamte, die man zweifellos hierher strafversetzt hatte, und ein einziges Taxi, dessen Fahrer mit der neuesten Nummer einer Pornozeitung vor sich auf dem Lenkrad schlief.
Martin Beck wartete unglaublich lange auf seine kleine Tasche, erhielt sie schließlich und trat in den Herbstnebel hinaus.
Das Taxi bekam einen Fahrgast und rollte davon.
In der Halle hatte niemand etwas gesagt oder Miene gemacht, ihn zu erkennen. Die Menschen dort wirkten apathisch, fast so, als hätten sie die Sprache verloren oder zumindest jegliches Interesse, sich auszudrücken.
Der Chef der Reichsmordkommission war eingetroffen, aber niemand schien dieses Ereignis gebührend zu würdigen. Nicht einmal die unerfahrensten Journalisten hatten Lust, sich hierherzubequemen, um ihr Leben mit Kartenspielen, verkochten Würstchen und petrochemischen Limonaden zu bereichern. Sogenannte Prominente verirrten sich ohnehin nicht hierher.
Vor der Ankunftshalle standen zwei orangerote Busse. Plastikschilder zeigten ihren jeweiligen Zielort an. Lund und Malmö. Die Fahrer rauchten schweigend.
Die Nacht war lau und die Luft feucht. Neblige Gloriolen um gaben die elektrischen Lampen.
Die Busse fuhren ab, der eine leer, der andere mit einem Fahrgast. Die übrigen Reisenden eilten zum Langzeitparkplatz.
Martin Beck hatte noch immer schweißfeuchte Hände; er ging wieder in die Halle und fand eine Toilette. Die Spülung war kaputt. Im Pissoir lagen ein halb aufgegessenes Würstchen und eine Schnapsflasche. Haare klebten am fettigen Schmutzrand des Waschbeckens. Der Papierhandtuchspender war leer.
Das war der Flughafen Malmö-Sturup. So neu, dass er noch gar nicht ganz fertig war.
Martin Beck bezweifelte, dass es Sinn hatte, ihn fertigzustellen. In gewisser Weise konnte er als perfekt betrachtet werden. Das manifestierte Fiasko.
Er trocknete sich die Hände mit seinem Taschentuch ab. Stand ein Weilchen in der Dunkelheit und fühlte sich einsam.
Er hatte nicht gerade erwartet, dass in der Ankunftshalle das Polizeiorchester bereitstehen oder der Polizeipräsident ihn hoch zu Ross empfangen würde.
Möglicherweise hatte er sich aber ein bisschen mehr als überhaupt nichts erwartet.
Er kramte in der Hosentasche nach Kleingeld und spielte mit dem Gedanken, ein öffentliches Telefon zu suchen, bei dem nicht das Kabel durchgeschnitten oder der Münzschlitz mit Kaugummi verklebt war.
Da durchdrang ein Licht den Nebel. Ein schwarzweißer Streifenwagen kam die Zufahrtsstraße herauf und bog vor dem safrangelben Kasten ein.
Er fuhr sehr langsam, und als er auf der Höhe des einsamen Reisenden war, blieb er stehen. Das Seitenfenster wurde heruntergekurbelt, und ein rothaariger Mensch mit schütteren Polizisten koteletten starrte ihn kalt an.
Martin Beck sagte nichts.
Nach ungefähr einer Minute hob der Mann die Hand und winkte ihn mit dem Zeigefinger zu sich heran. Martin Beck ging zu dem Auto.
«Was lungerst du hier herum?»
«Ich warte, dass man mich abholt.»
«Dass man dich abholt? Was du nicht sagst.»
«Ihr könnt mir vielleicht helfen.»
Der Streifenbeamte wirkte verblüfft.
«Helfen? Was soll das heißen?»
«Ich bin zu spät dran, und ihr könntet eventuell über Funk Kontakt aufnehmen.»
«Du hast sie wohl nicht alle!»
Ohne Martin Beck aus den Augen zu lassen, sagte er über die Schulter:
«Hast du das gehört, he? Der meint, wir könnten ihm über Funk jemand rufen. Der hält uns wohl für eine Hurenvermittlung oder so, was? Hast du das gehört?»
«Ja, ja», erwiderte der andere Polizist gelangweilt.
«Kannst du dich ausweisen?», fragte der erste.
Martin Beck griff nach seiner Gesäßtasche, überlegte es sich aber anders und ließ die Hand sinken.
«Ja», sagte er. «Aber ich will nicht.»
Er drehte ihnen den Rücken zu und ging zu seiner Tasche zurück.
«Hast du das gehört, he?», sagte der Streifenbeamte. «Er meint, er will nicht. Er hält sich wohl für einen tollen Hecht. Hältst du ihn für einen tollen Hecht?»
Die Ironie war so wuchtig, dass seine Worte wie Ziegelsteine zu Boden fielen.
«Ach, lass ihn doch», sagte der Polizist am Steuer. «Keinen Stunk mehr heute Abend, he.»
Der Rothaarige stierte Martin Beck an. Lange. Es folgte eine murmelnde Konversation, und dann fuhren sie los. Zwanzig Meter weiter hielten sie erneut, um ihn im Rückspiegel zu beobachten.
Martin Beck schaute in eine andere Richtung. Er seufzte schwer.
Wie er dastand, konnte man ihn für eine x-beliebige Person halten.
Im vergangenen Jahr war es ihm gelungen, einiges von seinem alten Polizistengebaren abzulegen. Er verschränkte beispielsweise nicht mehr bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit die Hände auf dem Rücken und konnte jetzt eine Weile still stehen, ohne auf den Füßen zu wippen.
Obwohl er ein bisschen zugelegt hatte, war er mit seinen einundfünfzig Jahren noch immer ein großer, gutgebauter Mann, drahtig, aber ein klein wenig gebeugt. Er kleidete sich auch legerer als früher, doch lag in der Wahl seiner Kleidung keine zwanghafte Jugendlichkeit: Sandalen, Jeans, Rollkragenpullover und blaue Dralonjacke. Für einen Kriminalkommissar konnte diese Aufmachung dagegen als unkonventionell bezeichnet werden.
Für zwei Polizeibeamte in einem Funkstreifenwagen war sie offensichtlich ziemlich schwer verdaulich. Sie sannen noch immer über die Situation nach, als ein tomatenroter Opel Ascona zur Ankunftshalle einbog und anhielt. Ein Mann stieg aus, ging ums Auto herum und sagte:
«Herrgott Nöjd!»
«Martin Beck.»
«Sonst grienen immer alle, wenn ich mich vorstelle.»
«Grienen?»
«Ja, sie lachen.»
«Aha», sagte Martin Beck.
Er lachte nicht so leicht.
«Man muss ja zugeben, dass es ein alberner Name für einen Polizisten ist: Herrgott Nöjd. Darum stelle ich mich immer so vor, als würde ich fluchen: Herrgott nochmal! Das bringt die Leute gewissermaßen aus dem Konzept.»
Der Mann verstaute Martin Becks Tasche im Kofferraum.
«Ich bin spät dran», sagte er. «Keiner wusste, wo die Maschine landen würde. Ich war mir fast sicher, dass sie wie immer nach Kopenhagen ausweichen würde, und war bereits in Limhamn, als ich Bescheid bekam, dass sie hier gelandet ist. Sorry.»
Er blinzelte ihn unsicher an, als wollte er herausfinden, ob der hohe Gast schlechter Laune war.
Martin Beck zuckte mit den Schultern.
«Macht nichts», sagte er. «Ich habe es nicht eilig.»
Nöjd warf einen Blick zum Streifenwagen hinüber, der immer noch mit laufendem Motor dastand.
«Das ist nicht mein Bezirk», sagte er und grinste. «Die Jungs da drüben sind aus Malmö. Besser, wir machen uns aus dem Staub, bevor wir verhaftet werden!»
Der Mann lachte offensichtlich gern. Außerdem tat er es leise und ansteckend.
Martin Beck verzog trotzdem noch immer keine Miene. Zum einen gab es nicht viel zu lachen, zum anderen versuchte er, sich von dem Mann ein Bild zu machen. Eine Art vorläufige Personenbeschreibung zu skizzieren.
Nöjd war klein und o-beinig, das heißt klein dafür, dass er bei der Polizei war. Mit seinen geschnürten grünen Gummistiefeln, dem Anzug aus graubraunem Diagonal und dem ausgebleichten Safarihut im Nacken sah er wie ein Landwirt aus, oder zumindest wie jemand mit eigenem Jagdrevier. Er hatte ein braungebranntes, wettergegerbtes Gesicht, und sein Blick aus den braunen, von Lachfältchen umgebenen Augen war lebhaft. Nöjd war repräsentativ für eine gewisse Kategorie von Provinzpolizisten. Ein Typus, der nicht zu dem neuen, uniformen Stil passte und deshalb allmählich verschwand, aber noch nicht ganz ausgerottet war.
Er war vermutlich älter als Martin Beck, hatte aber den Vorteil, in einer ruhigeren und gesünderen Umgebung zu arbeiten, was keineswegs bedeutete, dass sie ruhig und gesund war.
«Ich bin schon fast fünfundzwanzig Jahre hier. Aber das ist neu für mich. Reichsmordkommission. Aus Stockholm. So was!»
Nöjd schüttelte den Kopf.
«Wird schon gutgehen», sagte Martin Beck. «Oder …»
Den Rest sagte er still für sich: Oder gar nicht.
«Genau», bekräftigte Nöjd. «Ihr versteht euch ja auf so was.»
Martin Beck fragte sich, ob der Mann ihn aus Unsicherheit nicht duzte oder ob er lieber im Plural sprach. Schließlich war ja auch Lennart Kollberg mit dem Auto aus Stockholm hierher unterwegs und würde wahrscheinlich morgen eintreffen. Er war seit vielen Jahren Martin Becks rechte Hand.
«Diese Geschichte sickert bald durch», sagte Nöjd. «Ich habe heute so ein paar Typen im Ort gesehen. Journalisten, schätze ich mal.»
Er schüttelte wieder den Kopf.
«Wir sind das nicht gewohnt. Diese Art von Aufmerksamkeit.»
«Ein Mensch ist verschwunden», sagte Martin Beck. «Das ist nichts Ungewöhnliches.»
«Nein, darin liegt die Crux ja auch nicht. Ganz und gar nicht. Wollen wir das jetzt gleich durchgehen?»
«Lieber nicht, nimm’s mir nicht übel, bitte.»
«Ich nehme nie etwas übel. Das liegt mir nicht.»
Er lachte wieder, unterbrach sich jedoch und fügte nüchtern hinzu:
«Und ich bin schließlich nicht der Ermittlungsleiter.»
«Die betreffende Person taucht vielleicht wieder auf. Das ist oft so.»
Nöjd schüttelte zum dritten Mal den Kopf.
«Das glaube ich nicht», sagte er. «Falls meine Meinung irgendwie maßgeblich ist. Im Übrigen ist sowieso alles sonnenklar. Das sagen alle. Vermutlich haben sie recht. Dieser ganze Quatsch, entschuldige bitte, mit der Reichsmordkommission und so beruht auf den extremen Umständen.»
«Wer sagt das?»
«Der Meister. Der oberste Boss.»
«Der Polizeipräsident in Trelleborg?»
«Genau. Okay, wir lassen das jetzt. Das ist die neue Straße zum Flughafen. Und hier kommen wir auf die große Straße von Malmö nach Ystad. Die ist auch neu. Siehst du die Lichter rechts da drüben?»
«Ja.»
«Das ist Svedala. Gehört noch zum Polizeibezirk von Malmö. Ein verdammt großer Bezirk.»
Sie hatten die Nebelbank hinter sich gelassen, die offensichtlich sehr lokal auf das Flugfeld begrenzt war. Der Himmel war sternenklar. Martin Beck hatte das Seitenfenster heruntergekurbelt und atmete die Gerüche von draußen ein. Benzin und Diesel, aber auch eine fette Mischung aus Humus und Dung. Sie wirkte schwer und satt. Nahrhaft. Nöjd fuhr nur ein paar hundert Meter auf der großen Straße. Dann bog er nach rechts ab, und die Landluft wurde noch gediegener.
Sie roch sehr eigen.
«Nach Kraut und Rübenschnitzel», sagte Nöjd. «Erinnert einen an die Zeit, als man noch ein kleiner Bengel war.»
Auf der großen Straße waren in dichtem Strom Pkw und Fernlaster dahingedonnert, hier dagegen schienen sie allein zu sein. Die Nacht lag dunkel und wattig über der welligen Ebene.
Man merkte, dass Nöjd diese Strecke schon Hunderte Male gefahren war und wirklich jede Kurve kannte. Er fuhr in gleichmäßigem Tempo und brauchte kaum auf die Fahrbahn zu schauen.
Er steckte sich eine Zigarette an und reichte die Packung weiter.
«Nein danke», sagte Martin Beck.
Er hatte in den vergangenen zwei Jahren kaum öfter als fünf Mal geraucht.
«Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du im Gasthof wohnen», sagte Nöjd.
«Ja, das wäre mir recht.»
«Ich habe dort schon ein Zimmer reserviert.»
«Prima.»
Vor ihnen tauchten die Lichter einer größeren Ortschaft auf.
«Wir sind sozusagen am Ziel», sagte Nöjd. «Das ist Anderslöv.»
Die Straßen waren leer, aber gut beleuchtet.
«Kein Nachtleben hier», erklärte Nöjd. «Ruhig und friedlich. Schön. Ich lebe schon mein ganzes Leben hier und hatte nie zu klagen. Bis jetzt.»
Sieht verdammt tot aus, dachte Martin Beck. Aber vielleicht soll das so sein.
Nöjd bremste, zeigte auf ein niedriges Haus aus gelben Ziegeln und sagte:
«Das Polizeirevier. Jetzt ist es natürlich zu. Ich kann aber aufschließen, wenn du willst.»
«Nicht nötig.»
«Der Gasthof liegt gleich um die Ecke. Der Garten, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, gehört dazu. Die Gastwirtschaft hat um diese Zeit allerdings nicht geöffnet. Wenn du willst, fahren wir zu mir und genehmigen uns ein Bier und ein paar belegte Brote.»
Martin Beck hatte keinen Hunger. Die Flugreise hatte ihm den Appetit verdorben. Er lehnte höflich ab. Dann fragte er:
«Ist es weit zum Strand?»
Die Frage schien den anderen nicht sehr zu verwundern. Nöjd wunderte sich vielleicht über gar nichts.
«Nein», antwortete er. «Kann man nicht sagen.»
«Wie lange fährt man dorthin?»
«Ungefähr eine Viertelstunde. Höchstens.»
«Würde es dir was ausmachen, hinzufahren?»
«Durchaus nicht.»
Nöjd bog ab, allem Anschein nach auf die Hauptverkehrsstraße.
«Das ist die größte Sehenswürdigkeit am Ort», sagte er. «Die Landstraße. Die alte Hauptverbindung zwischen Malmö und Ystad. Wenn wir rechts abbiegen, sind wir südlich der alten Landstraße. Dann bist du wirklich in Schonen.»
Die Nebenstraße war kurvig, aber Nöjd fuhr auch sie mit selbstverständlicher Leichtigkeit. Sie kamen an Bauernhöfen und weißen Kirchen vorbei.
Nach zehn Minuten begann es nach Meer zu riechen. Und wenig später waren sie am Strand.
«Soll ich anhalten?»
«Ja bitte.»
«Wenn du im Wasser waten möchtest, ich habe noch ein Paar Gummistiefel im Kofferraum», sagte Nöjd und kicherte.
«Gern, danke.»
Martin Beck zog die Stiefel an. Sie waren ihm ein bisschen zu eng, aber er wollte ja keine längeren Ausflüge machen.
«Wo sind wir jetzt genau?»
«In Böste. Die Lichter rechts, das ist Trelleborg. Das Leuchtfeuer linker Hand ist Smygehuk. Weiter kannst du nicht kommen.»
Smygehuk war die südlichste Landspitze Schwedens.
Den Lichtern und dem Widerschein am Himmel nach zu urteilen war Trelleborg eine große Stadt. Ein großes erleuchtetes Passagierschiff hielt Kurs auf den Hafen, vermutlich die Eisenbahnfähre aus Saßnitz in der DDR.
Die Ostsee rollte träge ans Ufer. Leise zischend wurde das Wasser vom feinkörnigen Sand aufgesogen.
Martin Beck stapfte über den wogenden Wall aus Tang. Ging ein paar Schritte ins Wasser. Es kühlte angenehm durch die Stiefelschäfte.