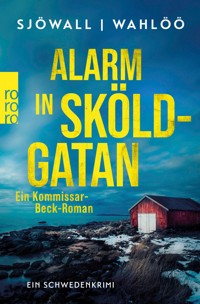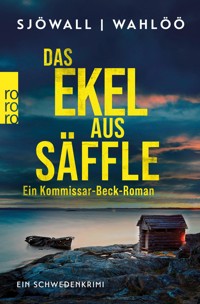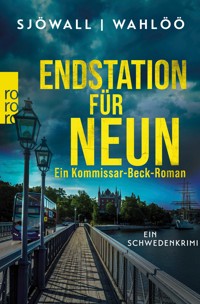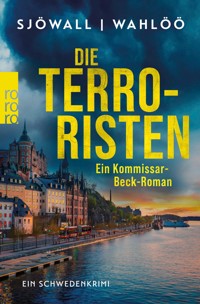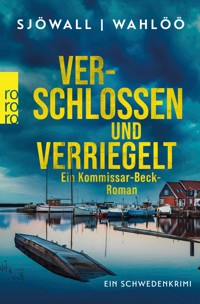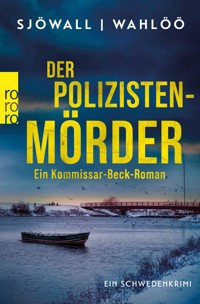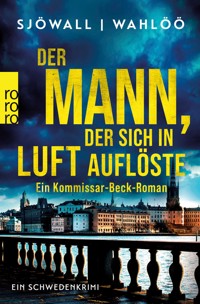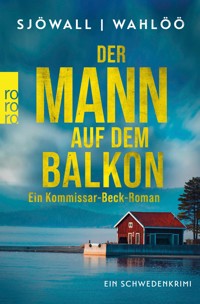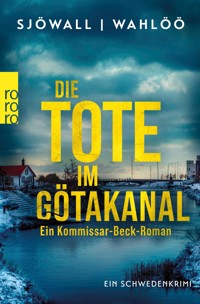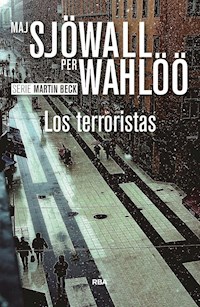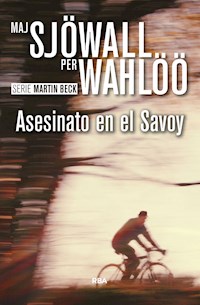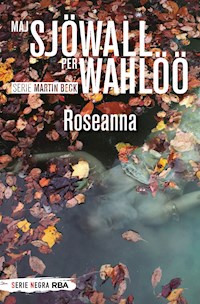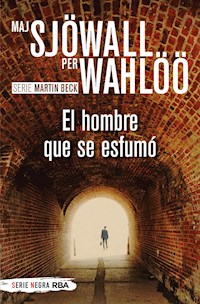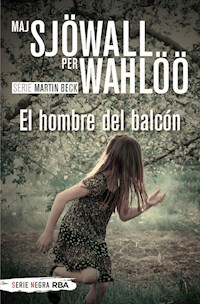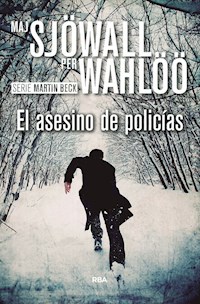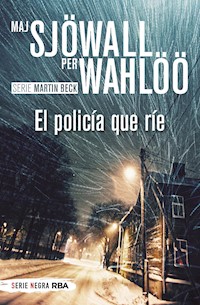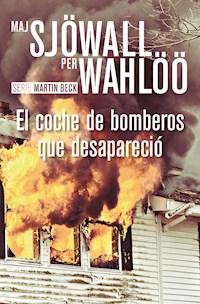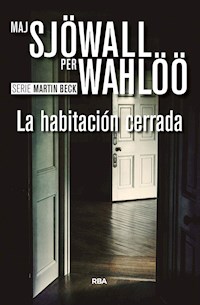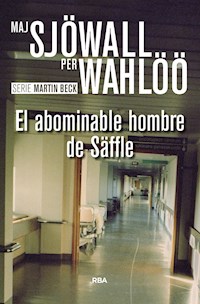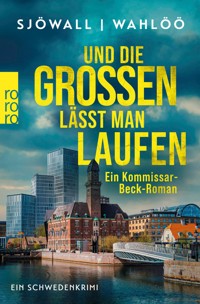
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martin Beck ermittelt
- Sprache: Deutsch
Band 6: Schmutzige Geschäfte – doch Kommissar Beck jagt auch die Bosse In einem Hotel in Malmö wird der Konzernchef eines großen Unternehmens vor den Augen der anderen Gäste erschossen. Viktor Palmgren war zu einem Geschäftsessen dort, der Täter kann unbehelligt entkommen. Zunächst verhört die Stockholmer Polizei die Gäste des "Savoy". Doch niemand hat den Mörder erkannt oder vermag ihn genau zu beschreiben. Also muss Martin Beck die Ermittlungen übernehmen... Dies ist der sechste Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Arne Dahl (Stummer Schrei, Kaltes Fieber).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maj Sjöwall • Per Wahlöö
Und die Großen lässt man laufen
Ein Kommissar-Beck-Roman
Mit einem Vorwort von Arne Dahl
In neuer Übersetzung von Hedwig M. Binder
Über dieses Buch
Schmutzige Geschäfte – doch Kommissar Beck jagt auch die Bosse
In einem Hotel in Malmö wird der Konzernchef eines großen Unternehmens vor den Augen der anderen Gäste erschossen. Viktor Palmgren war zu einem Geschäftsessen dort, der Täter kann unbehelligt entkommen. Zunächst verhört die Stockholmer Polizei die Gäste des «Savoy». Doch niemand hat den Mörder erkannt oder vermag ihn genau zu beschreiben. Also muss Martin Beck die Ermittlungen übernehmen …
Dies ist der sechste Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Arne Dahl.
Vita
Das schwedische Autorenduo Maj Sjöwall und Per Wahlöö schrieb einen Zyklus von zehn Kriminalromanen um Kommissar Martin Beck, die zu einem einzigartigen Welterfolg wurden. Mit ihrer Mischung aus Gesellschaftskritik, Spannung und Unterhaltung haben Sjöwall/Wahlöö die Spannungsliteratur revolutioniert und eine ganze Generation von Krimiautoren geprägt. Sie gelten als Eltern des skandinavischen Kriminalromans und sind erklärte Vorbilder von Autoren wie Henning Mankell und Håkan Nesser. Die zehn Bände der Kommissar-Beck-Reihe sind in 35 Sprachen übersetzt worden und erreichten bisher eine Gesamtauflage von über 10 Millionen Exemplaren. Alle Romane wurden außerdem sehr erfolgreich fürs Fernsehen verfilmt.
Maj Sjöwall, 1935 in Stockholm geboren, studierte Graphik und Journalismus und arbeitete für verschiedene Zeitschriften. Mit ihrem Mann Per Wahlöö schrieb sie die erfolgreiche Krimiserie um Kommissar Martin Beck, die auch verfilmt wurde. 1996 erhielt Sjöwall für die erste Serienverfilmung von Kommissar Beck den Adolf-Grimme-Preis (zusammen mit Gösta Ekmann). Zuletzt arbeitete Maj Sjöwall als Übersetzerin in Stockholm, wo sie im April 2020 verstarb.
Per Wahlöö, 1926 im schwedischen Lund geboren, machte nach dem Studium der Geschichte als Journalist Karriere. In den Fünfzigerjahren ging er nach Spanien und wurde 1956 vom Franco-Regime ausgewiesen. Nach verschiedenen Reisen um die halbe Welt ließ er sich wieder in Schweden nieder und arbeitete dort als Schriftsteller. Per Wahlöö starb 1975 in seiner Heimatstadt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1970 unter dem Titel «Polis, Polis, potatismos!» bei P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2025
Copyright © 1972, 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Polis, Polis, potatismos!» Copyright © 1970 by Maj Sjöwall und Per Wahlöö
Formulierungen und Begriffe in diesem Buch bilden den zu ihrer Zeit üblichen Sprachgebrauch ab und sind in ihrem sprachlichen sowie historischen Kontext zu betrachten. Für diese Ausgabe wurden rassistische Bezeichnungen für Menschen außerhalb der intendierten Figurenrede in der Übersetzung nicht verwendet und in der Rede unkenntlich gemacht, Schwarz wird als Beschreibung eines Erfahrungshorizonts großgeschrieben.
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-02289-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Arne Dahl
Es ist ungewöhnlich für eine literarische Tradition, ein richtiges Elternpaar zu haben. Noch ungewöhnlicher ist es für ein ganzes Genre. Aber für das nach wie vor stärkste schwedische Krimigenre, den gesellschaftskritischen Polizeiroman, trifft es tatsächlich zu. Vor Maj Sjöwall und Per Wahlöö sah der schwedische Krimi ganz anders aus. Mit ihnen ging jegliche Whodunit-Naivität rettungslos verloren.
Fast alle Schwedinnen und Schweden, die Polizeiromane schreiben, werden irgendwann zu Nachfolgern von Sjöwall/Wahlöö ernannt. Bei mir war dies etwas öfter der Fall als bei anderen. Und ich habe nicht dagegen protestiert. Wenn ich nach meinen Vorbildern gefragt werde, lautet die Antwort regelmäßig: Sjöwall/Wahlöö. Ist es doch so einfach wie wahr. Sonst bin ich in meinem Leben nicht sehr von Vorbildern abhängig – ich glaube an meinen eigenen Weg, auf Biegen oder Brechen. Das ist immer besser, als mit der Stimme eines anderen zu sprechen.
Von Krimiautoren wird fast erwartet, dass sie behaupten, keine Krimis zu lesen. Ich erlaube mir, dieser Erwartung zu entsprechen. Als ich vor etwa zehn Jahren meine ersten stolpernden Schritte auf dem Gebiet des Kriminalromans machte, konnte ich ganz wahrheitsgemäß sagen: Ich lese keine Krimis.
Das war aber nicht immer so. Im Gegenteil, muss man fast sagen. In meiner Jugend las ich in absurden Mengen Spannungsliteratur: Nägelkauerspannung, Action, Whodunit, Spionagethriller – you name it. Ich las ganz einfach alles, was nur irgendwie mit Spannung zu tun hatte.
Man kann sich natürlich fragen, wann man als Jugendlicher am empfänglichsten ist, in welchem Alter und in welchem geistigen Zustand Eindrücke am stärksten aufgenommen werden. Fünfzehn ist ein guter Kandidat. In diesem Alter durchlebt man eine der manisch-depressivsten Phasen des Lebens. Auf der einen Seite ist das Leben fast ununterbrochen eine Qual, auf der anderen Seite beginnt man langsam zu verstehen, wer man ist und welche Möglichkeiten das Leben dennoch zu bieten hat.
Sjöwall / Wahlöö traten in mein Leben, als ich mit der kindischen Spannungsliteratur eigentlich schon Schluss gemacht hatte. Ich war für ganz andere literarische Eindrücke reif (also frühreif). Aber da tauchten die beiden auf und fassten nicht nur alle unterschiedlichen Spannungstraditionen zusammen, auf die ich mich bis dahin gestürzt hatte, sondern fügten auch noch zwei Elemente hinzu, die mir bis dahin gefehlt hatten: Humor und einen Überblick über die Politik der Zeit.
Und außerdem: die richtige, richtig nuancierte und genau formulierte Sprache.
Zu einem lebenswichtigen Leseerlebnis zurückzukehren ist ein Wagnis. Die Regel heißt Enttäuschung, die Ausnahme Erleichterung. Ich bin nicht enttäuscht, wenn ich die zehn Bände des «Romans über ein Verbrechen» lese, möglicherweise ein wenig verwundert über das kleine Format, die verhältnismäßig einfachen Intrigen – und vielleicht auch die Unversöhnlichkeit von Martin Becks Lebensüberdruss. Trotzdem bin ich erleichtert. Erleichtert, dass sie nach wie vor so gut sind. Dass sie wirklich ein gutes Vorbild sind. Ich werde immer dankbar sein.
Der «Roman über ein Verbrechen» erschien zwischen 1965 und 1975 mit jährlich einem Buch, außer 1973. In diesem Jahr sagte Per Wahlöö in einem Interview: «Anfangs haben wir uns zurückgehalten, um überhaupt an das Publikum heranzukommen, aber die sozialistische Ausrichtung ist wohl immer deutlicher geworden.» Schon 1966 formulierte Wahlöö in aller wünschenswerten Deutlichkeit die Zielsetzung: «Die Grundidee besteht darin, in einem langen Roman von rund 3000 Seiten, verteilt auf zehn eigenständige Teile, oder wenn man so will Kapitel, einen Längsschnitt durch eine Gesellschaft mit einer bestimmten Struktur darzustellen und Kriminalität als eine soziale Funktion und ihr Verhältnis zur Gesellschaft wie zu den verschiedenen, diese Gesellschaft umgebenden moralischen Lebensformen zu analysieren.»
Exemplarische 68er-Literatur also. Sie erstreckt sich vom Aufbruch politischen Bewusstseins 1965 bis zum vielleicht dogmatischsten Jahr 1975. Sie hätte eigentlich wie so unglaublich vieles andere der 68er-Literatur ausfallen müssen: so politisch eindeutig, dass jegliche Form literarischer Spannung verloren geht und alles verpufft.
Seltsamerweise ist dem aber nicht so. Nicht einmal in Die Terroristen, dem letzten Band, der nach Per Wahlöös Tod recht schnell fertiggestellt wird und bis ins Kleinste ideologisch ist. Die Schlussszene ist bezeichnend: Martin Beck und seine neue Frau Rhea sitzen bei dem ausgeschiedenen Kollegen Lennart Kollberg und seiner Frau Gun zu Hause. Nun heißt es, das Werk zusammenzufassen und die Fäden aus zehn Bänden zu verknüpfen. Außerdem wird, rudimentär, ein politisches Resümee der vergangenen zehn Jahre gezogen. Das Ganze findet jedoch in einem entspannten und eindeutigen Zusammenhang statt: Die vier spielen miteinander und kabbeln sich ein wenig. Das Spiel heißt Scrabble, einer nennt einen Buchstaben und die anderen müssen versuchen, ihn in das Gitternetz auf ihrem Blatt einzupassen. Kollberg gewinnt, und sie fangen wieder von vorn an. Er darf den Zyklus mit den Worten abschließen: «Ich fange an. Dann sage ich x, x wie in Marx.»
Genau das ist der Punkt: Die literarische Gestaltung darf der politischen Agitation nie, wirklich niemals nachgeben. Man darf nie Zeit und Raum vergessen, nie, dass der Roman die Personen an einem Ort fixieren und lebendig gestalten muss – Lebendigkeit kommt immer vor der Ideologie. Wenn man genau liest.
Im sechsten Band, Und die Großen lässt man laufen, von 1970 wird die ideologische Perspektive deutlich gesteigert. Obwohl dieses Buch rein literarisch zu den besten der Reihe gehört – die technische Kunstfertigkeit ist hier am höchsten, der Humor vielleicht am ausgeprägtesten –,ist es zugleich ein problematisches Buch. Phantastisch und problematisch in einem.
Phantastisch, weil die literarische Gestaltung nirgends weiter reicht. Problematisch, weil das Buch die am wenigsten sympathische Seite der 68er-Linken präsentiert. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man von der enthumanisierenden Seite der Linken sprechen. Die extrem grobe Zeichnung der kapitalistischen Kreise, die es kritisiert, ist absolut unversöhnlich. Der Konzernchef, der im Einleitungskapitel im Savoy in Malmö hingerichtet wird, hat wirklich keinerlei versöhnende oder auch nur menschliche Züge. Obwohl die Schilderung satirische Wucht besitzt, bleibt ein bitterer Beigeschmack – so sah sie aus, die enthumanisierende Seite der Linken. Wenn die Ideologie den Humanismus aus dem Feld schlug. Wenn der Zweck die Mittel heiligen durfte.
Schluckt man indes diese Perspektive, ist Und die Großen lässt man laufen eine durchweg faszinierende Lektüre. Das Buch vermittelt ein unübertroffenes Bild des gesellschaftlichen Klimas einer Zeit, die sowohl in der schwedischen als auch in der globalen Geschichte problematisch war – ein in vieler Hinsicht idiotisches und inhumanes gesellschaftliches Klima, an dessen Rändern wir immer noch leben. Und liest man alle zehn Bände nacheinander, bekommt man tatsächlich einen «Roman über ein Verbrechen» geboten. Ein sehr großes Verbrechen.
Was haben Sjöwall / Wahlöö mit ihrer Reihe eigentlich zustande gebracht? Womit haben sie in dem Fünfzehnjährigen diese so lange vibrierende Saite angeschlagen, die ihn zwanzig Jahre später selber zum Krimiautor werden ließ? Ich vermute, es war der verhaltene Zorn. Das Feuer – allerdings ein streng in Schach gehaltenes Feuer. Die langsam wachsende Einsicht, dass ungerichteter und unkontrollierter Zorn verpufft – das Feuer aber gleichzeitig bewahrt werden muss.
Eine Form für seinen Zorn zu finden, vielleicht …
Und die Großen lässt man laufen
1
Der Tag war heiß und schwül gewesen, ohne einen Windhauch, und die Luft hatte vor Hitze geflimmert. Jetzt war der Himmel hoch und klar und bot ein Farbenspiel, das von Rosa bis Dunkelblau reichte. Bald würde die rote Sonnenscheibe irgendwo hinter Ven verschwinden, und die Abendbrise, die bereits die Wasseroberfläche des Öresunds kräuselte, wehte ein angenehm kühles Lüftchen durch die Straßen von Malmö. Der leichte Wind brachte einen Geruch nach moderndem Tang, Seegras und Abfällen mit sich, die an den Ribersborgsstrand, in die Hafeneinfahrt und weiter in die Kanäle gespült wurden.
Die Stadt lässt sich mit dem Rest von Schweden kaum vergleichen, was vor allem auf ihre geographische Lage zurückzuführen ist. Rom ist näher als die Mitternachtssonne, am Horizont sieht man die Lichter der dänischen Küste, und auch wenn die Winter oft matschig und sehr windig sind, so sind die Sommer fast genauso oft lang und warm. Dann singen Nachtigallen in den weitläufigen Parks, deren üppiges Grün einen wundervollen Duft verströmt.
Und genau so war es an diesem schönen Sommerabend Anfang Juli 1969. Es war ruhig und friedlich und ziemlich menschenleer. Der internationale Tourismus hatte sich noch nicht in größerem Umfang bemerkbar gemacht – wie übrigens selten hier –,und von den ungewaschenen und Haschisch rauchenden jugendlichen Herumtreibern aus allen Ecken und Enden der Welt hatte sich bisher nur eine Vorhut sehen lassen. Allzu viele würden einem hier sowieso nicht über den Weg laufen, weil die meisten nie über Kopenhagen hinauskamen.
Selbst in dem großen Hotel gegenüber dem Bahnhof unten am Hafen war es auffallend ruhig. Ein paar ausländische Geschäftsleute verhandelten an der Portierloge über ihre Zimmerreservierungen, der Garderobier las in der Tiefe seiner Garderobe unbehelligt einen Klassiker, und in der schummrigen Bar hielten sich lediglich ein paar leise miteinander redende Stammgäste sowie ein Barkeeper in schneeweißer Jacke auf.
Auch in dem großen, klassischen Speisesaal rechts neben der Lobby war nicht viel los, wenngleich es dort etwas lebhafter zuging. Es waren nur wenige Tische besetzt, an denen meistens nur jeweils ein einzelner, schweigsamer Gast saß, und der Pianist machte gerade Pause. Direkt vor der Schwingtür zur Küche stand ein Kellner, die Hände auf dem Rücken verschränkt, und schaute nachdenklich aus den großen geöffneten Fenstern. Vermutlich war er tief in Gedanken an nicht allzu weit entfernte Sandstrände versunken.
Am Ende des Speisesaals saß eine siebenköpfige Tischgesellschaft, eine gutgekleidete und feierliche, bunt zusammengewürfelte Runde. Ihr Tisch war mit Gläsern, allerlei kulinarischen Köstlichkeiten und Champagnerkübeln vollgestellt. Das Personal hatte sich diskret zurückgezogen, da der Gastgeber sich soeben erhoben und zu reden begonnen hatte.
Der Gastgeber war ein hochgewachsener Mann reiferen Alters, er trug einen Anzug aus dunkelblauer Schantungseide, hatte eisengraues Haar und war tief sonnengebräunt. Er sprach ruhig und routiniert mit wohlmodulierter Stimme in einem humorvollen Ton. Die anderen sechs Personen am Tisch saßen still da und sahen ihn an, nur einer von ihnen rauchte.
Durch die geöffneten Fenster hörte man die Geräusche vorbeifahrender Autos und von Zügen, die auf dem Bahnhof jenseits des Kanals rangierten, dem, nebenbei bemerkt, größten Rangiergelände Nordeuropas. In der Hafeneinfahrt ertönte kurz und heiser die Schiffssirene einer Kopenhagenfähre, und irgendwo an der Kanalböschung kicherte ein Mädchen.
Das also war die Situation an diesem milden, warmen Mittwoch im Juli, und es war ungefähr halb neun abends. Man muss den Ausdruck «ungefähr» benutzen, denn niemandem gelang es, je festzustellen, wann genau es geschah. Umso leichter lässt sich dagegen sagen, was geschah.
Ein Mann kam zur Eingangstür herein, warf einen Blick zur Rezeption mit den ausländischen Geschäftsleuten und dem Portier in seinem Gehrock, schwenkte sofort nach rechts, ging an der Garderobe vorbei und durch die schmale, langgestreckte Lobby vor der Bar und betrat den Speisesaal, ruhig und zielsicher. Er ging nicht besonders schnell. Bisher war an diesem Mann nichts Aufsehenerregendes, niemand beachtete ihn, und er sah sich auch nicht um.
Er ging an der Hammondorgel, dem Flügel, dem Serviertisch mit den zahlreichen spiegelblank geputzten Gerätschaften und schließlich an den beiden großen deckentragenden Säulen vorbei. Zielsicher steuerte er direkt auf die Gesellschaft in der Ecke zu, wo der Gastgeber, mit dem Rücken zu ihm, eine Tischrede hielt. Ungefähr fünf Schritte von ihm entfernt griff der Mann mit der Rechten in seine Jacke, eine der Frauen am Tisch schaute ihn an, und der Redner drehte den Kopf ein wenig, um zu sehen, was sie ablenkte. Er warf einen raschen, gleichgültigen Blick auf den sich nähernden Mann und wandte sich sogleich wieder seinen Gästen zu, ohne auch nur eine Sekunde lang seine Ausführungen zu unterbrechen. In diesem Augenblick zog der Neuankömmling einen stahlblauen Gegenstand mit geriffeltem Kolben und langem Lauf, zielte sorgfältig und schoss dem Redner in den Kopf. Der Knall war nicht schockierend laut, sondern klang eher wie das friedliche Puffen eines Luftgewehrs an einer Jahrmarktsschießbude.
Die Kugel drang unmittelbar hinter dem linken Ohr ein, und der Redner fiel vornüber auf den Tisch, mit der linken Wange in den Kartoffelbrei, der ein erlesenes Fischfrikassee à la Frans Suell zierte.
Während der Schütze seine Waffe einsteckte, drehte er sich abrupt nach rechts, ging die paar Schritte zum nächstgelegenen offenen Fenster, setzte den linken Fuß auf den Rahmen, schwang sich über die niedrige Scheibe, stieg in den Blumenkasten, sprang auf den Gehsteig hinunter und verschwand.
Ein Gast in den Fünfzigern drei Fenstertische weiter, der gerade von seinem Whisky trinken wollte, erstarrte mit dem Glas in der Hand und riss verdutzt die Augen auf. Vor ihm lag ein aufgeschlagenes Buch, in dem er soeben noch zu lesen vorgegeben hatte.
Der sonnengebräunte Mann in dem dunkelblauen Schantunganzug war nicht tot.
Er bewegte sich und sagte: «Au! Das tut weh.»
Tote pflegen nicht zu klagen. Im Übrigen schien er nicht einmal zu bluten.
2
Per Månsson saß in seiner Junggesellenbude in der Regementsgatan und telefonierte mit seiner Frau. Er war Kriminalhauptmeister bei der Polizei in Malmö und lebte, obwohl er verheiratet war, fünf Tage in der Woche wie ein Junggeselle. Jedes freie Wochenende verbrachte er mit seiner Frau, eine Abmachung, die sie vor mehr als zehn Jahren getroffen hatten und mit der sie beide bisher zufrieden waren.
Er klemmte den Hörer mit der linken Schulter fest, während er sich mit der rechten Hand einen Gripenberger mixte. Das war sein Lieblingsgetränk und bestand einfach nur aus rund acht Zentilitern Gin, zerstoßenem Eis und Grape Tonic in einem großen Whiskyglas.
Seine Frau war im Kino gewesen und erzählte ihm die Handlung von «Vom Winde verweht».
Das dauerte seine Zeit, doch Månsson hörte geduldig zu, denn sobald sie damit fertig wäre, würde er versuchen, sie davon abzuhalten, ihn am Wochenende zu besuchen. Er würde vorgeben, arbeiten zu müssen. Was eine Lüge war.
Es war 21.20 Uhr.
Trotz seiner leichten Bekleidung, Netzunterhemd und karierte Unterhose, schwitzte Månsson. Damit ihn der Verkehrslärm auf der Straße nicht störte, hatte er zu Beginn des Gesprächs die Balkontür geschlossen. Es war sehr warm in seinem Zimmer, obwohl die Abendsonne längst hinter den Hausdächern gegenüber verschwunden war.
Er rührte seinen Drink mit einer Gabel um, die er, wie er zu seiner Schande gestehen musste, in einem Restaurant namens Översten gestohlen oder versehentlich mitgenommen hatte. Konnte man versehentlich eine Gabel mitnehmen, fragte sich Månsson und sagte:
«Ja, ich verstehe. Es war also Leslie Howard, der … Aha, nicht. Clark Gable? Ah ja …»
Als sie fünf Minuten später endlich fertig war, tischte er seine Notlüge auf und beendete das Gespräch.
Das Telefon klingelte erneut. Månsson nahm nicht gleich ab. Er hatte frei, und so sollte es auch bleiben. Er leerte langsam seinen Gripenberger und betrachtete den dunkler werdenden Abendhimmel, während er den Hörer abnahm und sich meldete: «Ja bitte, Månsson.»
«Hallo, Nilsson hier. Das war ja ein verdammt langes Gespräch. Seit einer halben Stunde versuche ich, dich zu erreichen.»
Nilsson war Kriminalassistent und hatte in dieser Nacht im Polizeipräsidium am Davidshallstorg Dienst. Månsson seufzte.
«Nun», sagte er. «Was gibt’s denn?»
«Im Speisesaal des Savoy wurde auf einen Gast geschossen. Ich fürchte, ich muss dich bitten, dorthin zu fahren.»
Månsson nahm das leere, aber noch kalte Glas und rollte es mit der Handfläche über seine Stirn.
«Ist er tot?»
«Weiß nicht», antwortete Nilsson.
«Kannst du nicht Skacke hinschicken?»
«Er hat frei. Ich kann ihn nicht erreichen, werde es aber weiterhin versuchen. Backlund ist jetzt dort, aber du solltest vielleicht …»
Månsson zuckte zusammen und stellte das Glas ab.
«Backlund? Okay, ich fahre sofort los», sagte er.
Er telefonierte umgehend nach einem Taxi, legte den Hörer auf den Tisch und horchte, während er sich anzog, auf das Krächzen aus der Muschel, wo eine Stimme in regelmäßigen Abständen mechanisch wiederholte: «Taxi, bitte bleiben Sie am Apparat!», bevor sein Gespräch irgendwann zur Zentrale durchgestellt wurde.
Vor dem Hotel Savoy standen mehrere nachlässig geparkte Polizeiautos, und am Eingang versperrten zwei Beamte der Funkstreife dem wachsenden Pulk schaulustiger Abendspaziergänger, die sich am Fuß der Treppe eingefunden hatten, den Weg.
Während Månsson das Taxi bezahlte und die Quittung einsteckte, beobachtete er die Szene und fand, dass sich einer der Polizisten ziemlich barsch benahm. Voll Bedauern dachte er daran, dass es wohl nicht mehr lange dauern würde, bis es um das Ansehen der Polizei in Malmö ebenso schlecht bestellt wäre wie bei den Kollegen in Stockholm.
Er sagte jedoch nichts, sondern begnügte sich mit einem Kopfnicken und ging an den uniformierten Polizisten vorbei in die Lobby. Hier herrschte lautes Stimmengewirr. Das Personal aus den verschiedenen Abteilungen des Hotels redete wild durcheinander, ebenso die zahlreichen Gäste, die aus dem Grillrestaurant kamen. Einige Polizeibeamte vervollständigten das Bild. Sie wirkten ratlos und mit der Umgebung nicht vertraut. Offensichtlich hatte ihnen niemand gesagt, wie sie auftreten sollten oder was von ihnen erwartet wurde.
Månsson war ein großer Mann in den Fünfzigern und salopp mit Freizeithemd, Terylenhose und Sandalen bekleidet. Er nahm einen Zahnstocher aus seiner Brusttasche, entfernte die Papierhülle, steckte ihn in den Mund und kaute einen Augenblick darauf herum, während er sich in aller Ruhe einen Überblick über die Situation verschaffte. Es war ein amerikanischer Zahnstocher, der nach Menthol schmeckte. Månsson hatte ihn sich auf der Eisenbahnfähre Malmöhus besorgt, wo so etwas zu haben war.
An der Tür zum großen Speisesaal stand ein Polizist namens Elofsson, den er für ein bisschen schlauer als die anderen hielt. Er trat auf ihn zu und fragte:
«Was geht hier eigentlich vor?»
«Es scheint auf jemanden geschossen worden zu sein.»
«Was für Instruktionen habt ihr erhalten?»
«Gar keine.»
«Was macht Backlund?»
«Die Zeugen vernehmen.»
«Wo ist das Opfer?»
«Im Krankenhaus, nehme ich an.»
Elofsson errötete etwas. Dann sagte er:
«Offenbar war der Krankenwagen schneller zur Stelle als die Polizei.»
Månsson seufzte und ging in den Speisesaal.
Backlund stand an dem Tisch mit den silberglänzenden Servierschüsseln und vernahm einen Kellner. Backlund war ein älterer, gewöhnlich aussehender Mann mit Brille, und irgendwie hatte er es geschafft, Erster Kriminalassistent zu werden. Jetzt hielt er seinen aufgeschlagenen Block in der Hand und machte sich fleißig Notizen, während er den Kellner ausfragte. Månsson blieb in Hörweite stehen, sagte aber nichts.
«Und wann ist es passiert?»
«Tja, so gegen halb neun.»
«So gegen?»
«Ja, ich weiß es nicht genau.»
«Mit anderen Worten, Sie wissen nicht, wie spät es war?»
«Genau.»
«Äußerst merkwürdig», sagte Backlund.
«Wie bitte?»
«Ich sagte, das kommt mir äußerst merkwürdig vor. Sie tragen doch eine Armbanduhr, oder?»
«Ja, sicher.»
«Und da drüben ist eine Wanduhr, wenn ich nicht irre.»
«Schon, aber …»
«Was aber?»
«Die gehen beide verkehrt. Und außerdem habe ich gar nicht daran gedacht, auf die Uhr zu schauen.»
Backlund schien von dieser Antwort überfordert zu sein. Er legte Block und Stift beiseite und putzte seine Brille. Danach holte er tief Luft, griff wieder nach seinem Notizblock und versuchte es aufs Neue.
«Obgleich Sie zwei Uhren zur Verfügung hatten, wissen Sie also nicht, wie spät es war?»
«Doch, ungefähr.»
«Ungefähre Angaben nützen uns nichts.»
«Außerdem gehen die Uhren nicht gleich. Meine geht vor und die da drüben nach.»
Backlund zog seine eigene Uhr zu Rate.
«Merkwürdig», sagte er und notierte sich etwas.
Månsson hätte gern gewusst, was.
«Nun, Sie standen also hier, als der Täter vorbeiging?»
«Ja.»
«Können Sie mir eine möglichst genaue Personenbeschreibung geben?»
«Ich habe ihn eigentlich gar nicht wahrgenommen.»
«Sie haben den Täter gar nicht gesehen?», fragte Backlund verblüfft.
«Doch, in dem Moment, als er aus dem Fenster gestiegen ist.»
«Wie hat er denn ausgesehen?»
«Ich weiß nicht. Er war ja ziemlich weit weg, und der Tisch war von der Säule verdeckt.»
«Sie meinen, Sie wissen nicht, wie er ausgesehen hat?»
«Genau.»
«Aber wie war er gekleidet?»
«Er hatte eine braune Jacke an, glaube ich.»
«Glauben Sie.»
«Ja, ich habe ihn doch nur ganz kurz gesehen.»
«Was hatte er sonst noch an? Eine Hose vielleicht?»
«Ja, eine Hose.»
«Sind Sie sicher?»
«Ja, sonst hätte es doch ein bisschen … na, sagen wir merkwürdig ausgesehen. Ich meine, wenn er keine Hose angehabt hätte.»
Backlund schrieb, was das Zeug hielt. Månsson drehte seinen Zahnstocher im Mund herum und sagte leise:
«Hör mal, Backlund.»
Der andere drehte sich um und starrte ihn irritiert an.
«Ich bin gerade bei einer wichtigen Zeugenvernehmung …» Dann stockte er und sagte mürrisch:
«Ach so, du bist es.»
«Was ist eigentlich passiert?»
«Ein Mann ist niedergeschossen worden. Und weißt du, wer?»
«Nein.»
«Direktor Viktor Palmgren», erklärte Backlund mit Nachdruck.
«Ach der», sagte Månsson. Er dachte: Das kann ja heiter werden! Laut sagte er:
«Es ist also mehr als eine Stunde her, und derjenige, der geschossen hat, ist aus dem Fenster geklettert und abgehauen.»
«Es sieht ganz danach aus, ja.»
Backlund nahm nie etwas als gegeben hin.
«Warum stehen draußen sechs Polizeiautos?»
«Ich habe absperren lassen.»
«Was? Das Viertel?»
«Den Tatort», sagte Backlund.
«Sieh zu, dass alle Uniformierten verschwinden», sagte Månsson müde. «Es ist für das Hotel vermutlich nicht sonderlich angenehm, wenn es sowohl im Foyer als auch draußen auf der Straße von Polizisten wimmelt. Zudem werden sie bestimmt woanders dringender benötigt. Anschließend versuchst du, eine Personenbeschreibung zu erstellen. Sicherlich gibt es geeignetere Zeugen als diesen Mann hier.»
«Wir werden selbstverständlich alle vernehmen», erwiderte Backlund.
«Ja, alles zu seiner Zeit», sagte Månsson. «Halte jedenfalls niemanden fest, der nichts unmittelbar Entscheidendes zu sagen hat. Schreib einfach nur Namen und Adressen auf.»
Backlund sah ihn argwöhnisch an und fragte:
«Und was machst du?»
«Ein paar Telefonate führen», antwortete Månsson.
«Mit wem?»
«Mit den Zeitungen zum Beispiel, um herauszubekommen, was passiert ist.»
«Soll das ein Scherz sein?», fragte Backlund abweisend.
«Allerdings!», sagte Månsson zerstreut und sah sich um.
Im Speisesaal trieben sich einige Journalisten und Fotografen herum. Manche von ihnen waren bestimmt schon lange vor der Polizei hier gewesen, und wahrscheinlich hatte sich der eine oder andere gerade im Grillrestaurant oder in der Bar aufgehalten, als der berüchtigte Schuss fiel. Wenn er sie richtig einschätzte.
«Die Systematik erfordert aber …», hob Backlund an.
In diesem Moment kam Benny Skacke in den Speisesaal geeilt. Er war Kriminalassistent und gerade mal dreißig Jahre alt. Vorher war er bei der Reichsmordkommission in Stockholm gewesen, hatte sich aber versetzen lassen, weil er eine Situation falsch gedeutet hatte, was einen seiner Vorgesetzten beinahe das Leben gekostet hätte. Er war pflichtbewusst, gewissenhaft und ein bisschen naiv. Månsson mochte ihn.
«Hol dir doch Unterstützung von Skacke», sagte er.
«Dem Stockholmer?», entgegnete Backlund skeptisch.
«Genau!», sagte Månsson. «Und vergiss die Personenbeschreibung nicht. Die ist im Moment das einzig Wichtige.»
Er warf seinen zerkauten Zahnstocher in einen Aschenbecher, ging in die Lobby und lenkte seinen Schritt zum Telefon gegenüber der Portierloge.
Månsson führte rasch hintereinander fünf Gespräche. Dann schüttelte er den Kopf und ging in die Bar.
«Nein, sieh an, schönen guten Tag auch», sagte der Barkeeper.
«Hallo», erwiderte Månsson und setzte sich.
«Was darf ich Ihnen heute bringen? Das Übliche?»
«Nein, nur einen Grape Tonic. Ich muss nachdenken.»
Manchmal geht einfach alles schief, dachte Månsson. Und dieser Fall hatte wahrlich auf die denkbar schlechteste Weise begonnen. Erstens war Viktor Palmgren eine sehr bekannte und bedeutende Persönlichkeit. Es war zwar schwer zu sagen, weshalb genau, aber eines war sicher: Er hatte eine Menge Geld und war mindestens Millionär. Der Umstand, dass er in einem der berühmtesten Restaurants Europas niedergeschossen worden war, machte die Sache nicht besser. Dieser Fall würde große Aufmerksamkeit erregen und konnte die unkalkulierbarsten Konsequenzen haben. Unmittelbar nach dem Schuss hatte das Hotelpersonal den Verletzten in ein Fernsehzimmer gebracht und eine provisorische Tragbahre konstruiert. Gleichzeitig waren die Polizei und der Krankenwagen alarmiert worden. Der Krankenwagen war sehr schnell da gewesen, hatte den Verletzten mitgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei dagegen war zunächst überhaupt nicht gekommen. Und das, obwohl am Hauptbahnhof, also weniger als zweihundert Meter vom Tatort entfernt, eine Funkstreife gewesen war. Wie hatte das passieren können? Månsson hatte dafür zwar mittlerweile eine Erklärung erhalten, allerdings war diese für die Polizei nicht sonderlich schmeichelhaft. Der Alarm war zuerst falsch eingeschätzt und der Fall als weniger dringlich eingestuft worden. Die beiden Beamten am Bahnhof hatten all ihre Energie darauf verwendet, einen absolut harmlosen Betrunkenen festzunehmen. Erst nachdem die Polizei noch einmal alarmiert worden war, wurde Hals über Kopf ein Aufgebot an Wagen und Uniformierten mit Backlund an der Spitze zum Hotel beordert. Die anschließende Ermittlungsarbeit erschien völlig planlos. Månsson selbst hatte mehr als vierzig Minuten lang mit seiner Frau «Vom Winde verweht» durchgekaut. Außerdem hatte er sich zwei hinter die Binde gekippt und war nicht umhingekommen, auf ein Taxi zu warten. Als sich endlich der erste Polizist an Ort und Stelle eingefunden hatte, war seit dem Schuss bereits eine halbe Stunde vergangen. Was Viktor Palmgren betraf, war die Situation ebenfalls unklar. Man hatte ihn in der Unfallambulanz in Malmö untersucht und dann in die Neurochirurgie nach Lund überwiesen. Die Entfernung dorthin betrug ungefähr zwanzig Kilometer, und im Moment war der Krankenwagen noch unterwegs. Darüber hinaus saß in dem Krankenwagen eine der wichtigsten Zeuginnen, nämlich Palmgrens Frau. Wahrscheinlich hatte sie ihm direkt gegenüber am Tisch gesessen und die beste Möglichkeit gehabt, den Schützen aus nächster Nähe zu sehen.
Und jetzt war schon fast eine Stunde vergangen. Eine Stunde war vergeudet worden, wobei jede Sekunde kostbar gewesen wäre.
Månsson schüttelte abermals den Kopf und warf einen Blick auf die Uhr an der Bar. Halb zehn.
Backlund kam dicht gefolgt von Skacke in die Bar marschiert.
«Du sitzt hier?», fragte Backlund höchst verwundert.
Er starrte Månsson mit seinen kurzsichtigen Augen an.
«Wie läuft es mit der Personenbeschreibung?», fragte Månsson. «Es eilt.»
Backlund fummelte mit seinem Notizblock herum, legte ihn schließlich auf die Theke und nahm seine Brille ab, um sie zu putzen.
«Hier», sagte Skacke schnell. «Etwas Besseres haben wir im Moment nicht: mittelgroß, hageres Gesicht, schüttere, nach hinten gekämmte dunkelbraune Haare. Braune Jacke, pastellfarbenes Hemd, gelb oder grün, dunkle Krawatte, dunkelgraue Hose, schwarze oder braune Halbschuhe. Alter circa vierzig.»
«Gut», sagte Månsson. «Schickt das raus! Postwendend. Lasst alle Hauptstraßen sperren und Züge, Flugzeuge und Schiffe kontrollieren.»
«Wird gemacht», sagte Skacke.
«Ich möchte nicht, dass er die Stadt verlässt», erklärte Månsson.
Skacke marschierte los.
Backlund setzte seine Brille auf, starrte Månsson an und wiederholte die überaus sinnige Frage:
«Du sitzt hier?» Dann schaute er auf das Glas und fragte mit noch größerer Verwunderung:
«Und trinkst?»
Månsson antwortete nicht darauf.
Backlund richtete seine Aufmerksamkeit nun auf die Uhr an der Bar und verglich sie mit seiner Armbanduhr:
«Diese Uhr geht ebenfalls verkehrt.»
«Ja, natürlich», bestätigte der Barkeeper. «Die geht vor. Ein kleiner Service für unsere Gäste, die schnellstmöglich zum Zug oder zum Schiff müssen.»
«Oje!», seufzte Backlund. «Das werden wir wohl nie klären können. Wie soll man denn den richtigen Tatzeitpunkt feststellen, wenn man sich nicht auf die Uhr verlassen kann?»
«Ja, das ist schwierig», sagte Månsson zerstreut.
Skacke kam zurück.
«Das wäre erledigt», sagte er.
«Vermutlich zu spät», sagte Månsson.
«Wovon in aller Welt redet ihr?», fragte Backlund und griff nach seinem Notizblock. «Was diesen Kellner betrifft …»
Månsson machte eine abwehrende Geste und sagte:
«Warte. Das heben wir uns für später auf. Benny, ruf die Polizei in Lund an und bitte sie, jemand in die Neurochirurgie zu schicken. Er soll ein Tonbandgerät mitnehmen und aufzeichnen, was Palmgren zu sagen hat. Für den Fall, dass dieser irgendwann zu Bewusstsein kommen sollte. Und Frau Palmgren muss er natürlich auch vernehmen.»
Skacke entfernte sich wieder.
«Was diesen besagten Kellner betrifft, kann ich Ihnen versichern, dass er selbst dann nichts gemerkt hätte, wenn Dracula höchstpersönlich in den Speisesaal geflattert wäre», sagte der Barkeeper.
Backlund schwieg irritiert. Månsson sagte erst etwas, als Skacke zurück war. Da Backlund formell Skackes Vorgesetzter war, benutzte er bei der Anrede vorsichtshalber den Plural.
«Wen haltet ihr denn für den brauchbarsten Zeugen?»
«Einen Kerl namens Edvardsson», sagte Skacke. «Er saß nur drei Tische weiter. Aber …»
«Was aber?»
«Er ist nicht nüchtern.»
«Alkohol ist ein Fluch», bemerkte Backlund.
«Okay, dann warten wir mit ihm bis morgen», sagte Månsson. «Wer kann mich ins Präsidium fahren?»
«Ich», antwortete Skacke.
«Ich bleibe hier», beharrte Backlund. «Formal ist dieser Fall ja meiner.»
«Ja, natürlich», sagte Månsson. «Bis dann.»
Im Auto murmelte er:
«Züge und Schiffe …»
«Glaubst du, er ist abgehauen?», fragte Skacke skeptisch.
«Es ist immerhin möglich», erwiderte Månsson. «Wie auch immer, wir müssen jede Menge Leute anrufen, auch wenn wir sie aus dem Bett holen.»
Skacke schielte zu Månsson hinüber, der seinen Zahnstocher gegen einen neuen austauschte. Sie bogen in den Hof des Polizeipräsidiums ein.
«Flugzeuge …», sagte Månsson vor sich hin. «Das kann eine anstrengende Nacht werden.»
Das Polizeipräsidium wirkte um diese Zeit groß und düster und wie ausgestorben. Es war ein imposantes Gebäude, und ihre Schritte hallten einsam auf den breiten Steintreppen.
Månsson war von Natur aus so schwerfällig, wie er hoch gewachsen war. Er verabscheute es, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Außerdem hatte er seine Karriere im Großen und Ganzen hinter sich.
Bei Skacke war es genau umgekehrt: Er war zwanzig Jahre jünger, machte sich viele Gedanken über seine Karriere und war eifrig und ehrgeizig. Seine bisherigen Erfahrungen als Polizist hatten ihn aber auch vorsichtig werden lassen. Deshalb war er eifrig darum bemüht, alles richtig zu machen.
Im Grunde ergänzten sie sich also ziemlich gut.
In seinem Büro öffnete Månsson sofort die Fenster, die auf den asphaltierten Hof des Präsidiums hinausgingen. Anschließend sank er auf seinen Drehstuhl und schwieg mehrere Minuten lang, während er nachdenklich an der Walze seiner alten Underwood herumdrehte. Schließlich sagte er:
«Kümmere dich drum, dass uns keine Funksprüche und eventuellen Gespräche durch die Lappen gehen. Leite sie am besten auf dein Telefon um.»
Skacke hatte ein Zimmer direkt gegenüber von Månsson auf der anderen Seite des Flurs.
«Du kannst die Türen offen lassen», sagte Månsson. Und ein paar Sekunden darauf fügte er mit sanfter Ironie hinzu:
«Auf diese Weise bilden wir quasi eine Fahndungszentrale.»
Skacke ging in sein Büro und begann zu telefonieren. Nach einer Weile kam Månsson zu ihm herüber. Er lehnte sich, den Zahnstocher im Mundwinkel, mit der Schulter an den Türpfosten.
«Hast du dir Gedanken gemacht, Benny?», fragte er.
«Nicht sehr viele», antwortete Skacke vorsichtig. «Es kommt einem irgendwie unbegreiflich vor.»
«Unbegreiflich, das ist das richtige Wort», sagte Månsson.
«Was für ein Motiv steckt beispielsweise dahinter?»
«Ich denke, auf das Motiv können wir vorläufig erst einmal pfeifen, wir sollten uns auf den Ablauf konzentrieren.»
Das Telefon klingelte. Skacke machte sich eine Notiz.
«Der Mann, der auf Palmgren geschossen hat, hatte nur eine geringe Chance, ungehindert aus dem Speisesaal des Hotels zu entkommen. Seine Vorgehensweise bis zu dem Augenblick, in dem der Schuss abgefeuert wurde, lässt auf Fanatismus schließen.»
«Wie etwa bei einem politischen Attentat?»
«Genau. Aber hinterher? Was passiert? Wie durch ein Wunder entwischt er und handelt nicht mehr wie ein Fanatiker, sondern gerät in Panik.»
«Ist das der Grund, weshalb du annimmst, dass er versucht, die Stadt zu verlassen?»
«Unter anderem. Er geht hinein und schießt, ohne an die Konsequenzen zu denken. Aber dann befällt ihn wie die meisten Gewalttäter Panik. Er bekommt schlicht Angst und will nur noch weg, und zwar so weit und schnell wie möglich.»
Das ist eine Theorie, dachte Skacke. Noch dazu eine auf ziemlich tönernen Füßen.
Aber er sagte nichts.
«Das ist selbstverständlich nur eine sogenannte Theorie», sagte Månsson. «Ein guter Kriminaler sollte sich nicht mit Theorien abgeben. Aber ich sehe im Moment einfach keine andere Möglichkeit, wie wir in diesem Fall vorgehen können.»
Das Telefon klingelte.
Fall, dachte Månsson. Schon ein verdammt merkwürdiger Fall.
Und eigentlich hatte er frei.
Es wurde insofern eine harte Nacht, als eigentlich nichts passierte. Auf den Ausfallstraßen und auf dem Hauptbahnhof wurden ein paar Leute abgefangen, die in etwa der Personenbeschreibung entsprachen. Niemand von ihnen schien jedoch etwas mit dem Fall zu tun zu haben, trotzdem wurden ihre Namen aufgeschrieben.
Um zwanzig vor eins verließ der letzte Zug den Hauptbahnhof.
Um Viertel vor zwei meldete die Polizei in Lund, dass Palmgren am Leben sei.
Um drei kam die Meldung, Frau Palmgren stehe unter Schock und es sei schwierig, sie überhaupt zu vernehmen. Sie habe den Schützen jedoch deutlich gesehen und sei sich sicher, ihn nicht zu kennen.
«Scheint auf Zack zu sein, dieser Kerl in Lund», sagte Månsson und gähnte.
Kurz nach vier meldete sich die Polizei in Lund erneut. Das Ärzteteam, das Palmgren behandelte, habe beschlossen, ihn vorläufig nicht zu operieren. Die Kugel sei hinter dem linken Ohr eingedrungen und es lasse sich unmöglich sagen, welche Verletzungen dadurch entstanden seien. Der Allgemeinzustand des Patienten sei den Umständen entsprechend gut.
Das konnte man von Månsson nicht gerade behaupten. Er war müde und hatte einen völlig ausgetrockneten Hals, immer wieder ging er zur Toilette, um gierig große Schlucke Wasser zu trinken.
«Kann man mit einer Kugel im Kopf leben?», fragte Skacke.
«Ja», antwortete Månsson. «Es gibt Beispiele dafür. In manchen Fällen wird sie vom Gewebe eingekapselt, und der Patient wird gesund. Wenn die Ärzte dagegen versucht hätten, sie zu entfernen, wäre er vielleicht gestorben.»
Backlund schien sich im Savoy festgebissen zu haben, denn um halb fünf rief er an und sagte, er habe einen bestimmten Bereich absperren und versiegeln lassen. Er gehe davon aus, dass die Spurensicherung den Tatort untersuchen werde, allerdings frühestens in ein paar Stunden.
«Er fragt, ob er hier gebraucht wird», sagte Skacke und legte die Hand auf die Sprechmuschel.
«Der einzige Ort, wo er hoffentlich gebraucht wird, ist zu Hause im Bett bei seiner Frau», sagte Månsson, was Skacke in etwas abgewandelter Form weiterleitete.
Kurz darauf bemerkte Skacke:
«Ich gehe davon aus, dass wir Bulltofta streichen können. Die letzte Maschine ist dort um fünf nach elf gestartet. An Bord war niemand, der der Personenbeschreibung entsprach. Die nächste geht um halb sieben und ist seit vorgestern ausgebucht, auf der Warteliste steht niemand.»
Daran hatte Månsson eine Weile zu knacken.
«Hm», machte er schließlich. «Ich glaube, ich werde jetzt jemanden anrufen, der definitiv etwas dagegen hat, geweckt zu werden.»
«Wen? Den Polizeipräsidenten?»
«Nein, der hat sicher nicht viel mehr geschlafen als wir. Wo hast du übrigens gestern Abend gesteckt?»
«Im Kino», sagte Skacke. «Man kann schließlich nicht jeden Abend auf seiner Bude hocken und büffeln.»
«Ich habe nie auf meiner Bude gehockt und gebüffelt», erklärte Månsson. «Um halb neun ist eines dieser Tragflügelboote von Malmö nach Kopenhagen gefahren. Versuch mal herauszufinden, welches.»
Wie sich herausstellte, war das kein leichtes Unterfangen, und es dauerte eine halbe Stunde, bis Skacke sagen konnte:
«Es heißt Springeren und liegt jetzt in Kopenhagen. Unglaublich, wie sauer manche Leute reagieren, wenn man sie aus dem Bett klingelt.»
«Tröste dich, mir steht jetzt Schlimmeres bevor», sagte Månsson. Er ging in sein Büro hinüber, griff zum Hörer, wählte null, null, neun, vier, fünf und anschließend die Privatnummer des Polizeikommissars Mogensen von der Kriminalpolizei in Kopenhagen. Es klingelte siebzehnmal, bis sich eine schlaftrunkene Stimme meldete:
«Mogensen.»
«Hallo, hier ist Per Månsson aus Malmö.»
«Mensch, leck mich am Arsch!», sagte Mogensen. «Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist?»
«Ja. Aber die Sache könnte wichtig sein», erwiderte Månsson in einem Mischmasch aus Dänisch und Schwedisch.
«Die muss dann aber von verdammt entscheidender Bedeutung sein», versetzte der Däne drohend.
«Hier in Malmö wurde gestern Abend ein Attentat verübt», erklärte Månsson. «Es besteht die Möglichkeit, dass der Täter nach Kopenhagen geflohen ist. Wir haben eine Personenbeschreibung.»
Dann erzählte er ihm, was er wusste, und Mogensen fragte mürrisch:
«Scheiße, glaubst du vielleicht, ich kann Wunder vollbringen?»
«Genau», antwortete Månsson. «Melde dich bitte, wenn was ist.»
«Scher dich zum Teufel!», sagte Mogensen in ungewöhnlich einwandfreiem Schwedisch und schmiss den Hörer auf die Gabel.
Månsson schüttelte sich und gähnte.
«Was für eine Sprache hast du da gesprochen?», fragte Skacke neugierig.
«Skandinavisch», erklärte Månsson.
Dann passierte erst einmal gar nichts.
Schließlich rief Backlund an und teilte mit, die Untersuchung des Tatorts sei eingeleitet. Da war es acht Uhr.
«Mein Gott, ist der in Hochform!», sagte Månsson.
«Was machen wir jetzt?», fragte Skacke.
«Nichts. Warten.»
Um zwanzig vor neun klingelte es auf Månssons privater Leitung. Er nahm den Hörer ab, hörte ungefähr eine Minute zu, beendete das Gespräch, ohne sich zu bedanken oder zu verabschieden, und rief zu Skacke hinüber:
«Ruf Stockholm an. Jetzt gleich.»
«Was soll ich sagen?»
Månsson schaute auf die Uhr.
«Mogensen hat soeben angerufen. Ein Schwede, der sich Bengt Stensson nennt, hat heute Nacht ein Ticket von Kastrup nach Stockholm gekauft und dann mehrere Stunden auf einen Stand-by-Flug gewartet. Schließlich hat er einen Platz in einer SAS-Maschine bekommen, die um fünf vor halb acht gestartet ist. Diese Maschine müsste vor höchstens zehn Minuten in Arlanda gelandet sein. Die Personenbeschreibung scheint auf den Kerl zu passen. Ich möchte, dass der Bus vom Flughafen in die Stadt am Terminal aufgehalten und dieser Mann festgenommen wird.»
Skacke stürzte zu seinem Telefon.
Eine halbe Minute später sagte er atemlos: «Ja, Stockholm wird die Sache übernehmen.»
«Mit wem hast du gesprochen?»
«Gunvald Larsson.»
«Aha, mit dem.»
Sie warteten.
Nach einer halben Stunde klingelte Skackes Telefon. Er riss den Hörer hoch, lauschte und blieb mit dem Hörer in der Hand sitzen.
«Die Sache ist geplatzt.»
«Aha», sagte Månsson lakonisch.