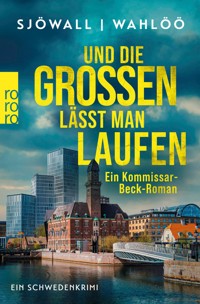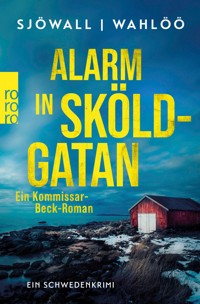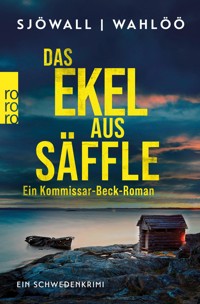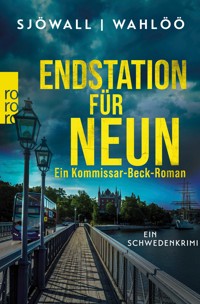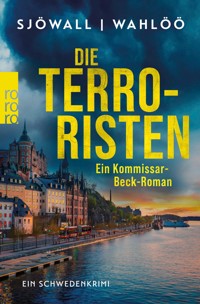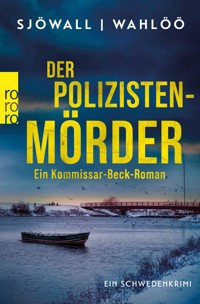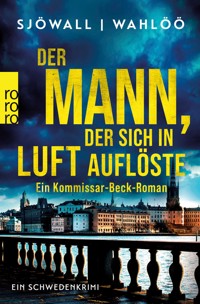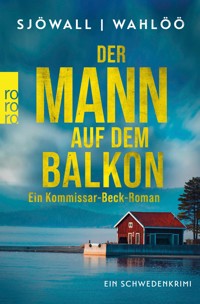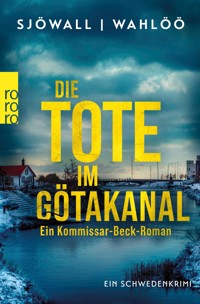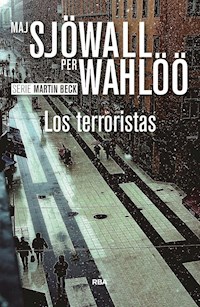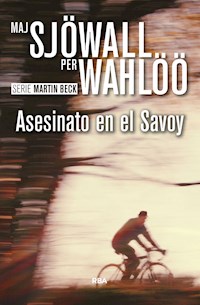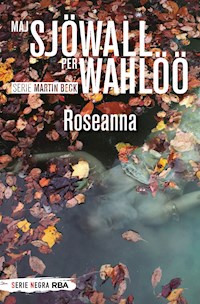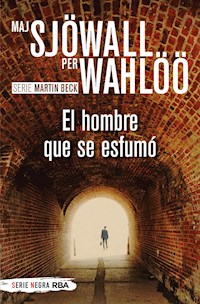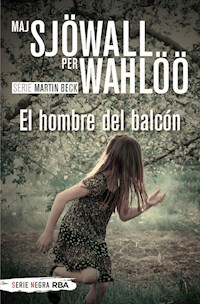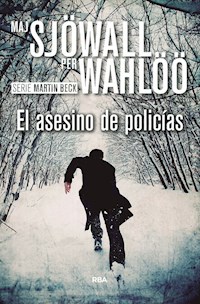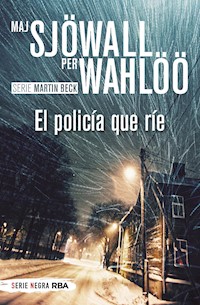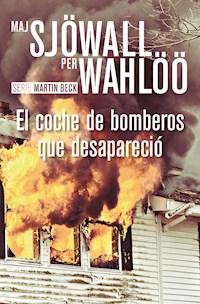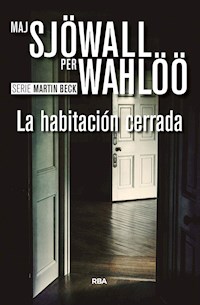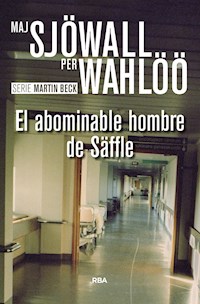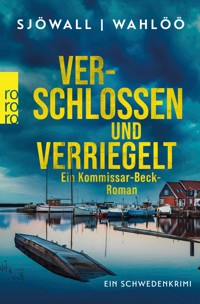
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martin Beck ermittelt
- Sprache: Deutsch
Band 8: Verschlossen und verriegelt? Das Verbrechen findet immer einen Weg 15 Monate nach einer schweren Schussverletzung kehrt Martin Beck lustlos in den Polizeidienst zurück. Er hat viel Zeit gehabt, über sein Leben und die Arbeit nachzudenken – und muss jetzt feststellen, dass er mit beidem unzufrieden ist. Um ihn zu schonen, betraut man Kommissar Beck mit einem scheinbar eindeutigen Fall: Ein Frührentner hat sich erschossen. Doch in der Wohnung des Toten findet sich keine Waffe. Hat der Mann nach dem Schuss noch Gelegenheit gefunden, die Waffe zu beseitigen? Oder war es die Tat eines anderen? Aber wie soll ein Mörder die von innen verschlossene und verriegelte Wohnung verlassen haben? Dies ist der achte Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Håkan Nesser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maj Sjöwall • Per Wahlöö
Verschlossen und verriegelt
Ein Kommissar-Beck-Roman
In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Håkan Nesser
Über dieses Buch
Verschlossen und verriegelt? Das Verbrechen findet immer einen Weg
15 Monate nach einer schweren Schussverletzung kehrt Martin Beck lustlos in den Polizeidienst zurück. Er hat viel Zeit gehabt, über sein Leben und die Arbeit nachzudenken – und muss jetzt feststellen, dass er mit beidem unzufrieden ist. Um ihn zu schonen, betraut man Kommissar Beck mit einem scheinbar eindeutigen Fall: Ein Frührentner hat sich erschossen. Doch in der Wohnung des Toten findet sich keine Waffe. Hat der Mann nach dem Schuss noch Gelegenheit gefunden, die Waffe zu beseitigen? Oder war es die Tat eines anderen? Aber wie soll ein Mörder die von innen verschlossene und verriegelte Wohnung verlassen haben?
Dies ist der achte Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Håkan Nesser.
Vita
Das schwedische Autorenduo Maj Sjöwall und Per Wahlöö schrieb einen Zyklus von zehn Kriminalromanen um Kommissar Martin Beck, die zu einem einzigartigen Welterfolg wurden. Mit ihrer Mischung aus Gesellschaftskritik, Spannung und Unterhaltung haben Sjöwall/Wahlöö die Spannungsliteratur revolutioniert und eine ganze Generation von Krimiautoren geprägt. Sie gelten als Eltern des skandinavischen Kriminalromans und sind erklärte Vorbilder von Autoren wie Henning Mankell und Håkan Nesser. Die zehn Bände der Kommissar-Beck-Reihe sind in 35 Sprachen übersetzt worden und erreichten bisher eine Gesamtauflage von über 10 Millionen Exemplaren. Alle Romane wurden außerdem sehr erfolgreich fürs Fernsehen verfilmt.
Maj Sjöwall, 1935 in Stockholm geboren, studierte Graphik und Journalismus und arbeitete für verschiedene Zeitschriften. Mit ihrem Mann Per Wahlöö schrieb sie die erfolgreiche Krimiserie um Kommissar Martin Beck, die auch verfilmt wurde. 1996 erhielt Sjöwall für die erste Serienverfilmung von Kommissar Beck den Adolf-Grimme-Preis (zusammen mit Gösta Ekmann). Zuletzt arbeitete Maj Sjöwall als Übersetzerin in Stockholm, wo sie im April 2020 verstarb.
Per Wahlöö, 1926 im schwedischen Lund geboren, machte nach dem Studium der Geschichte als Journalist Karriere. In den Fünfzigerjahren ging er nach Spanien und wurde 1956 vom Franco-Regime ausgewiesen. Nach verschiedenen Reisen um die halbe Welt ließ er sich wieder in Schweden nieder und arbeitete dort als Schriftsteller. Per Wahlöö starb 1975 in seiner Heimatstadt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1972 unter dem Titel «Det slutna rummet» bei P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2025
Copyright © 1975, 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Det slutna rummet» Copyright © 1972 by Maj Sjöwall und Per Wahlöö
Redaktion Dagmar Lendt
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-02292-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Håkan Nesser
Es ist eine etwas seltsame Erfahrung, Maj Sjöwalls und Per Wahlöös Verschlossen und verriegelt nach vierunddreißig Jahren wieder zu lesen.
Damals – 1972 – war ich ein glühender Anhänger der politischen Linken und des Autorenteams Sjöwall/Wahlöö. Trotz ständiger Geldsorgen war es für mich undenkbar, auf die Taschenbuchausgabe eines neuen Martin-Beck-Romans zu warten, ich musste die gebundene Ausgabe haben. Ich weiß noch, dass ich Verschlossen und verriegelt in der ersten Woche nach Erscheinen in der Buchhandlung Lundequist in Uppsala kaufte. Ich las und las, genoss in vollen Zügen und reichte das Buch an den Nächsten in unserer Wohngemeinschaft weiter. Mein Exemplar wurde im ersten Monat bestimmt von zehn Personen gelesen. Die Leute standen gleichsam Schlange.
Und alle liebten den Roman; wenn man wie ich jetzt zurückblickt, fällt einem auf, dass auch Menschen, die politisch nicht sonderlich links standen, das Buch toll fanden.
Letzteres sagt so einiges darüber, wie sehr sich die Tonlage und die Ausgangspunkte der gesellschaftlichen Diskussion im Laufe der letzten dreieinhalb Jahrzehnte verschoben haben. Junge Konservative würden heutzutage nie und nimmer Verschlossen und verriegelt verschlingen. Sie würden Ausschlag bekommen. Allerdings gab es, wenn ich es recht bedenke, in meinem damaligen Bekanntenkreis auch nicht gerade viele junge Konservative.
Jedenfalls ist es das, was einen beim Wiederlesen aufmerken lässt: die grobschlächtige – zeitweilig parodistisch grobschlächtige – Gesellschaftskritik. Selbsternannte Experten und Krimi-Kenner pflegen zu sagen, dass ihnen die frühen Bücher in der Romanreihe um Martin Beck am besten gefallen; am Ende wird alles zu politisch, fast propagandistisch. Die Botschaft schwächt die Geschichte.
Damit liegen sie sicher nicht ganz falsch. Das letzte Wort im letzten Roman ist Marx, was natürlich kein Zufall ist. Verschlossen und verriegelt ist der achte Band in der Serie und das Buch, in dem Martin Beck in seinen Beruf zurückkehrt, nachdem er bei einer Schießerei auf einem Stockholmer Hausdach fast das Leben verloren hat (in Das Ekel von Säffle, nach dem der Regisseur Bo Widerberg seinen großartigen Film «Der Mann auf dem Dach» gedreht hat – die mit Abstand beste Beck-Verfilmung).
Martin Beck ist nach seiner Rekonvaleszenz besonders düsterer Stimmung. Er findet sich in der Gesellschaft nicht mehr zurecht. Er fühlt sich unwohl in seiner Rolle als Polizist. Er befindet sich in seinem eigenen verschlossenen und verriegelten Raum, aus dem er sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien kann – es gibt nur einen Weg hinaus: eine Frau. Schließlich taucht sie auch auf. Ihr Name ist Rhea Nielsen, und mit ihrer femininen Wärme, ihrer Fürsorglichkeit und Solidarität steht sie für all das, woran es draußen in der Gesellschaft fehlt.
Denn da draußen ist es kalt. Die unverblümte Schilderung eines Schwedens, das auf eine Totalhavarie zusteuert, ist deutlich, wenn nicht überdeutlich. Nichts funktioniert. Beamte sind grundsätzlich korrupt, das Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps, neun von zehn Polizisten sind Idioten, und wenn Martin Beck durch einen Park in Stockholm flaniert, muss er über Alkoholiker und Drogensüchtige steigen, die allerorten herumliegen und auf etwas warten. Vielleicht warten sie auf Pflege, denkt er ironisch. Die Autoren scheuen sich nicht, die Lage im Land selbst zu beschreiben, will sagen, ohne ihre Gedanken einer der Hauptpersonen in den Mund zu legen. Schweden ist auf dem besten Weg, eine Art rechte Diktatur zu werden, behaupten Sjöwall und Wahlöö: Alles geht den Bach runter, und die Bürger, die es nicht geschafft haben, sich das Leben zu nehmen oder auszuwandern, werden zu Sklaven der neuen Machthaber werden. Et cetera. Ja, das Ganze ist so dystopisch, dass es heute – vierunddreißig Jahre später – fast schon ein bisschen komisch wirkt. Man muss mit historischer Brille lesen, obwohl es sich um Gegenwartsgeschichte handelt. Aber so wurde die Debatte damals geführt, so grobes Geschütz fuhr man auf, so deutlich war die Trennlinie zwischen rechts und links. Und paradoxerweise gehört gerade das heute zu den Stärken des Romans: sich daran erinnern zu dürfen, wie es damals war – und möglicherweise diese schwerere Artillerie in der lauen Mitte des Marktes, in der wir mittlerweile gelandet sind, vermissen zu dürfen. Wenn man links wählte, war man damals Kommunist. Kein Zweifel, man wollte eine andere Gesellschaft.
Aber es gibt auch anderes, was Verschlossen und verriegelt heute noch immer zu einer höchst unterhaltsamen Lektüre macht. Die Komposition – die Story – ist glänzend; alles, was die Polizei anpackt, geht zur Hölle, aber es ist eine ausgesprochen vergnügliche Höllenfahrt. Es gibt diverse Höhepunkte, zum Beispiel die Erstürmung einer Wohnung auf Danviksklippan, ein Slapstick-Klassiker, den man immer wieder lesen kann. Und obwohl die Arbeit der Polizei von fast hundertprozentiger Inkompetenz geprägt ist, wendet sich am Ende in gewisser Weise doch alles zum Guten. Der arme Schurke Mauritzon bekommt, was er verdient, obwohl die Polizei (mit Ausnahme Martin Becks) praktisch alles falsch verstanden hat. Das Porträt des Irren und Staatsanwalts Bulldozer Olsson ist heute noch so lustig wie vor vierunddreißig Jahren, der Unterschied ist allenfalls, dass man sein Porträt damals psychologisch einigermaßen glaubwürdig fand. Doch wer weiß, wer heute Leif G. W. Perssons Polizeiromane liest oder ihm zuhört, gewinnt eher nicht den Eindruck, dass sich die Dinge in der Zwischenzeit gebessert haben. Die schwedische Polizei besteht zu einem Großteil aus Idioten, je höher in der Hierarchie, desto größere – und desto gefährlichere.
Man fragt sich, wie manche Dinge trotzdem funktionieren können. Vielleicht ist es wie in Verschlossen und verriegelt. Die Missgeschicke heben einander auf, und aus zweimal minus wird manchmal plus.
Außerdem gibt es Ausnahmen. Es gibt gute Polizisten, Beck und Kollberg, Rönn und Gunvald Larsson – jeder von ihnen ist auf seine Art ein moralisch denkendes Individuum. Obwohl die Zeiten finsterer werden, machen sie weiter ihren Job, bekämpfen sie weiter alle möglichen Spielarten des Bösen – wenn es in Verschlossen und verriegelt so etwas wie Hoffnung gibt, dann in Gestalt dieser einzelnen Polizisten.
Aber richtig positiv wird es nie. Früher war es auch nicht besser.
Verschlossen und verriegelt
1
Die Glocken der Mariakirche schlugen zwei, als sie aus der U-Bahn-Station in der Wollmar Yxkullsgatan kam. Sie blieb stehen und zündete sich eine Zigarette an, ehe sie mit schnellen Schritten zum Mariatorget ging.
Der Klang der Kirchenglocken hing wabernd in der Luft und erinnerte sie an die düsteren Sonntage ihrer Kindheit. Sie war nur wenige Häuserblocks von der Mariakirche entfernt geboren und aufgewachsen, in ihr war sie getauft und vor fast zwölf Jahren konfirmiert worden. Von der Feier und dem Konfirmationsunterricht war ihr nur im Gedächtnis geblieben, dass sie den Pfarrer gefragt hatte, was Strindberg meinte, als er vom «milzsüchtigen Diskant» der Marienglocken schrieb, aber an seine Antwort konnte sie sich nicht mehr erinnern.
Die Sonne brannte ihr im Rücken, und als sie die Sankt Paulsgatan überquert hatte, verlangsamte sie ihre Schritte, um nicht ins Schwitzen zu geraten. Plötzlich spürte sie, wie nervös sie in Wirklichkeit war, und bereute, keine Beruhigungstablette genommen zu haben, bevor sie das Haus verließ.
Als sie den Springbrunnen in der Mitte des Platzes erreichte, tauchte sie ihr Taschentuch ins kalte Wasser, wischte sich mit dem nassen Tuch hastig über das Gesicht, putzte ihre Sonnenbrille mit einem Zipfel der hellblauen Bluse und setzte sie wieder auf. Die Brille hatte große, spiegelnde Gläser und verbarg den oberen Teil ihres Gesichts. Dann nahm sie ihren breitkrempigen blauen Denimhut ab, hob die glatten blonden Haare an, die so lang waren, dass sie die Schultern der Bluse berührten, und wischte sich den Schweiß aus dem Nacken. Sie setzte den Hut wieder auf, zog ihn in die Stirn und nahm, das Taschentuch in der Hand zu einem Ball zusammengeknüllt, auf einer Bank Platz.
Kurz darauf breitete sie das Taschentuch neben sich auf der Bank aus und wischte ihre Handflächen an der Jeans trocken. Sie schaute auf ihre Armbanduhr, auf der es zwölf Minuten nach zwei war, und gab sich drei Minuten, um sich zu beruhigen, ehe sie weitergehen musste.
Als es Viertel nach schlug, öffnete sie die Klappe der dunkelgrünen Umhängetasche aus Segeltuch auf ihrem Schoß, griff nach dem Taschentuch, das mittlerweile knochentrocken war, und ließ es in die Tasche fallen, ohne es zusammenzufalten. Anschließend stand sie auf, schob sich den Riemen aus Sattelgurt über die rechte Schulter und ging los.
Während sie sich der Hornsgatan näherte, legte sich ihre Nervosität ein wenig, und sie redete sich ein, dass alles gutgehen würde.
Es war ein Freitag, der letzte Tag im Juni, und für viele hatte gerade der Urlaub begonnen. Auf der Hornsgatan herrschte reger Verkehr, auf der Fahrbahn ebenso wie auf den Bürgersteigen. Nachdem sie den Platz überquert hatte, wandte sie sich nach links und gelangte in den Schatten der Häuser.
Sie hoffte, dass sie das Richtige getan hatte, als sie sich für diesen Tag entschied. Sie hatte die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen und war sich bewusst, dass sie das Projekt eventuell um eine Woche verschieben musste. Das wäre zwar kein größeres Malheur, aber sie wollte sich nur ungern dem nervlichen Druck aussetzen, der durch die Wartezeit entstehen würde.
Sie erreichte ihr Ziel früher als berechnet und blieb auf der schattigen Seite stehen, während sie das große Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtete. Die Sonne spiegelte sich in der blanken Glasfläche, und der dichte Verkehr versperrte ihr zeitweilig die Sicht, aber sie konnte immerhin erkennen, dass die Vorhänge zugezogen waren.
Sie ging langsam auf dem Bürgersteig auf und ab, während sie so tat, als sähe sie sich die Schaufenster an, und obwohl ein Stück die Straße hinunter vor dem Laden eines Uhrmachers eine große Uhr hing, blickte sie immer wieder auf ihre Armbanduhr. Die Tür auf der anderen Straßenseite ließ sie keinen Moment aus den Augen.
Als es fünf vor drei war, ging sie zum Zebrastreifen an der Kreuzung, und vier Minuten später stand sie vor dem Eingang der Bank.
Ehe sie die Tür aufschob und eintrat, klappte sie ihre Tasche auf.
Sie ließ den Blick durch den Raum schweifen, der die Filiale einer großen Bank beherbergte. Er war lang gezogen, und die Eingangstür und das einzige Fenster bildeten die eine der beiden Stirnseiten. Rechter Hand verlief vom Fenster bis zur hinteren Querwand ein Tresen, linker Hand befanden sich vier in der Wand verankerte Schreibpulte und dahinter ein flacher runder Tisch und zwei Hocker, die mit rotkariertem Stoff bezogen waren. Am hinteren Ende des Raums führte eine ziemlich steile Treppe, die hinter einer Biegung verschwand, vermutlich zum Tresorraum und den Bankfächern hinab.
Außer ihr hielt sich nur ein Kunde in der Filiale auf, ein Mann, der am Schalter stand und Geldscheine und Papiere in seiner Aktentasche verstaute.
Hinter dem Tresen saßen zwei weibliche Angestellte, und weiter hinten stand ein Mann und blätterte in einer Kartei.
Sie ging zu einem der Schreibpulte und kramte aus dem Außenfach ihrer Tasche einen Stift hervor, während sie aus den Augenwinkeln beobachtete, wie der Kunde mit der Aktentasche zur Tür hinausging und auf die Straße trat. Sie nahm ein Formular aus dem Ständer und kritzelte darauf herum. Es dauerte nicht lange, bis sie den Filialleiter zur Tür gehen und diese abschließen sah. Anschließend bückte er sich und löste den Haken, der die innere Tür offen hielt, und während sie mit einem leisen Seufzer zufiel, kehrte er an seinen Platz hinter dem Tresen zurück.
Sie zog das Taschentuch heraus, hielt es in der linken Hand und tat, als würde sie sich die Nase putzen, während sie mit dem Formular in der anderen Hand zum Schalter ging.
Als sie den Kassenschalter erreichte, stopfte sie das Formular in die Tasche, holte den Nylonbeutel heraus, legte ihn auf den Tresen, nahm die Pistole, richtete sie auf die Kassiererin und sagte mit dem Taschentuch vor dem Mund:
«Das ist ein Überfall. Die Pistole ist geladen, und ich schieße, wenn Sie Ärger machen. Packen Sie alles Geld in den Beutel.»
Die Frau hinter dem Tresen starrte sie an, griff langsam nach dem Nylonbeutel und legte ihn vor sich hin. Die andere Frau, die sich sitzend die Haare kämmte, hielt mitten in der Bewegung inne und ließ langsam die Hände sinken. Sie öffnete den Mund, als wollte sie etwas sagen, brachte aber keinen Ton heraus. Der Mann, der immer noch hinter seinem Schreibtisch stand, machte eine heftige Bewegung, worauf sie sofort die Pistole auf ihn richtete und schrie:
«Stillgestanden! Und halten Sie die Hände so, dass ich sie sehen kann.»
Sie wedelte mit dem Pistolenlauf ungeduldig in Richtung der offensichtlich wie gelähmten Frau an der Kasse und fuhr fort:
«Beeilen Sie sich mit dem Geld. Alles!»
Die Kassiererin begann, bündelweise Geldscheine in den Beutel zu packen, und legte ihn, als sie fertig war, auf den Tresen. Der Mann am Schreibtisch sagte auf einmal:
«Das schaffen Sie nie. Die Polizei wird …»
«Schnauze», schrie sie.
Dann warf sie das Taschentuch in die offene Umhängetasche und griff nach dem Nylonbeutel, der sich angenehm schwer anfühlte. Sie richtete die Pistole abwechselnd auf die drei Bankangestellten, während sie langsam rückwärts zur Tür ging.
Plötzlich kam jemand von der Treppe am hinteren Ende des Raums auf sie zugerannt. Ein großer blonder Mann in einer weißen, sorgsam gebügelten Hose und einer blauen Clubjacke mit glänzenden Knöpfen und einem großen, goldgestickten Emblem auf der Brusttasche.
Ein lauter Knall erfüllte den ganzen Raum und hallte zwischen den Wänden wider, ihr Arm wurde hochgerissen, und sie sah, wie der Mann mit dem Goldemblem nach hinten geschleudert wurde, und auch, dass seine Schuhe ganz neu und weiß waren und dicke rote, geriffelte Gummisohlen hatten, und erst als sein Kopf mit einem hässlichen, dumpfen Laut auf den Steinfußboden schlug, begriff sie, dass sie ihn erschossen hatte.
Sie warf die Pistole in die Tasche, starrte mit irrem Blick die drei schreckerstarrten Menschen hinter dem Tresen an und rannte zur Tür. Mit fahrigen Bewegungen schloss sie auf und dachte, bevor sie hinaustrat: Ruhig jetzt, ich muss ganz ruhig gehen, aber kaum war sie auf dem Bürgersteig, eilte sie im Laufschritt zur nächsten Querstraße.
Die Menschen um sich herum nahm sie gar nicht wahr, spürte nur, dass sie mehrere Personen anstieß. Der Schuss dröhnte immer noch in ihren Ohren.
Sie bog um die Straßenecke und rannte mit dem Beutel in der Hand und der schweren Tasche, die gegen ihre Hüfte schlug, los. Sie riss die Tür zu dem Haus auf, in dem sie als Kind gewohnt hatte, lief den vertrauten Weg auf den Hinterhof hinaus, wo sie innehielt und dann weiterging. Sie durchquerte den Flur eines Hinterhauses und kam auf einen weiteren Hof. Dort stieg sie die steile Treppe zu einem Keller hinunter und setzte sich auf die unterste Treppenstufe.
Sie versuchte, den Nylonbeutel in der Schultertasche zu verstauen, aber er passte nicht hinein. Sie nahm den Hut, die Brille und die blonde Perücke ab und stopfte alles in die Tasche. Sie hatte dunkle und kurze Haare. Sie knöpfte ihre Bluse auf, zog sie aus und legte sie ebenfalls in die Tasche. Darunter trug sie ein schwarzes Baumwollshirt mit kurzen Ärmeln. Dann hängte sie sich die Tasche über die linke Schulter, nahm den Nylonbeutel und stieg wieder zum Hof hinauf. Sie passierte weitere Türen und mehrere Hinterhöfe und kletterte über zwei Mauern, bis sie schließlich auf einer Straße am anderen Ende des Häuserblocks stand.
In einem Supermarkt kaufte sie zwei Liter Milch, legte die Milchkartons in eine Einkaufstüte und den schwarzen Nylonbeutel obendrauf.
Anschließend ging sie zur Station Slussen und fuhr mit der U-Bahn nach Hause.
2
Gunvald Larsson traf in seinem eigenen, höchst privaten Auto am Tatort ein. Es war ein roter EMW, ein in Schweden ausgesprochen seltenes Fabrikat, und nach Meinung vieler Leute reichlich exklusiv für einen Ersten Kriminalassistenten, vor allem, wenn der den Wagen im Dienst benutzte.
An diesem schönen Freitagnachmittag hatte er es sich gerade hinter dem Lenkrad bequem gemacht, als Einar Rönn auf den Hof des Polizeipräsidiums hinausgerannt kam und seine Pläne für einen ruhigen Abend daheim in Bollmora durchkreuzte. Einar Rönn war ebenfalls Erster Kriminalassistent im Dezernat für Gewaltdelikte und vermutlich der einzige Freund, den Gunvald Larsson hatte, und als er sagte, es tue ihm leid, dass Gunvald Larsson seinen freien Abend opfern müsse, meinte er es tatsächlich so.
Rönn fuhr in einem Dienstwagen zur Hornsgatan, und als er dort eintraf, waren mehrere Streifenwagen und einige Beamte aus dem Polizeibezirk Södermalm vor Ort und Gunvald Larsson bereits in der Bankfiliale.
Vor der Bank hatte sich eine kleine Menschenmenge gebildet, und als Rönn den Bürgersteig überquerte, kam einer der uniformierten Beamten, die herumstanden und die Schaulustigen anstarrten, auf ihn zu und sagte:
«Ich habe hier zwei Zeugen, die sagen, sie hätten den Schuss gehört. Was soll ich mit ihnen machen?»
«Halte sie noch ein bisschen hin», antwortete Rönn. «Und sieh zu, dass du die Gaffer verscheuchst.»
Der Polizist nickte, und Rönn betrat die Bank.
Auf dem Marmorfußboden zwischen dem Tresen und der Reihe von Schreibpulten lag der Tote auf dem Rücken, die Arme vom Körper weggestreckt und das linke Knie angewinkelt. Ein Hosenbein war hochgerutscht und entblößte eine schneeweiße Orlonsocke mit einem dunkelblauen Anker am Strumpfbein sowie einen braungebrannten Unterschenkel, der von glänzenden blonden Haaren bedeckt war. Die Kugel hatte den Mann mitten ins Gesicht getroffen, und Blut und Gehirnsubstanz waren aus dem Hinterkopf geflossen.
Das Bankpersonal war in der hinteren Ecke des Raums versammelt, und vor ihnen saß Gunvald Larsson mit halbem Hintern auf dem Schreibtisch, den Oberschenkel über die Tischecke gelegt. Er notierte sich etwas, während eine der Frauen mit gellender, aufgeregter Stimme sprach.
Als Gunvald Larsson sah, dass Rönn hereinkam, hob er seine rechte, große flache Hand in Richtung der Frau, die augenblicklich mitten im Satz verstummte. Gunvald Larsson stand auf, schlug die Tresenklappe zurück und ging mit dem Notizblock in der Hand zu Rönn. Er nickte zu dem Mann auf dem Fußboden und sagte:
«Kein besonders schöner Anblick. Wenn du hier übernimmst, kann ich die Zeugen woanders hinbringen, vielleicht zur alten Wache 2 in der Rosenlundsgatan. Dann könnt ihr hier in Ruhe arbeiten.»
Rönn nickte.
«Eine Frau soll das angerichtet haben», sagte er. «Das Geld hat sie mitgehen lassen. Hat einer gesehen, in welche Richtung sie verschwunden ist?»
«Von den Bankangestellten jedenfalls keiner», erwiderte Gunvald Larsson. «Draußen hat anscheinend ein Typ gestanden und beobachtet, wie ein Auto weggefahren ist, aber er hat die Nummer nicht gesehen und ist sich auch bei der Automarke nicht sicher, das bringt uns also nicht sonderlich weiter. Ich werde mich später mit ihm unterhalten.»
«Und wer ist das?», fragte Rönn mit einem kurzen Nicken zu dem Toten.
«Irgendein Idiot, der den Helden spielen wollte. Er hat versucht, sich auf die Bankräuberin zu stürzen, worauf sie ihn natürlich vor lauter Schreck erschossen hat. Ein Kunde der Bank, das Personal kennt ihn. Er war unten an seinem Bankfach und kam mittendrin die Treppe dahinten hoch.»
Gunvald Larsson schaute in seinen Notizblock.
«Er war Diplomsportlehrer und hieß Gårdon. Mit å.»
«Vielleicht hat er gedacht, er wäre Flash Gordon», meinte Rönn.
Gunvald Larsson warf ihm einen forschenden Blick zu.
Rönn errötete und sagte ablenkend:
«Jau, in dem Ding da gibt es bestimmt Bilder von der Bankräuberin.»
Er zeigte auf eine Kamera, die unter der Decke hing.
«Vorausgesetzt, sie ist richtig eingestellt und es ist überhaupt ein Film drin», sagte Gunvald Larsson skeptisch. «Und falls die Kassiererin daran gedacht hat, den Knopf zu drücken.»
Die meisten Bankfilialen waren mittlerweile mit Kameras ausgestattet, die zu filmen begannen, sobald der Angestellte an der Kasse auf einen Knopf im Fußboden trat. Das war die einzige Maßnahme, die das Personal im Falle eines Überfalls ergreifen sollte. Seit es immer häufiger zu bewaffneten Banküberfällen kam, hatten die Geldinstitute ihre Angestellten angewiesen, das verlangte Geld auszuhändigen und ansonsten nichts zu unternehmen, um die Täter aufzuhalten oder zu behindern und sich damit in Lebensgefahr zu bringen. Diese Verhaltensregel war nicht, wie man womöglich fälschlicherweise annehmen könnte, aus humanitären Gründen oder Sorge um die Bankangestellten angeordnet worden, sondern basierte auf der Erfahrung, dass es für Banken und Versicherungen billiger war, den Räuber mit seiner Beute entkommen zu lassen, als Schadensersatz und möglicherweise lebenslängliche Unterhaltszahlungen an hinterbliebene Familien zu leisten. Was leicht passieren konnte, falls jemand verletzt oder getötet wurde.
Der Gerichtsmediziner traf ein, und Rönn ging zu seinem Wagen hinaus, um seine Mordfalltasche zu holen. Er benutzte alte Methoden, nicht selten ohne Erfolg. Gunvald Larsson marschierte mit den drei Bankangestellten und weiteren vier Personen, die sich als Zeugen gemeldet hatten, zur alten Polizeiwache in der Rosenlundsgatan.
Er durfte eins der Vernehmungszimmer benutzen, wo er seine Wildlederjacke auszog und über den Stuhlrücken hängte, ehe er mit einer ersten Befragung begann.
Während die Aussagen der drei Bankangestellten praktisch identisch waren, fielen die der vier anderen Zeugen dafür umso unterschiedlicher aus.
Der erste dieser Zeugen war ein zweiundvierzigjähriger Mann, der sich zum Zeitpunkt des Schusses in einem Hauseingang fünf Meter von der Bank entfernt aufhielt. Er hatte eine junge Frau mit schwarzem Hut und Sonnenbrille vorbeihasten sehen, und als er, seinen Worten zufolge, eine halbe Minute später die Straße hinabblickte, war ihm in fünfzehn Metern Entfernung ein grüner Pkw aufgefallen, vermutlich ein Opel, der mit einem Kavalierstart vom Bürgersteig auf die Straße ausscherte. Das Auto entfernte sich schnell Richtung Hornsplan, und er meinte gesehen zu haben, dass die junge Frau mit dem Hut auf dem Rücksitz saß. Das Kennzeichen des Wagens hatte er nicht entziffern können, glaubte aber, die Kennung AB für den Regierungsbezirk Stockholm erkannt zu haben.
Die nächste Zeugin war Besitzerin eines Ladens, der Wand an Wand mit der Bankfiliale lag, und hatte in der offenen Tür ihres Geschäfts gestanden, als sie einen Knall hörte. Sie war zunächst davon ausgegangen, dass das Geräusch aus der Kochnische hinter ihrem Verkaufsraum kam, und war in dem Glauben, ihr Gasherd wäre explodiert, dorthin geeilt. Als sie merkte, dass sie sich geirrt hatte, war sie zur Tür zurückgekehrt und hatte auf die Straße hinausgesehen, wo gerade ein großes blaues Auto mit quietschenden Reifen davonraste. Im selben Moment war eine Frau aus der Bank gekommen und hatte geschrien, es sei jemand erschossen worden. Die Ladenbesitzerin hatte nicht gesehen, wer in dem Wagen saß oder welches Kennzeichen er hatte, und sie kannte sich auch mit Automarken nicht aus, fand aber, dass er einem Taxi ähnelte.
Der dritte Zeuge war ein zweiunddreißigjähriger Metallarbeiter, der einen detaillierteren Bericht abgab. Den Schuss hatte er nicht gehört, jedenfalls nicht bewusst. Er war den Bürgersteig entlanggegangen, als die junge Frau aus der Bank kam. Sie hatte es eilig gehabt und ihn im Vorbeigehen angerempelt. Er hatte zwar ihr Gesicht nicht gesehen, schätzte ihr Alter jedoch auf circa dreißig Jahre. Sie war mit einer blauen Hose und einem Hemd bekleidet, hatte einen Hut auf dem Kopf und trug einen dunklen Beutel in der Hand. Er hatte gesehen, wie sie zu einem Auto mit der Kennung A für Stockholm-Stadt und zwei Dreien auf dem Nummernschild ging. Der Wagen war ein hellbeigefarbener Renault 16 gewesen. Ein schlanker Mann, schätzungsweise zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre alt, hatte am Steuer gesessen. Er hatte lange, strähnige schwarze Haare, trug ein kurzärmliges weißes Baumwollshirt und war auffallend blass. Ein zweiter, etwas älter wirkender Mann hatte auf dem Bürgersteig gestanden und der jungen Frau die hintere Wagentür aufgehalten. Sobald er hinter ihr die Tür geschlossen hatte, war er auf der Beifahrerseite eingestiegen. Dieser Mann war von kräftiger Statur, etwa eins achtzig groß und hatte aschblondes, krauses und sehr volles Haar. Sein Gesicht war krebsrot. Er hatte eine schwarze Hose mit weiten Beinen und ein schwarzes Hemd aus einem glänzenden Material an. Das Auto war auf die Gegenfahrbahn gebogen und Richtung Slussen davongefahren.
Nach diesen Zeugenaussagen war Gunvald Larsson ein wenig verwirrt und las sich durch, was er notiert hatte, ehe er den letzten Zeugen hereinrief.
Dieser stellte sich als ein fünfzigjähriger Uhrmacher heraus, der direkt vor der Bank in seinem Auto gesessen und gewartet hatte, während sich seine Frau in einem Schuhgeschäft auf der anderen Straßenseite aufhielt. Das Seitenfenster war heruntergekurbelt gewesen, und er hatte den Schuss gehört, ohne zu reagieren, da man auf einer derart stark befahrenen Straße wie der Hornsgatan so viele Geräusche hörte. Es war fünf Minuten nach drei gewesen, als er die Frau aus der Bank kommen sah. Sie war ihm aufgefallen, weil sie es so eilig zu haben schien, dass sie sich nicht einmal die Zeit nahm, sich zu entschuldigen, als sie eine alte Dame anrempelte, und er hatte gedacht, dass dies ganz typisch für Stockholmer war, so gehetzt und unfreundlich zu sein. Er selbst stammte aus Södertälje. Die Frau hatte eine lange Hose getragen und etwas auf dem Kopf gehabt, das ihn an einen Cowboyhut erinnerte, und sie hatte einen schwarzen Beutel in der Hand gehalten. Sie war zur nächsten Querstraße gelaufen und um die Ecke verschwunden. Nein, sie war in kein Auto gestiegen und auch nicht unterwegs stehengeblieben, sondern schnurstracks zur Straßenecke gegangen und verschwunden.
Gunvald Larsson malte einen Kringel um die Personenbeschreibungen der beiden Männer in dem Renault, stand auf, sammelte seine Papiere ein und warf einen Blick auf die Uhr. Es war inzwischen bereits sechs.
Vermutlich hatte er sich unnötig viel Arbeit gemacht.
Das Aussehen der verschiedenen Autos war zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt schon von den Polizisten gemeldet worden, die als Erste am Tatort eingetroffen waren.
Außerdem ergab sich aus den Zeugenaussagen kein eindeutiges Bild.
Natürlich war wie immer alles gründlich schiefgegangen.
Er dachte einen Augenblick darüber nach, ob er seinen besten Zeugen eventuell noch dabehalten sollte, verwarf den Gedanken jedoch. Allen schien daran gelegen zu sein, möglichst schnell nach Hause zu kommen.
Ehrlich gesagt, lag ihm selbst wohl am meisten daran.
Obwohl das aller Wahrscheinlichkeit nach eine vergebliche Hoffnung war.
Also ließ er die Leute gehen.
Er zog seine Jacke an und kehrte zur Bank zurück.
Die sterblichen Überreste des tapferen Sportlehrers waren fortgeschafft worden, und ein junger Streifenpolizist stieg aus seinem Wagen und teilte mit, der Erste Kriminalassistent Rönn erwarte den Ersten Kriminalassistenten Larsson in seinem Büro.
Gunvald Larsson seufzte und ging zu seinem Wagen.
3
Er erwachte und wunderte sich, dass er lebte.
Das war nichts Neues. Seit exakt fünfzehn Monaten hatte er die Augen Tag für Tag mit der gleichen verwirrten Frage im Kopf aufgeschlagen.
Wie ist es möglich, dass ich lebe?
Und unmittelbar darauf:
Warum?
Kurz vor dem Aufwachen hatte er einen Traum. Auch der war fünfzehn Monate alt.
Er veränderte sich zwar laufend, folgte jedoch stets einem bestimmten Muster.
Er ritt. Im Galopp, vorgebeugt, und kalter Wind zerrte an seinen Haaren.
Dann lief er den Bahnsteig in einem Bahnhof entlang. Vor ihm war ein Mann, der eine Pistole hob. Er wusste, wer dieser Mann war und was passieren würde. Der Mann war Charles J. Guiteau und die Waffe eine Sportpistole der Marke Hämmerli International.
Wenn der Mann schoss, warf er selbst sich im gleichen Moment nach vorn und fing die Kugel mit seinem Körper ab. Der Schuss traf ihn mit der Wucht eines Vorschlaghammers mitten in die Brust. Er hatte sich ganz offensichtlich geopfert, nahm jedoch gleichzeitig wahr, dass seine Tat vergebens gewesen war. Der Präsident lag bereits zusammengesackt auf der Erde, der glänzende Zylinder war ihm vom Kopf gefallen und beschrieb rollend einen Halbkreis.
Wie immer wachte er auf, sobald die Kugel ihn traf. Erst wurde alles schwarz, und eine Woge sengender Hitze rollte durch sein Gehirn, dann öffnete er die Augen.
Martin Beck lag regungslos im Bett und starrte an die Decke. Es war hell im Zimmer.
Er dachte an den Traum. Er erschien ihm nicht besonders sinnvoll, zumindest nicht in dieser Version.
Außerdem war er voller Ungereimtheiten. Zum Beispiel das mit der Waffe; es hätte ein Revolver oder eventuell auch eine Derringer sein sollen. Und wie konnte Garfield dort liegen, tödlich verletzt, wenn die Kugel nachweislich ihn selbst in die Brust getroffen hatte?
Er wusste nicht, wie der Mörder wirklich aussah. Falls er jemals ein Bild des Mannes gesehen hatte, war die Erinnerung daran vor langer Zeit ausradiert worden. Meistens hatte Guiteau blaue Augen, einen blonden Schnäuzer und glatte, schräg zurückgekämmte Haare, aber heute hatte er eher einem Schauspieler in einer altvertrauten Rolle geähnelt.
Schlagartig fiel ihm ein, welche: John Carradine als der Spieler in «Stagecoach». Das Ganze war verblüffend romantisch.
Eine Kugel in der Brust kann allerdings leicht zu etwas höchst Unpoetischem werden. Das wusste er aus eigener Erfahrung. Wenn sie den rechten Lungenflügel durchschlägt und anschließend in der Nähe der Wirbelsäule stecken bleibt, ist das Ergebnis zeitweise schmerzhaft und auf Dauer ausgesprochen langweilig.
Aber es gab in dem Traum auch vieles, was mit seiner Wirklichkeit übereinstimmte. Zum Beispiel die Sportpistole. Sie hatte einem entlassenen Polizeibeamten mit blauen Augen, blondem Schnäuzer und schräg zurückgekämmten Haaren gehört. Sie waren sich unter einem kühlen Spätwinterhimmel auf einem Hausdach begegnet. Andere Argumente als ein einzelner Pistolenschuss waren nicht ausgetauscht worden.
Am selben Abend war er in einem Zimmer mit weißen Wänden erwacht, genauer gesagt in der Thoraxklinik des Karolinska-Krankenhauses. Man hatte ihm gesagt, seine Verletzung sei nicht lebensbedrohlich, aber er hatte sich trotzdem gefragt, wie es möglich war, dass er noch lebte.
Später hatte man ihm gesagt, die Verletzung sei nicht mehr lebensbedrohlich, die Kugel sitze allerdings ein wenig ungünstig. Er hatte die Finesse an dem kleinen Zusatz, dem Wörtchen mehr erkannt, sie jedoch nicht zu schätzen gewusst. Die Chirurgen hatten wochenlang die Röntgenaufnahmen studiert, ehe sie den Fremdkörper entfernten. Anschließend hatten sie erklärt, die Verletzung sei nun definitiv nicht mehr lebensbedrohlich. Im Gegenteil, er werde wieder völlig gesund werden, vorausgesetzt, dass er sich sehr schone. Aber zu der Zeit hatte er bereits aufgehört, ihnen zu glauben.
Er hatte sich allerdings sehr geschont. Eine Alternative hatte es im Grunde auch gar nicht gegeben.
Nun hieß es, er sei völlig geheilt. Es gab jedoch auch diesmal einen Zusatz: körperlich.
Außerdem sollte er das Rauchen aufgeben. Seine Luftröhre war nie wirklich gesund gewesen, und ein Lungendurchschuss hatte die Sache nicht besser gemacht. Nach dem Verheilen waren um die Narbe seltsame Flecken aufgetaucht.
Martin Beck stand auf.
Er ging durchs Wohnzimmer in den Flur hinaus und holte die Zeitung, die auf der Türmatte lag, setzte seinen Weg in die Küche fort, während er die Schlagzeilen auf der ersten Seite überflog. Es war schönes Wetter, und so sollte es den Meteorologen zufolge offenbar auch bleiben. Ansonsten schien sich alles wie üblich zum Schlechteren zu entwickeln.
Er legte die Zeitung auf den Küchentisch und holte Joghurt aus dem Kühlschrank. Trank. Es schmeckte wie immer, nicht gut und nicht wirklich schlecht, nur etwas abgestanden und künstlich. Wahrscheinlich war der Karton schon zu alt gewesen, als er ihn gekauft hatte. Die Zeiten, in denen man in Stockholm etwas Frisches kaufen konnte, ohne besondere Anstrengungen zu unternehmen oder schwindelerregend überhöhte Preise zu zahlen, waren längst vorbei.
Seine nächste Station war das Badezimmer. Nachdem er sich gewaschen und die Zähne geputzt hatte, kehrte er ins Schlafzimmer zurück, machte das Bett, zog die Pyjamahose aus und kleidete sich an.
Währenddessen schaute er sich desinteressiert in seiner Wohnung um. Die meisten Stockholmer hätten sie eine Traumwohnung genannt, denn sie lag in der obersten Etage eines Hauses in der Köpmangatan in Gamla stan, der Stockholmer Altstadt. Seit mehr als drei Jahren wohnte er nun hier, und er konnte sich noch gut erinnern, wie wohl er sich bis zu jenem Tag auf dem Dach in ihr gefühlt hatte.
Jetzt fühlte er sich vor allem eingeschlossen und allein, sogar wenn ihn jemand besuchte. Vermutlich lag es gar nicht an der Wohnung; in letzter Zeit hatte er sich des Öfteren dabei ertappt, sich auch im Freien eingesperrt zu fühlen.
Ein vages Bedürfnis machte sich geltend, vielleicht danach, eine Zigarette zu rauchen. Die Ärzte hatten ihm zwar gesagt, er müsse aufhören, aber das war ihm egal. Entscheidender war da schon die Tatsache, dass das staatliche Tabakunternehmen die Marke, die er geraucht hatte, nicht mehr herstellte. Mittlerweile wurden überhaupt keine Zigaretten mit Pappmundstück mehr angeboten. Zwei- oder dreimal hatte er andere probiert, sich aber einfach nicht an sie gewöhnen können.
Heute zog er sich mit besonderer Sorgfalt an, und während er seine Krawatte band, musterte er lustlos seine Schiffsmodelle, die auf einem Regal über dem Bett standen. Drei Stück, zwei vollendet und das dritte halb fertig. Mehr als acht Jahre war es her, dass er mit dem ersten begonnen hatte, aber andererseits hatte er sie seit jenem Tag im April letzten Jahres nicht mehr angerührt.
Seitdem waren sie sehr eingestaubt.
Seine Tochter hatte sich mehrfach angeboten, das zu ändern, aber er hatte sie gebeten, es sein zu lassen.
Es war acht Uhr morgens am 3. Juli 1972, einem Montag.
Das Datum hatte eine besondere Bedeutung.
An diesem Tag würde er wieder zur Arbeit gehen.
Er war immer noch Polizist, genauer gesagt Kriminalkommissar und Leiter der Reichsmordkommission.
Martin Beck zog sein Jackett an und steckte die Zeitung in die Tasche.
Er hatte vor, sie in der U-Bahn zu lesen. Dies war Teil seiner täglichen Routine, zu der er zurückkehren würde.
Er ging im Sonnenschein die Skeppsbron entlang, atmete die vergiftete Luft ein und fühlte sich alt und ausgebrannt.
In seiner äußeren Erscheinung spiegelte sich jedoch nichts davon wider. Er wirkte vielmehr drahtig und gesund, bewegte sich schnell und geschmeidig. Ein großer, sonnengebräunter Mann mit einer markanten Kieferpartie und ruhigen, graublauen Augen unter der breiten Stirn.
Martin Beck war neunundvierzig Jahre alt. Bald würde er seinen fünfzigsten Geburtstag feiern, aber die meisten fanden, dass er jünger aussah.
4
Das Zimmer im Polizeipräsidium Süd an der Västberga Allé zeugte davon, dass lange Zeit ein anderer Leiter der Mordkommission gewesen war.
Es war sauber und aufgeräumt, und jemand hatte sich sogar die Umstände gemacht, eine Vase mit Kornblumen und Margeriten auf den Schreibtisch zu stellen, dennoch war alles von einem vagen Mangel an Ordnungsliebe und von einer allgemeinen Unordnung geprägt, die zwar oberflächlich, aber spürbar und irgendwie gemütlich war.
Das galt insbesondere für die Schreibtischschubladen.
Es konnte keinen Zweifel daran geben, dass jemand erst kürzlich zahlreiche Dinge aus ihnen entfernt hatte, aber etliches war noch da. Zum Beispiel alte Taxiquittungen und Kinokarten, zerbrochene Kugelschreiber und leere Tablettenschachteln. Mehrere Stiftablagen mit zusammengehakten Büroklammern, Gummiringen, Zuckerstücken und Portionsbeuteln Süßstoff. Zwei Erfrischungstücher, ein Paket Papiertaschentücher, drei Patronenhülsen und eine kaputte Armbanduhr der Marke Exacta. Außerdem eine große Zahl von Zetteln mit verstreuten Notizen, verfasst in einer sehr gut lesbaren Handschrift.
Martin Beck war durchs Haus gegangen und hatte die Mitarbeiter begrüßt. Die meisten waren alte Bekannte, jedoch bei weitem nicht alle.
Jetzt saß er an seinem Schreibtisch und musterte die Armbanduhr, die ihm hochgradig unbrauchbar zu sein schien. Das Glas war von innen beschlagen, und als er sie schüttelte, rasselte es im Gehäuse, als hätte sich jede einzelne Schraube im Uhrwerk aus ihrer Verankerung gelöst.
Lennart Kollberg hämmerte gegen die Tür und trat ein.
«Hallo», sagte er. «Herzlich willkommen.»
«Danke. Ist das deine Uhr?»
«Ja», antwortete Kollberg finster. «Sie ist versehentlich in der Waschmaschine gelandet. Hatte vergessen, die Taschen auszuleeren.»
Er sah sich um und fuhr entschuldigend fort:
«Ich habe am Freitag versucht, hier etwas aufzuräumen, aber ich wurde unterbrochen. Na, du weißt ja, wie das ist …»
Martin Beck nickte. Kollberg war der Mensch, den er während seiner langen Rekonvaleszenz am häufigsten gesehen hatte, und sie hatten sich nicht viel Neues zu sagen.
«Wie läuft’s denn mit dem Abnehmen?»
«Gut», sagte Kollberg. «Heute Morgen hatte ich ein halbes Kilo abgenommen. Von hundertvier auf hundertdreieinhalb.»
«Dann hast du also nur zehn Kilo zugenommen, seit du angefangen hast?»
«Achteinhalb», erwiderte Kollberg mit einer Miene verletzter Würde.
Er zuckte mit den Schultern und fuhr klagend fort:
«Es ist zum Kotzen. Das ganze Projekt ist unnormal. Gun lacht mich bloß aus. Bodil übrigens auch. Wie geht es dir denn eigentlich?»
«Gut.»
Kollberg runzelte die Stirn, sagte aber nichts. Stattdessen zog er den Reißverschluss seiner Aktentasche auf und holte eine hellrote Plastikmappe heraus. Sie schien einen nicht sonderlich umfangreichen Bericht zu enthalten. Etwa dreißig Seiten.
«Was ist das?»
«Lass es uns ein Geschenk nennen.»
«Von wem?»
«Von mir, zum Beispiel. Obwohl, eigentlich stimmt das nicht. Es kommt von Gunvald Larsson und Rönn. Sie finden die Sache zum Piepen.»
Kollberg legte die Mappe auf den Tisch. Dann sagte er:
«Ich muss leider los.»
«Wohin?»
«Ins RPA.»
Was im Klartext Reichspolizeiamt bedeutete.
«Warum?»
«Diese verdammten Banküberfälle.»
«Für die ist doch eine Sonderkommission eingesetzt worden.»
«Die Sonderkommission braucht Verstärkung. Letzten Freitag hat sich schon wieder so ein Holzkopf erschießen lassen.»
«Ja, das habe ich gelesen.»
«Der Reichspolizeichef hat daraufhin sofort beschlossen, die Sonderkommission zu verstärken.»
«Mit dir?»
«Nein», erwiderte Kollberg. «Eigentlich mit dir, glaube ich. Aber die Anordnung kam letzten Freitag, und da war ich hier noch der Boss, weshalb ich eigenmächtig einen Entschluss gefasst habe.»
«Nämlich?»
«Nämlich, dir dieses Irrenhaus zu ersparen und selbst einzuspringen, um die Sonderkommission zu verstärken.»
«Danke.»
Martin Beck meinte, was er sagte. Die Mitarbeit in der Sonderkommission hätte vermutlich bedeutet, sich täglich mit dem Reichspolizeichef, mindestens zwei Abteilungsleitern, diversen Polizeidirektoren und anderen bombastischen Amateuren konfrontiert zu sehen. Kollberg hatte sich diese Zumutungen eigenmächtig aufgebürdet.
«Nun», sagte Kollberg. «Im Gegenzug habe ich das hier bekommen.»
Er setzte einen dicken Zeigefinger auf die Plastikmappe.
«Was ist das?»
«Ein neuer Fall», antwortete Kollberg. «Im Gegensatz zu Bankraub und anderem ein wirklich hochinteressanter Fall. Nur schade, dass …»
«Was?»
«Dass du keine Detektivromane liest.»
«Wieso?»
«Du würdest ihn dann unter Umständen mehr zu schätzen wissen. Rönn und Larsson glauben, dass jeder Detektivromane liest. Eigentlich ist es ihr Fall, aber sie haben so viel Mist um die Ohren, dass sie ihre Aufgaben an jeden abschieben, der sie haben will. Es ist was zum Nachdenken. Zum Stillsitzen und Grübeln.»
«Tja, dann werde ich mir die Sache wohl mal ansehen», sagte Martin Beck leidenschaftslos.
«Darüber hat kein Wort in den Zeitungen gestanden. Bist du nicht neugierig?»
«Doch, sicher. Tschüs.»
«Tschüs», sagte Kollberg.
Hinter der Tür hielt er inne und blieb einige Sekunden mit gerunzelter Stirn stehen. Dann schüttelte er bekümmert den Kopf und ging zum Aufzug.
5
Martin Beck hatte gesagt, er sei neugierig auf den Inhalt der roten Mappe, aber das war alles andere als die Wahrheit.
Im Grunde interessierte er ihn nicht die Bohne.
Warum hatte er die Frage dann ausweichend und irreführend beantwortet?
Um Kollberg eine Freude zu machen? Wohl kaum. Um ihn zu täuschen? Noch weiter hergeholt.
Zum einen gab es dazu überhaupt keinen Grund, aber vor allem war es unmöglich. Sie kannten sich seit zu vielen Jahren viel zu gut, und außerdem war Kollberg einer der am schwersten zu täuschenden Menschen, denen er je begegnet war.
Vielleicht, um sich selbst zu täuschen? Auch der Gedanke erschien ihm unsinnig.
Martin Beck fuhr fort, sich mit der Frage zu beschäftigen, während er systematisch die Durchsicht seines Büros abschloss.
Als er mit den Schubladen fertig war, wandte er sich den Möbeln zu, rückte Stühle, stellte den Schreibtisch in einem anderen Winkel hin, schob den Aktenschrank ein paar Zoll näher zur Tür, schraubte die Schreibtischlampe ab und versetzte sie an den rechten Tischrand. Sein Stellvertreter hatte sie offenbar lieber links gehabt, oder vielleicht hatte es sich auch zufällig so ergeben. Bei nebensächlichen Dingen handelte Kollberg oft nach dem Zufallsprinzip. Wenn es um etwas Wichtiges ging, war er dagegen Perfektionist. So hatte er erst geheiratet, als er zweiundvierzig war, und zwar mit der offen ausgesprochenen Begründung, er wolle eine perfekte Frau haben.
Er hatte auf die Richtige gewartet.
Martin Beck konnte dagegen auf fast zwei Jahrzehnte einer gescheiterten Ehe mit einer Person zurückblicken, die mit Sicherheit nicht die Richtige gewesen war.
Inzwischen war er jedenfalls geschieden, hatte aber vermutlich gewartet, bis es zu spät war.
Während des letzten halben Jahres hatte er sich gelegentlich dabei ertappt, dass er sich fragte, ob seine Scheidung insgesamt gesehen nicht doch ein Irrtum gewesen war. Vielleicht war eine nörgelnde und langweilige Frau zumindest etwas aufregender als gar keine.
Das war allerdings keine wichtige Frage.
Er nahm die Vase mit den Blumen und trug sie zu einer der Sekretärinnen. Sie schien sich darüber zu freuen.
Martin Beck setzte sich auf seinen Bürostuhl und sah sich um. Die Ordnung war wiederhergestellt.
Wollte er sich einreden, dass sich nichts verändert hatte?
Die Frage war sinnlos, und um sie möglichst schnell zu vergessen, zog er die rote Mappe zu sich heran.
Das Plastik war durchsichtig, und er sah auf den ersten Blick, dass es sich um einen Todesfall handelte. Das war okay. Todesfälle standen in intimer Beziehung zu seinem Beruf.
Aber warum war er ihm auf den Tisch gekommen?
Bergsgatan 57. Also praktisch auf der Türschwelle zum Polizeipräsidium.
Ganz generell konnte er sagen, dass die Sache weder ihn noch seine Abteilung etwas anging; es war ein Fall für die Stockholmer Kriminalpolizei. Einen Moment lang fühlte er sich versucht, nach dem Telefon zu greifen und jemanden auf Kungsholmen anzurufen und sich zu erkundigen, was das sollte. Oder einfach alles in einen Umschlag zu stecken und an den Absender zurückzuschicken.
Der Drang, sich rigide und bürokratisch zu verhalten, war so stark, dass es einer Kraftanstrengung bedurfte, ihn zu unterdrücken.
Um sich abzulenken, sah er auf die Uhr. Schon Zeit für die Mittagspause. Er hatte keinen Hunger.
Martin Beck stand auf, ging in den Waschraum und trank ein Glas lauwarmes Wasser.
Als er zurückkam, merkte er, dass die Luft in seinem Büro stickig und heiß war. Dennoch zog er sein Jackett nicht aus und knöpfte nicht einmal den Kragen auf.
Er setzte sich hin, zog die Blätter heraus und begann zu lesen.
Achtundzwanzig Jahre als Polizist hatten ihn viel gelehrt, unter anderem auch die Kunst, Berichte zu lesen, schnell unnötige Wiederholungen und Unwichtiges auszusortieren und das Muster zu erkennen, wenn es denn eins gab.
Er benötigte weniger als eine Stunde, um die Berichte gründlich zu studieren. Die meisten waren schlecht geschrieben, manche regelrecht unverständlich, und einige Abschnitte litten unter besonders unglücklichen Formulierungen. Er wusste sofort, wer diese Abschnitte verfasst hatte. Einar Rönn, ein Polizeibeamter, der in stilistischer Hinsicht ein enger Verwandter jenes Amtsbruders war, der in seiner berüchtigten Verkehrsordnung unter vielem anderen konstatierte, dass die Dunkelheit anbricht, wenn die Straßenlaternen angezündet werden.
Martin Beck blätterte die Unterlagen ein weiteres Mal durch und las hier und da nach, um bestimmte Details zu überprüfen.
Anschließend legte er den Bericht weg, stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und legte seine Stirn in die Handflächen.
Er runzelte die Augenbrauen und dachte darüber nach, was sich anscheinend ereignet hatte. Die Geschichte zerfiel in zwei Teile. Der erste war alltäglich und abstoßend.
Vor fünfzehn Tagen, also am Sonntag, dem 18. Juni, hatte eine Mieterin im Haus Bergsgatan 57 auf Kungsholmen die Polizei gerufen. Der Anruf war um 14.19 Uhr registriert worden, aber erst zwei Stunden später war ein Streifenwagen an der Adresse eingetroffen. Das Haus in der Bergsgatan lag zwar kaum mehr als fünf Gehminuten von der Zentrale der Stockholmer Polizei entfernt, doch die Verzögerung ließ sich leicht erklären. Der Mangel an Polizisten in Stockholm schrie zum Himmel, außerdem war Urlaubszeit und, um das Maß vollzumachen, Sonntag. Des Weiteren hatte nichts darauf hingedeutet, dass die Angelegenheit besondere Eile erforderte. Die Polizisten Karl Kristiansson und Kenneth Kvastmo waren in das Gebäude gegangen und hatten mit der Anruferin gesprochen, einer Frau, die im zweiten Stock des Vorderhauses wohnte. Sie hatte ihnen gesagt, dass sie seit einigen Tagen ein unangenehmer Geruch im Treppenhaus störe, und den Verdacht geäußert, dass etwas nicht in Ordnung sei.
Auch den beiden Polizeibeamten war der ominöse Geruch sofort aufgefallen. Kvastmo definierte ihn als Verwesungsgeruch, seinen Worten zufolge hatte sich einem der Gedanke an den Gestank verfaulten Fleisches aufgedrängt. Eine nähergehende Geruchsindizierung – weiterhin mit Kvastmos Worten – hatte die Männer zu einer Wohnungstür im ersten Stock geführt. Vorliegenden Informationen zufolge war es die Tür zu einer Einzimmerwohnung, die seit geraumer Zeit von einem etwa sechzigjährigen Mann bewohnt wurde, dessen Name eventuell Karl Edvin Svärd war. Dieser Name habe jedenfalls handschriftlich auf einem Stück Pappe unter dem Knopf der elektrischen Klingel gestanden. Da man nunmehr vermuten konnte, dass sich die Leiche eines Selbstmörders, eines auf natürliche Weise Verstorbenen oder eines Hundes – immer noch laut Kvastmo – in der Wohnung befand, möglicherweise auch eine kranke oder hilflose Person, beschloss man, sich Zugang zu verschaffen. Die elektrische Klingel schien nicht zu funktionieren, und lautes Klopfen an der Tür führte zu keiner Reaktion.
Der Versuch, Kontakt zum Hausmeister, Hausverwalter oder einer anderen Person mit Zweitschlüsseln aufzunehmen, scheiterte.
Die Polizeibeamten baten deshalb um Anweisungen und erhielten die Order, sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Ein Schlüsseldienst wurde gerufen, was zu einer weiteren halben Stunde Zeitverzögerung führte.
Als der Mann vom Schlüsseldienst eintraf, stellte er fest, dass die Tür mit einem einbruchssicheren Patentschloss versehen war und es keinen Briefeinwurf gab. Daraufhin wurde das Sicherheitsschloss mit Hilfe eines Spezialwerkzeugs herausgebohrt, aber die Tür konnte trotzdem nicht geöffnet werden.
Kristiansson und Kvastmo, die sich inzwischen weit über ihre reguläre Dienstzeit hinaus mit dem Fall beschäftigt hatten, baten um neue Anweisungen und wurden aufgefordert, die Tür gewaltsam zu öffnen. Auf ihre Frage, ob dabei nicht jemand von der Kriminalpolizei anwesend sein sollte, erhielten sie die lakonische Antwort, weiteres Personal sei nicht verfügbar.
Der Schlosser hatte sich mittlerweile entfernt, da er der Meinung war, seine Aufgabe erfüllt zu haben.
Gegen sieben Uhr abends hatten Kvastmo und Kristiansson die Tür geöffnet, indem sie die Splinte an den äußeren Scharnieren herausschlugen. Dennoch ergaben sich neue Schwierigkeiten. Später stellte man fest, dass die Tür mit zwei klobigen Metallriegeln gesichert war und darüber hinaus mit einem sogenannten Fox-Lock, einer Art Eisenbalken mit Verankerung in den Türpfosten. Nach einer weiteren Stunde Arbeit konnten die Beamten die Wohnung betreten, aus der ihnen drückende Hitze und ein überwältigender Leichengestank entgegenschlug.
In dem Zimmer, das zur Straße hin lag, stießen sie auf einen toten Mann. Die Leiche lag circa drei Meter vom Fenster entfernt, das zur Bergsgatan hinausführte, auf dem Rücken neben einem eingeschalteten elektrischen Heizkörper. Aufgrund der Hitze, die von diesem ausstrahlte, und des herrschenden heißen Wetters war die Leiche «auf mindestens das doppelte Körpervolumen» aufgequollen. Der Körper war stark verwest, Leichenwürmer fanden sich in großen Mengen.
Das Fenster zur Straße war von innen mit einem Haken verschlossen und das Rollo heruntergezogen.
Das zweite Fenster der Wohnung, in der Kochnische, zeigte zum Hof. Die Fensterflügel waren mit Dichtungsstreifen zugeklebt und anscheinend schon lange nicht mehr geöffnet worden.
Das Zimmer war spärlich möbliert und die Einrichtung ärmlich. Die Wohnung war im Hinblick auf Decke, Fußboden, Wände, Tapeten und Farbe ausgesprochen verwohnt.
In Kochnische und Wohnraum befanden sich nur wenige Gebrauchsgegenstände.
Einem vorgefundenen Rentenbescheid war zu entnehmen, dass es sich bei dem Toten um den zweiundsechzigjährigen Karl Edvin Svärd handelte, ehemals Lagerarbeiter und seit sechs Jahren Frührentner.
Nachdem die Wohnung von einem Kriminalassistenten namens Gustavsson inspiziert worden war, schaffte man die Leiche zur obligatorischen Obduktion in die Gerichtsmedizin.
Die Angelegenheit wurde vorläufig als Selbstmord eingeschätzt, alternativ als Todesfall aufgrund von Hunger, Krankheit oder einer anderen natürlichen Ursache.
Martin Beck tastete in den Taschen seines Jacketts nach den nicht mehr existierenden Zigaretten der Marke Florida.
In der Presse war Svärd mit keinem Wort erwähnt worden. Dazu war die Geschichte viel zu banal. Stockholm hatte eine der höchsten Selbstmordraten der Welt, was man tunlichst nicht zur Sprache brachte oder notfalls mit diversen manipulierten und verlogenen Statistiken zu übertünchen versuchte. Die gewöhnlichste Erklärung war die einfachste: dass alle anderen Länder ihre Statistiken wesentlich mehr verfälschten. Seit ein paar Jahren wagten allerdings nicht einmal mehr Regierungsmitglieder, dies laut oder öffentlich zu sagen, möglicherweise weil sie spürten, dass die Menschen trotz allem eher ihren eigenen Augen als politischer Schönfärberei trauten.
Und falls es zufällig kein Selbstmord war, machte das die Sache noch peinlicher. Im sogenannten Wohlfahrtsstaat wimmelte es nämlich nur so von kranken, bitterarmen und einsamen Menschen, die sich bestenfalls von Hundefutter ernährten und sich selbst überlassen blieben, bis sie dahinsiechten und in ihren Rattenlöchern von Wohnungen starben.
Nein, das war nichts für die Öffentlichkeit. Kaum etwas für die Polizei.
Doch das war nicht alles. Die Geschichte vom Frührentner Karl Edvin Svärd hatte noch eine Fortsetzung.
6
Martin Beck besaß genügend Berufserfahrung, um zu wissen: Wenn in einem Bericht etwas unverständlich erschien, lag dies in neunundneunzig von hundert Fällen daran, dass jemand schlampig gearbeitet, sich geirrt, etwas fehlerhaft notiert, den entscheidenden Punkt vergessen hatte oder nicht fähig gewesen war, sich verständlich auszudrücken.
Der zweite Teil der Geschichte von dem Toten in dem Haus an der Bergsgatan erschien dunkel.
Zunächst hatte alles seinen gewohnten Gang genommen. Die Leiche war am Sonntagabend fortgeschafft und in einem Kühlfach deponiert worden. Am nächsten Tag wurde die Wohnung desinfiziert, was sicher bitter nötig gewesen war, und die zuständigen Polizisten hatten den Fall abgeschlossen.
Die Leiche wurde am Dienstag seziert, und das Obduktionsprotokoll traf am folgenden Tag bei der Polizei ein.