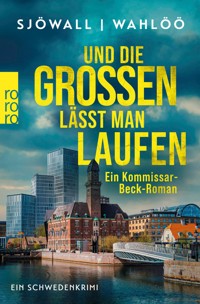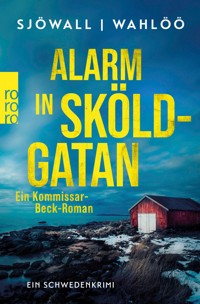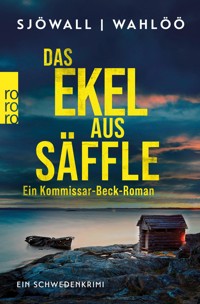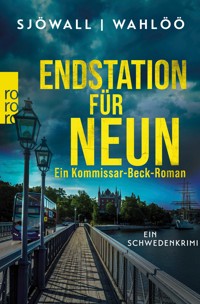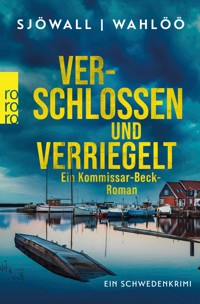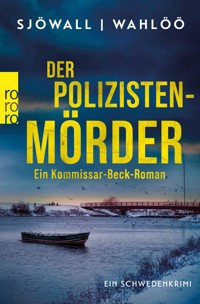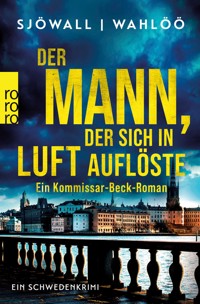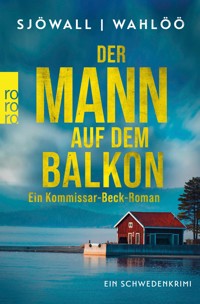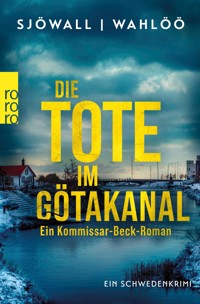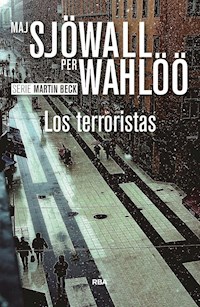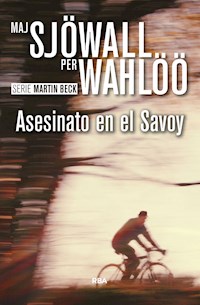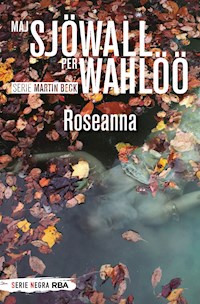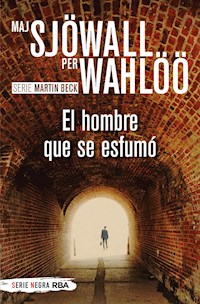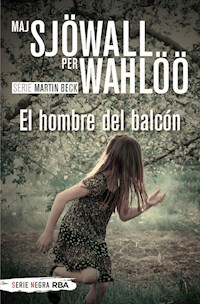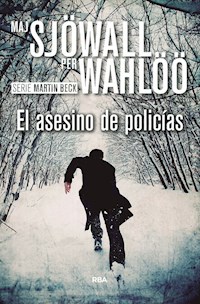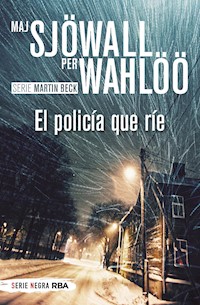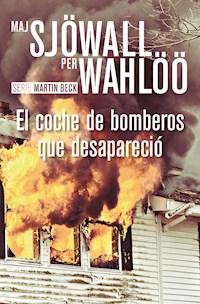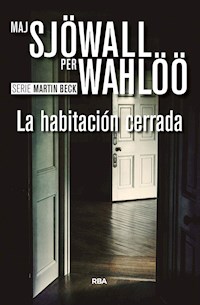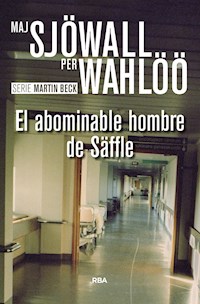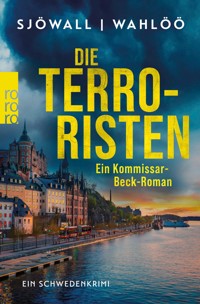
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martin Beck ermittelt
- Sprache: Deutsch
Band 10: Schrankenloser Terror! Fünf Männer überlegen fieberhaft, an welcher Stelle Stockholms sich am Besten ein Attentat auf den hochrangigen Gast aus den USA durchführen ließe. Das Ganze ist ein Planspiel, und die fünf Männer sind schwedische Polizisten – vorerst. Denn in Stockholm ist die internationale Terroristenorganisation ULAG aktiv. Ihr Kennzeichen: eine ungeheuerliche Brutalität, die schon viele Unbeteiligte das Leben gekostet hat. Doch ist bei ihren Aktionen keine politische Zielrichtung erkennbar – die Opfer waren bisher Liberale und Konservative, Faschisten und Kommunisten. Plant die ULAG jetzt auch einen Anschlag auf den amerikanischen Senator? Dies ist der zehnte Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Anne Holt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maj Sjöwall • Per Wahlöö
Die Terroristen
Ein Kommissar-Beck-Roman
In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Anne Holt.
Über dieses Buch
Schrankenloser Terror!
Fünf Männer überlegen fieberhaft, an welcher Stelle Stockholms sich am Besten ein Attentat auf den hochrangigen Gast aus den USA durchführen ließe. Das Ganze ist ein Planspiel, und die fünf Männer sind schwedische Polizisten – vorerst. Denn in Stockholm ist die internationale Terroristenorganisation ULAG aktiv. Ihr Kennzeichen: eine ungeheuerliche Brutalität, die schon viele Unbeteiligte das Leben gekostet hat. Doch ist bei ihren Aktionen keine politische Zielrichtung erkennbar – die Opfer waren bisher Liberale und Konservative, Faschisten und Kommunisten. Plant die ULAG jetzt auch einen Anschlag auf den amerikanischen Senator?
Dies ist der zehnte Band der weltberühmten Serie um den schwedischen Kommissar Martin Beck. In neuer Übersetzung und mit einem Vorwort von Anne Holt.
Vita
Das schwedische Autorenduo Maj Sjöwall und Per Wahlöö schrieb einen Zyklus von zehn Kriminalromanen um Kommissar Martin Beck, die zu einem einzigartigen Welterfolg wurden. Mit ihrer Mischung aus Gesellschaftskritik, Spannung und Unterhaltung haben Sjöwall/Wahlöö die Spannungsliteratur revolutioniert und eine ganze Generation von Krimiautoren geprägt. Sie gelten als Eltern des skandinavischen Kriminalromans und sind erklärte Vorbilder von Autoren wie Henning Mankell und Håkan Nesser. Die zehn Bände der Kommissar-Beck-Reihe sind in 35 Sprachen übersetzt worden und erreichten bisher eine Gesamtauflage von über 10 Millionen Exemplaren. Alle Romane wurden außerdem sehr erfolgreich fürs Fernsehen verfilmt.
Maj Sjöwall, 1935 in Stockholm geboren, studierte Graphik und Journalismus und arbeitete für verschiedene Zeitschriften. Mit ihrem Mann Per Wahlöö schrieb sie die erfolgreiche Krimiserie um Kommissar Martin Beck, die auch verfilmt wurde. 1996 erhielt Sjöwall für die erste Serienverfilmung von Kommissar Beck den Adolf-Grimme-Preis (zusammen mit Gösta Ekmann). Zuletzt arbeitete Maj Sjöwall als Übersetzerin in Stockholm, wo sie im April 2020 verstarb.
Per Wahlöö, 1926 im schwedischen Lund geboren, machte nach dem Studium der Geschichte als Journalist Karriere. In den Fünfzigerjahren ging er nach Spanien und wurde 1956 vom Franco-Regime ausgewiesen. Nach verschiedenen Reisen um die halbe Welt ließ er sich wieder in Schweden nieder und arbeitete dort als Schriftsteller. Per Wahlöö starb 1975 in seiner Heimatstadt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1975 unter dem Titel «Terroristerna» bei P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2025
Copyright © 1977, 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Terroristerna» Copyright © 1975 by Maj Sjöwall und Per Wahlöö
Redaktion Friederike Arnold
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-02294-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Anne Holt
Als ich Maj Söwall zum ersten Mal traf, fühlte ich mich wie ein gläubiger Katholik, der dem Papst begegnet. Die Romanreihe mit dem Polizisten aus Stockholm und seinen Kollegen der Reichsmordkommission hatte mich nämlich mehr als jedes andere Werk in meiner eigenen Entscheidung, Schriftstellerin zu werden, beeinflusst, und ebenso die Wahl des Genres: der skandinavische Kriminalroman. Das Treffen fand 1994 statt, ein Jahr nach meinem Debüt als Krimiautorin, und es war eine ungeheure Ehre, einen ganzen Abend lang mit dieser zurückhaltenden, bescheidenen Schöpferin von Martin Beck in einem schwedischen Lokal zu sitzen. Im Grunde genommen hatte ich immer gedacht, es würde sie gar nicht geben, so wie ich als Kind immer glaubte, Astrid Lindgren sei eine gütige Jesus-Figur, die oben im Himmel saß und interessante Gespräche mit Gott führte, während sie mit einer Feder ihre Geschichten aufschrieb.
Der «Roman über ein Verbrechen», also die zehn Bücher in der Martin-Beck-Reihe, können, wie alle wichtigen Literaturwerke, auf viele verschiedene Arten gelesen werden. Natürlich ist es spannende und in mehr als einer Hinsicht neu geschaffene Unterhaltungsliteratur, auch wenn sich die Autoren möglicherweise nicht so gern auf bestimmte Genreeinordnungen festlegen wollten. Die Bücher stellen gleichzeitig ein Porträt – vielmehr ein Spottbild – von Aufstieg und Fall des skandinavischen Wohlfahrtsstaates dar. Die Reihe entwirft eine erstaunlich liebevolle, fast rührend nostalgische und manchmal aggressive Schilderung von Stockholm und Schweden, die sich in rasanter Veränderung und nach Meinung des damals extrem linksradikalen Autorenpaars auf Talfahrt befinden.
Die Terroristen, der letzte Band dieser Reihe, macht da keine Ausnahme.
Ein erzkonservativer amerikanischer Senator soll die kleine Nation an Europas äußerem Rand mit seiner Gegenwart beehren. Die Sicherheitsanforderungen sind massiv. Martin Beck, der die Hauptverantwortung für das Wohlergehen des Senators übertragen bekommt, muss sich wie gewöhnlich durch ein Minenfeld aus selbstüberheblichen Vorgesetzten und inkompetenten Kollegen manövrieren.
Liest man das Buch nach dreißig Jahren erneut, kann man durchaus etwas von der Unschuldigkeit spüren, die unseren abgelegenen Winkel der Erde nach wie vor prägte. Das macht Die Terroristen wie auch alle anderen Bücher der Reihe zu einem faszinierenden Zeitgemälde. Die Welt war noch nicht zusammengeschrumpft und das Wort Globalisierung noch nicht erfunden. Terrorismus verbanden wir vor allem mit der IRA und dem Attentat von München. Das ging uns in gewisser Weise gar nichts an. Und dann wieder doch. Die Terroristen in diesem Buch sind eine Gruppe Psychopathen, die diese Verbrechen nur begehen, weil sie ihren Job so perfekt wie möglich machen und dafür bezahlt werden wollen – die ungewöhnliche Verbrecherbande, die wir kennenlernen, hat eigentlich keine politisch-ideellen Motive. Und deshalb wage ich folgende Deutung: Sjöwall und Wahlöö sind offenbar von Frederick Forsyths Der Schakal inspiriert worden, doch wollten sie nicht diese Art von Buch schreiben. Das Phänomen des «blinden Terrorismus» kann ihnen nicht genug gewesen sein.
In Die Terroristen spielt nämlich wie in der ganzen Beck-Reihe die Unterdrückung eine große Rolle. Die Übergriffe der Behörden auf die schwächeren Bürger, der Kampf des kleinen, einfachen und verletzlichen Mannes gegen die Ungerechtigkeit – hier schlug das Herz von Sjöwall und Wahlöö, und das führte auch die Feder. Deshalb sind es insbesondere die ergreifenden Nebenhandlungen in dem Roman, die die Erzählung vorantreiben und der ganzen Geschichte ihre ausschlaggebende Qualität verleihen. Wir lernen unter anderem Rebecka kennen, eine äußerst unbedarfte Frau mit einem kleinen Kind und einem amerikanischen Freund, der in seinem Heimatland als Deserteur des Vietnamkrieges im Gefängnis sitzt. Erst wird sie für einen Bankraub angeklagt, den sie offensichtlich nicht begangen hat, worauf sie in ihrer Unfähigkeit, das System zu verstehen, das im Begriff ist, ihr alles wegzunehmen, was sie liebt, genau die Rolle annimmt, in der das System sie am liebsten sehen möchte: die der Verbrecherin. Oder die der Terroristin. Eine Terroristin mit Zielen und Ansichten.
Und mit einem Mal wird uns klar, dass Sjöwall und Wahlöö ihrer Zeit sehr weit voraus waren.
Auch dreißig Jahre nachdem dieses Buch herausgekommen ist, bemühen sich Schriftsteller, Filmemacher und Wissenschaftler in der ganzen Welt, eine Antwort auf die große Frage unserer Zeit zu finden: Wie entsteht Terrorismus? Oder besser gesagt: Was macht einen Menschen zum Terroristen?
Darauf gab bereits ein kleiner Kriminalroman im Jahre 1975 eine schlüssige Antwort.
Ich verneige mich in Anerkennung.
Meine Bewunderung gilt auch der Eleganz, mit welcher die Nebengeschichten in das eingeflochten sind, was die eigentliche Haupthandlung des Buches zu sein scheint. Sorgfältig und unaufdringlich und weit entfernt von jeglichem Missionieren oder Postulieren werden sie dem Leser ins Herz geschrieben: Die Geschichte von der Trauer eines Vaters über das Unglück der Tochter, die Verwirrung einer unscheinbaren Frau in einer immer lauter und unübersichtlicher werdenden Gesellschaft, die Unterhöhlung der Polizei, die sich langsam in ein System verwandelt, in dem es bald keinen Raum mehr für denkende und empathische Menschen wie Martin Beck geben wird.
Sjöwall und Wahlöö haben eine Romanreihe geschrieben, aber sie haben auch ein Lehrwerk in zehn Bänden verfasst. Sie haben ein Genre erfunden. Sie haben den Maßstab festgelegt, den zu erreichen wir anstreben. Sie haben ein großes literarisches Werk hinterlassen, nicht nur den wichtigsten Kanon, sondern auch einen Wegweiser für alle, die sich ans Schreiben wagen wollen. Sie lehren uns, das große Bild mit Hilfe des kleinen Details zu beschreiben, die Kamera zu senken, dicht an das Objekt heranzugehen, an den vergessenen, den verstoßenen, den einfachen Menschen.
Und im Mittelpunkt steht Martin Beck. Erschöpft, grau und zunehmend desillusioniert.
Für mich ist er eine der wichtigsten und am meisten vollendeten Figuren überhaupt. Er hat mit dem bis dahin vorherrschenden Heldenschicksal gebrochen, und keinem von uns ist es bisher gelungen, eine derart überzeugende Figur zu schaffen. Und er wurde zum Vorbild: Seit den frühen siebziger Jahren sollte dem echten skandinavischen Ermittler immer etwas Menschliches anhaften. Einsamkeit und Alkoholismus, sexuelle Abwege und Hemmnisse, ja, sogar das Junggesellendasein oder uneheliche Kinder sind Becks unzähligen Nachfolgern zuteilgeworden, um die Illusion einer «Normalität» zu erzeugen, was immer das auch heißen mag.
Denn niemand ist wirklich so normal wie Martin Beck.
Um es mit Lennart Kollberg, Martin Becks bestem Freund und Kollegen, auf der letzten Seite der besten Romanreihe der Welt zu sagen: «Dein Fehler, Martin, ist, dass du den falschen Job hast. Zur falschen Zeit. Im falschen Teil der Welt. Im falschen System.»
So normal ist Martin Beck, dass er in all das gar nicht hineinpasst.
Das ist genial.
Die Terroristen
1
Der Reichspolizeichef lächelte.
Dieses Lächeln, jungenhaft und charmant, war im Allgemeinen für Presse und Fernsehen reserviert. Die Schar der sogenannten Mitglieder des inneren Kreises wie der Kriminaldirektor beim Reichspolizeiamt Stig Malm, der Chef des Staatsschutzes Eric Möller und der Leiter der Reichsmordkommission, Kriminalkommissar Martin Beck, wurden mit diesem Strahlen eher selten beglückt.
Nur einer der drei Männer erwiderte das Lächeln.
Stig Malm besaß schöne weiße Zähne, und er lächelte gern, um sie zu zeigen. Ohne dass es ihm bewusst gewesen wäre, hatte er sich im Laufe der Zeit ein ganzes Register verschiedener Arten zu lächeln zugelegt. Jenes, das er nun aufsetzte, konnte man nur als kriecherisch und unterwürfig bezeichnen.
Der Chef des Staatsschutzes unterdrückte ein Gähnen, und Martin Beck schnäuzte sich.
Es war erst halb acht Uhr morgens – die bevorzugte Zeit des Reichspolizeichefs, überraschend Sitzungen einzuberufen, was jedoch in keiner Weise bedeutete, dass er selbst um diese Zeit im Polizeigebäude anzutreffen war. Oft tauchte er nicht vor dem späten Vormittag auf, und selbst dann war er für die meisten Leute und sogar für seine engsten Mitarbeiter nicht zu sprechen. An seiner Tür hätte gut und gerne «My office is my castle» stehen können, sein Büro glich einer uneinnehmbaren Festung, bewacht von einer gut dressierten Sekretärin, die «Der Drache» genannt wurde.
An diesem Morgen zeigte er sich von seiner aufgeräumten und wohlwollenden Seite. Er hatte sogar eine Thermoskanne mit Kaffee und anstelle der üblichen Plastikbecher richtige Porzellantassen auffahren lassen.
Stig Malm stand auf und goss den Kaffee ein.
Noch ehe er sich wieder gesetzt hatte, wusste Martin Beck schon, dass er zunächst an den Bügelfalten der Hose zupfen und sich dann mit der Handfläche über sein gut frisiertes, welliges Haar streichen würde.
Stig Malm war sein direkter Vorgesetzter, und Martin Beck brachte ihm nicht den geringsten Respekt entgegen. Seine selbstzufriedene Koketterie und die schleimige Art höheren Machthabern gegenüber waren Eigenschaften, über die sich Martin Beck schon lange nicht mehr zu ärgern pflegte und die er jetzt nur noch lächerlich fand. Was ihn hingegen ärgerte und seine Arbeit oftmals behinderte, war die Starrköpfigkeit des Mannes und sein Mangel an Selbstkritik, der ebenso umfassend und verheerend war wie seine Unkenntnis in allem, was praktische Polizeiarbeit betraf. Dass er eine derart hohe Position erreicht hatte, beruhte auf Karrieregeilheit, politischem Opportunismus und einer gewissen administrativen Geschicklichkeit.
Der Chef des Staatsschutzes tat vier Stück Zucker in seinen Kaffee, rührte mit dem Löffel um und schlürfte beim Trinken.
Malm trank seinen Kaffee ohne Zucker, er war um seine wohltrainierte Figur besorgt.
Martin Beck fühlte sich nicht gut, und er wollte so früh am Morgen keinen Kaffee.
Der Reichspolizeichef nahm sowohl Zucker als auch Sahne, und als er die Tasse hochhob, spreizte er den kleinen Finger ab. Er leerte sie in einem Zug und schob sie dann von sich, während er gleichzeitig eine grüne Mappe nahm, die auf der Ecke des glänzend polierten Konferenztischs lag.
«So dann, also», sagte er und lächelte wieder. «Erst einen Kaffee, und dann kann man sein Tagwerk in Angriff nehmen.»
Martin Beck betrachtete missmutig seine unberührte Kaffeetasse und sehnte sich nach einem Glas kalter Milch.
«Wie geht es dir, Martin?», fragte der Reichspolizeichef mit gespielter Anteilnahme in der Stimme. «Du siehst schlecht aus. Ich hoffe nicht, dass du vorhast, schon wieder krank zu werden. Du weißt, dass wir auf dich nicht verzichten können.»
Martin Beck hatte nicht vor, wieder krank zu werden. Er war bereits krank. Er hatte zusammen mit seiner fünfundzwanzigjährigen Tochter und deren Freund bis halb vier Uhr morgens Wein getrunken, und er wusste, dass er deshalb schlecht aussah. Aber er hatte keine Lust, seine selbstverursachte Unpässlichkeit mit seinem Vorgesetzten zu diskutieren. Außerdem fand er dieses «schon wieder» nicht wirklich gerecht. Anfang März hatte er drei Tage lang mit Grippe und hohem Fieber im Bett gelegen, und jetzt schrieb man den 7. Mai.
«Gar nicht», sagte er. «Es geht mir gut. Nur ein wenig erkältet.»
«Du siehst aber wirklich schlecht aus», bestätigte Stig Malm. Er klang nicht einmal mitfühlend, sondern eher vorwurfsvoll. «Sogar richtig schlecht, finde ich.»
Er betrachtete Martin Beck forschend, und dieser spürte die Wut in sich aufsteigen.
«Danke für die Fürsorge, aber es geht mir gut. Ich nehme mal an, dass wir nicht hier sind, um über mein Aussehen oder meinen Gesundheitszustand zu beraten.»
«Nein, das stimmt», bestätigte der Reichspolizeichef. «Also zur Sache.»
Er schlug die grüne Mappe auf. Der aus höchstens drei oder vier DIN-A4-Bogen bestehende Inhalt ließ hoffen, dass sich dieses Treffen nicht allzu lange hinziehen würde.
Zuoberst lag ein maschinengeschriebener Brief mit einem großen grünen Stempel unter der schnörkeligen Unterschrift und einem Briefkopf, den Martin Beck von seinem Platz aus nicht genauer erkennen konnte.
«Wie ihr wisst, haben wir uns über unsere in gewissen Bereichen mangelhafte Erfahrung Gedanken gemacht, was die Überwachung und Gewährleistung von Sicherheit bei Staatsbesuchen und ähnlich heiklen Situationen betrifft. Gelegenheiten, bei denen man mit Demonstrationen besonders aggressiven Charakters und mehr oder weniger gut geplanten Attentatsversuchen rechnen muss.» Automatisch verfiel der Reichspolizeichef in den pompösen Stil, der seine öffentlichen Auftritte zu prägen pflegte.
Stig Malm murmelte zustimmend, Martin Beck sagte nichts, aber Eric Möller wandte ein:
«Nun ja, so völlig unerfahren sind wir doch wohl nicht. Der Besuch von Chruschtschow ist zumindest gut verlaufen, mal abgesehen von diesem rot angemalten Schwein, das irgendjemand vor der Logårds-Treppe freigelassen hat. Auch der von Kosygin hat geklappt, und zwar sowohl organisatorisch als auch vom Sicherheitsstandard her. Und die Umweltschutzkonferenz ebenfalls, um noch ein etwas anderes Beispiel zu nennen.»
«Ja, natürlich, aber diesmal werden wir mit einem größeren Problem konfrontiert. Ich meine damit den Besuch des Senators aus den Vereinigten Staaten Ende November. Das kann eine heiße Sache werden, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mit einflussreichen Gästen aus den USA haben wir bisher keine Erfahrung, und jetzt wird es ernst. Der Besuch ist beschlossene Sache, und ich habe bereits erste Instruktionen erhalten. Wir müssen früh mit den Vorbereitungen beginnen und außergewöhnlich sorgfältig vorgehen. Wir müssen auf alles gefasst sein, natürlich vor allem auf Übergriffe aus dem linksextremen Lager und von anderen fanatischen Psychopathen, denen der Vietnamkrieg zu Kopf gestiegen ist. Aber auch von ausländischen Terrorgruppen.»
Der Reichspolizeichef lächelte nicht mehr.
«Diesmal müssen wir uns auf andere Dinge einstellen als nur auf geworfene Eier», sagte er grimmig. «Das muss dir klar sein, Eric.»
«Wir können durchaus Präventivmaßnahmen vornehmen», schob Möller ein.
Der Reichspolizeichef zuckte mit den Schultern.
«In gewissem Maße durchaus», gab er zu. «Aber wir können nicht alle eliminieren, einsperren oder internieren, die vielleicht Ärger machen, das weißt du genauso gut wie ich. Ich habe meine Befehle zu befolgen, und du wirst deine erhalten.»
Und ich meine, dachte Martin Beck finster.
Er versuchte immer noch, den gedruckten Text oben auf dem Brief in der grünen Mappe zu entziffern. Er meinte, das Wort «Police» oder möglicherweise «Policia» zu erkennen. Seine Augen brannten, und die Zunge fühlte sich rau und trocken wie Schmirgelpapier an. Widerwillig nippte er an dem bitteren Kaffee.
«Aber all das soll uns erst später beschäftigen», erklärte der Reichspolizeichef. «Heute möchte ich mit euch über diesen Brief hier sprechen.»
Er klopfte mit dem Zeigefinger auf das Papier in der aufgeschlagenen Mappe.
«Der hat nämlich in hohem Maße mit den bevorstehenden Problemen zu tun», sagte er.
Er gab den Brief Stig Malm, um ihn herumgehen zu lassen, ehe er fortfuhr:
«Wie ihr seht, handelt es sich um eine Einladung, auf unser Ersuchen hin, bei einem bevorstehenden Staatsbesuch einen Beobachter in dieses Land schicken zu dürfen. Da der nun auf Besuch kommende Präsident in dem besagten Land nicht sehr beliebt ist, wird man alle Kräfte einsetzen, um ihn zu schützen. Wie in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern hat man mit zahlreichen Attentatsversuchen sowohl gegen einheimische als auch gegen ausländische Politiker zu tun gehabt. Somit gab es genügend Gelegenheiten, ausreichend Erfahrung zu sammeln, und ich denke, dass die Polizeitruppe und der Sicherheitsdienst dieses Landes auf dem Gebiet besonders qualifiziert sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir viel lernen können, wenn wir uns mit ihren Methoden und Möglichkeiten auseinandersetzen.»
Martin Beck überflog den Brief, der auf Englisch und in einem sehr formellen und verbindlichen Ton verfasst war. Der Präsidentenbesuch würde am 5. Juni stattfinden, also in knapp einem Monat, und der Vertreter der schwedischen Polizei war eingeladen, sich zwei Wochen vorher einzufinden, um sich mit den Details der wichtigsten Phase der Vorbereitungsarbeit vertraut zu machen. Die Unterschrift war elegant und vollkommen unleserlich, wobei der Name noch einmal in Maschinenschrift darunter stand. Es war ein spanischer Name, sehr lang und irgendwie adlig und vornehm.
Als der Brief wieder in die grüne Mappe verschwunden war, sagte der Reichspolizeichef:
«Die Frage ist nur, wen schicken wir hin?»
Stig Malm hob nachdenklich den Blick zur Decke, erwiderte aber nichts.
Martin Beck befürchtete, dass er selbst vorgeschlagen werden könnte. Vor fünf Jahren noch, bevor er sich aus seiner unglücklichen Ehe befreit hatte, hätte er den Auftrag mit Freuden angenommen, um für eine Weile von zu Hause wegzukommen. Doch jetzt wollte er überhaupt nicht mehr reisen und beeilte sich daher zu sagen:
«Das ist wohl am ehesten eine Aufgabe für die Sicherheitsabteilung.»
«Ich kann nicht fahren», sagte Möller. «Zum einen kann ich nicht von der Abteilung weg, weil wir gewisse Umorganisationsprobleme in Büro A haben, die zu lösen einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Und zum anderen beherrscht unsere Abteilung die meisten dieser Dinge bereits, und es wäre von größerem Nutzen, wenn jemand fahren würde, der nicht so sehr mit Sicherheitsfragen beschäftigt ist. Ein Kriminalbeamter zum Beispiel oder eventuell jemand von der Schutzpolizei. Derjenige kann uns ja trotzdem gern nach seiner Rückkehr seine Erfahrungen mitteilen, und so werden alle Nutzen davon haben.»
Der Reichspolizeichef nickte.
«Ja, Eric, was du da sagst, klingt sinnvoll», meinte er. «Außerdem können wir dich, worauf du ja selbst schon hingewiesen hast, derzeit nicht entbehren. Und dich ebenfalls nicht, Martin.»
Martin Beck verspürte einen inneren Seufzer der Erleichterung.
«Außerdem spreche ich kein Spanisch», fügte der Chef des Staatsschutzes hinzu.
«Wer kann denn schon Spanisch?», entgegnete Malm und lächelte kollegial.
Er wusste, dass auch der Reichspolizeichef des Kastilischen nicht mächtig war.
«Ich kenne jemanden, der das kann», erklärte Martin Beck.
Malm zog die Augenbrauen hoch.
«Und wer? Jemand bei der Kripo?»
«Ja. Gunvald Larsson.»
Malm hob die Augenbrauen noch einen Millimeter höher. Dann lächelte er misstrauisch.
«Aber den können wir nicht schicken.»
«Warum nicht?», fragte Martin Beck. «Ich denke, er ist für so eine Aufgabe sehr gut geeignet.»
Er merkte selbst, wie gereizt er klang.
Normalerweise gehörte er nicht zu denen, die gern eine Lanze für Gunvald Larsson brachen, aber Malms Tonfall ärgerte ihn, und außerdem gingen seine und Stig Malms Ansichten so gut wie immer auseinander. Deshalb widersprach er ihm fast automatisch.
«Er ist ein ungehobelter Idiot und überhaupt nicht repräsentativ für die Polizei», gab Malm zurück.
«Spricht er wirklich Spanisch?», fragte der Reichspolizeichef skeptisch. «Wo hat er das gelernt?»
«Während seiner Zeit als Seemann war er in verschiedenen spanischsprachigen Ländern unterwegs», erklärte Martin Beck. «Diese Stadt besitzt einen großen Hafen, deshalb wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon einmal dort gewesen sein. Darüber hinaus spricht er übrigens auch fließend Englisch, Französisch und Deutsch. Und ein wenig Russisch. Schau mal in seine Unterlagen, dann wirst du es sehen.»
«Trotzdem ist er ein Idiot», beharrte Stig Malm.
Der Reichspolizeichef sah nachdenklich aus.
«Ich werde mir seine Qualifikationen einmal ansehen», sagte er. «Tatsächlich habe ich selbst schon an ihn gedacht. Es stimmt, er tritt oft grob und unhöflich auf, und er ist viel zu selbstherrlich. Doch man kann nicht leugnen, dass er einer unserer besten Kriminalbeamten ist, auch wenn es ihm schwerfällt, Befehle zu befolgen und sich an die Regeln zu halten.»
Er wandte sich dem Chef des Staatsschutzes zu.
«Was meinst du, Eric? Glaubst du, dass Larsson geeignet wäre?»
«Tja, ich persönlich mag ihn nicht besonders, aber ansonsten habe ich nichts dagegen einzuwenden. Wir brauchen einen erfahrenen Mann und guten Beobachter, und dass Gunvald Larsson Erfahrung hat und außerdem resolut und selbständig ist, kann in diesem besonderen Fall vielleicht sogar von Vorteil sein. Wenn er dann noch die Sprache spricht und das Land von früheren Besuchen her kennt, umso besser.»
Malm sah unzufrieden drein.
«Ich finde, es wäre falsch, ihn zu schicken», sagte er. «Mit seiner tölpelhaften Art wird er die schwedische Polizei in Misskredit bringen. Er benimmt sich wie ein Raufbold und verwendet eine Sprache, die einen eher an einen Hafenarbeiter als an einen ehemaligen Offizier zur See denken lässt.»
«Vielleicht nicht, wenn er Spanisch spricht», gab Martin Beck zu bedenken. «Auch wenn er sich manchmal etwas unflätig ausdrückt, so tut er das doch nicht völlig willkürlich.»
Das stimmte nicht. Erst kürzlich hatte Martin Beck gehört, wie Gunvald Larsson den Kollegen Malm in dessen Gegenwart ein «hochwohlgeborenes Prachtarschloch» genannt hatte, Malm jedoch hatte glücklicherweise gar nicht mitbekommen, dass die Bezeichnung ihm galt.
Der Reichspolizeichef schien jedenfalls nicht auf Malms Einwände anzuspringen.
«Vielleicht ist das gar kein so dummer Vorschlag», sagte er nachdenklich. «Ich glaube nicht, dass sein unhöfliches Auftreten in diesem Fall ein Problem sein wird. Wenn er will, kann er sich durchaus gut benehmen. Sein Hintergrund passt hier eigentlich besser als bei jedem anderen Kollegen. Er kommt aus einer wohlhabenden und kultivierten Familie, was unter anderem mit sich bringt, dass er eine Ausbildung in den denkbar besten Schulen genossen hat und eine Erziehung, die ihm ein korrektes Auftreten in allen erdenklichen Situationen ermöglicht. So etwas sitzt tief, auch wenn er sein Bestes tut, das zu verbergen.»
«Das kann man wohl sagen», murmelte Malm.
Martin Beck ahnte, dass Stig Malm den Auftrag gern selbst angenommen hätte und dass er sauer war, weil man ihn nicht einmal vorgeschlagen hatte. Und dann musste er daran denken, dass es entspannt und angenehm sein würde, Gunvald Larsson eine Weile los zu sein. Bei seinen Kollegen war er nicht gerade beliebt, und er besaß eine erstaunliche Fähigkeit, Streit zu provozieren und Unruhe zu stiften.
Der Reichspolizeichef schien von seiner eigenen Argumentation noch nicht wirklich überzeugt, und Martin Beck sagte aufmunternd:
«Ich denke, wir sollten Gunvald nehmen. Er besitzt alle Qualifikationen, die der Auftrag erfordert.»
«Ich habe schon bemerkt, dass er viel Wert auf sein Aussehen legt», erwiderte der Reichspolizeichef. «Seine Art, sich zu kleiden, lässt auf guten Geschmack und ein Gefühl für Qualität schließen. So etwas macht ohne Frage Eindruck.»
«Ganz genau», pflichtete Martin Beck ihm bei. «Das ist ein wichtiges Detail.»
Ihm war bewusst, dass seine eigene Kleidung kaum geschmackvoll genannt werden konnte. Die Hosen waren ungebügelt und ausgebeult, der Kragen des Polohemdes war nach dem vielen Waschen zu weit und schlabberig geworden, und der Tweedblazer, an dem auch noch ein Knopf fehlte, war abgewetzt.
«Die Mordkommission ist gut besetzt und müsste eigentlich ein paar Wochen ohne Larsson klarkommen», meinte der Reichspolizeichef. «Oder hat einer von euch einen anderen Vorschlag?»
Alle schüttelten den Kopf.
Selbst Malm schien den Vorteil erkannt zu haben, Gunvald Larsson eine Zeitlang los zu sein, während Eric Möller erneut gähnte und zuversichtlich wirkte, dass sich die Sitzung ihrem Ende näherte.
Der Reichspolizeichef erhob sich und klappte die Mappe zu.
«Gut», sagte er. «Dann sind wir ja einer Meinung. Ich werde Larsson unseren Beschluss persönlich mitteilen.»
Gunvald Larsson nahm die Nachricht ohne größeren Enthusiasmus entgegen. Ebenso wenig fühlte er sich von dem Auftrag besonders geschmeichelt.
Sein Selbstbewusstsein war stark und unerschütterlich, und doch entging ihm nicht, dass es Kollegen gab, die erleichtert reagieren würden, wenn er für eine Weile von der Bildfläche verschwand, und bedauerten, dass es nicht für immer war.
Es war ihm bewusst, dass seine Freunde in der Polizeitruppe schnell aufgezählt waren – soweit er wusste, war es nur ein Einziger. Er wusste zudem, dass man ihn als aufsässig und unbequem betrachtete und dass seine Anstellung mehr als einmal an nur einem seidenen Faden gehangen hatte.
Diese Tatsache beunruhigte ihn jedoch nicht im Geringsten.
Jeder andere Polizist in seiner Stellung und mit seinem Gehalt hätte zumindest ein gewisses Unbehagen angesichts der ständigen Gefahr empfunden, suspendiert oder schlichtweg rausgeschmissen zu werden. Aber Gunvald Larsson hatte das noch nicht eine einzige schlaflose Nacht bereitet.
Unverheiratet und ohne Kinder, hatte er niemanden, der von ihm abhängig war. Die Verbindung zu seiner Familie, deren versnobte Oberschichtexistenz er verachtete, hatte er seit langem abgebrochen.
Er machte sich kaum Sorgen um seine Zukunft.
Während seiner Jahre als Polizist hatte er oft die Möglichkeit in Betracht gezogen, in seinen alten Beruf zurückzukehren. Jetzt war er bald fünfzig Jahre alt und sah ein, dass er wahrscheinlich nie wieder zur See fahren würde.
Als der Tag seiner Abreise näher rückte, merkte Gunvald Larsson, dass ihm dieser Auftrag, der wohl als bedeutend angesehen wurde, aber kaum sonderlich schwierig werden würde, durchaus Freude bereitete. Denn er brachte immerhin ein paar Wochen Abwechslung von der täglichen Arbeitsroutine mit sich.
Er begann, sich auf die Reise wie auf einen Urlaub zu freuen.
Am Abend vor der Abreise stand Gunvald Larsson in Unterhose in seinem Schlafzimmer in Bollmora und betrachtete sich in dem großen Spiegel auf der Innenseite der Schranktür.
Er mochte das Muster der Unterhosen, gelbe Elche auf blauem Grund, und besaß noch fünf weitere Paar davon. Ein halbes Dutzend derselben Sorte, allerdings in Grün mit roten Elchen, lag bereits in der großen schweinsledernen Tasche, die mit aufgeklapptem Deckel auf dem Bett stand.
Gunvald Larsson war eins sechsundneunzig groß, ein kräftiger und muskulöser Mann mit großen Händen und Füßen. Er hatte soeben geduscht und war routinemäßig auf die Badezimmerwaage gestiegen, die einhundertzwölf Kilo anzeigte. In den vergangenen vier Jahren, vielleicht waren es auch fünf, war er an die zehn Kilo schwerer geworden. Missgelaunt betrachtete er die Wülste oberhalb des Gummibands der Unterhose.
Er zog den Bauch ein und dachte, dass er vielleicht den Fitnessraum im Polizeipräsidium etwas öfter besuchen oder, wenn das neue Polizeigebäude fertig sein würde, das Schwimmbecken benutzen sollte.
Im Grunde aber war er mit seinem Aussehen sehr zufrieden.
Er war neunundvierzig Jahre alt, aber sein Haar war dick und kräftig, und der Haaransatz war noch nicht so weit zurückgewichen, dass seine niedrige und mit zwei markanten Furchen versehene Stirn stärker hervortrat.
Sein Haar war kurz geschnitten und so blond, dass man die grauen Strähnen nicht sah. Jetzt, da es feucht und frisch gekämmt war, lag es glatt und glänzend an seinem breiten Kopf an. Wenn es hingegen getrocknet war, würde es sich aufrichten und borstig und widerspenstig wirken. Die buschigen Augenbrauen hatten dieselbe helle Farbe wie die Haare, und die Nase mit den großen Nasenlöchern war groß und wohlgeformt, wohingegen die hellen porzellanblauen Augen in dem kräftigen Gesicht eher klein wirkten. Sie standen ein wenig zu dicht beieinander, was ihn manchmal, wenn sein Blick leer und nach innen gewandt war, auf trügerische Weise einfältig erscheinen ließ. War er wütend, und das war er oft, bekam er eine Zornesfalte über der Nasenwurzel, wobei der hellblaue Blick sowohl den härtesten Verbrechern wie auch Untergebenen einen Schreck einjagen konnte. Seine Wutausbrüche waren inzwischen in den sechs Polizeibezirken Stockholms ebenso bekannt wie gefürchtet, genauso wie damals, als er auf See das Kommando innehatte, zwar nicht auf den sieben Weltmeeren, aber doch zumindest bei der Besatzung und den Unteroffizieren.
Im Großen und Ganzen war er, wie gesagt, mit seinem Aussehen zufrieden.
Der Einzige, der niemals Gunvald Larssons Wut zu spüren bekam, war Einar Rönn, Erster Kriminalassistent beim Dezernat für Gewaltdelikte der Stockholmer Polizei und sein einziger Freund. Rönn war ein sanftmütiger und wortkarger Kerl aus Norrland, dem ständig die rote Nase lief, die sein Gesicht derart dominierte, dass man andere Details seines Aussehens kaum wahrnahm. Er trug eine nicht zu stillende Sehnsucht nach seiner Heimat in der Gegend von Arjeplog in Lappland in sich.
Im Unterschied zu Gunvald Larsson war er verheiratet und hatte einen Sohn. Seine Frau hieß Unda und sein Sohn Mats, und er selbst besaß einen Vornamen, den er nur ungern preisgab.
Seine Mutter hatte in ihrer Jugend ein großes Filmidol bewundert und ihren Erstgeborenen Valentino getauft.
Da Gunvald Larsson und Rönn in derselben Abteilung Dienst taten, sahen sie sich fast täglich, außerdem unternahmen sie in ihrer Freizeit vieles gemeinsam. Wenn sie gleichzeitig Urlaub nehmen konnten, fuhren sie nach Arjeplog, wo sie hauptsächlich angelten.
Keiner ihrer Kollegen konnte begreifen, wie diese Freundschaft zwischen zwei derart unterschiedlichen Persönlichkeiten hatte entstehen können. Und viele waren erstaunt darüber, wie Rönn es mit seiner stoischen Ruhe und wenigen Worten fertigbrachte, einen rasenden Gunvald Larsson in ein frommes Lamm zu verwandeln.
Gunvald Larsson inspizierte die Reihe von Anzügen in seinem wohlbestückten Kleiderschrank.
Er kannte das Klima des Landes gut, in dem er zu Gast sein würde, und erinnerte sich an einige erstickend heiße Frühsommerwochen vor vielen Jahren in dieser Hafenstadt. Wenn er die Wärme dort unten überstehen wollte, dann musste er leicht gekleidet sein, und er besaß nur zwei Anzüge, die dafür geeignet waren.
Sicherheitshalber probierte er sie an und stellte zu seinem Ärger fest, dass der eine überhaupt nicht mehr passte und er die Hose zu dem anderen nur noch mit Mühe und tiefem Einatmen zumachen konnte. Außerdem spannte sie über den Oberschenkeln. Das Jackett ließ sich wenigstens ohne Probleme zuknöpfen, allerdings war es an den Schultern ziemlich eng und würde seine Bewegungsfreiheit einschränken oder an den Nähten reißen.
Er hängte den Anzug, der nicht mehr passte, zurück und legte den anderen über die Reisetasche. Der musste reichen. Er hatte ihn sich vor vier Jahren aus dünnem ägyptischem Baumwollstoff – nougatfarben mit schmalen weißen Streifen – schneidern lassen.
In der Tasche lagen außer den Unterhosen bereits Schuhe, Hausschuhe, Toilettensachen, Strümpfe, Taschentücher, Hemden, Schlafanzug und ein seidener Morgenmantel, der ebenso blau war wie seine Augen.
Gunvald Larsson trank selbst keinen Alkohol, aber er hatte eine Flasche Lysholms Linierullad Aquavit gekauft, für den Fall, dass er auf jemanden treffen würde, der Schnaps mochte und ein Geschenk verdient hatte. Er wickelte die Flasche in ein grünes Unterhemd mit roten Elchen und stopfte sie unter die Hemden.
Dann packte er noch drei Khakihosen, eine Jacke aus Schantungseide und den zu engen Anzug ein. In die Innentasche steckte er einen seiner Lieblingsromane, «Die blaue Spur» von Jul Regis.
Dann klappte er den Deckel zu, machte die Messingschnallen der breiten Riemen zu, schloss die Tasche ab und stellte sie in den Flur.
Einar Rönn würde ihn am nächsten Morgen mit dem Auto abholen und zum Flughafen Arlanda bringen, der wie die meisten schwedischen Flugplätze eine sehr triste und schlecht geplante Anlage war, die dem erwartungsfrohen Besucher ein fast noch schlimmeres Zerrbild von Schweden bot, als das Land ohnehin vermittelte.
Seinen eigenen EMW wollte er lieber nicht auf dem Langzeitparkplatz stehen lassen.
Gunvald Larsson warf die blaugelbe Elch-Unterhose in den Wäschekorb im Badezimmer, zog sich seinen Schlafanzug an und ging ins Bett.
Er litt nicht unter Reisefieber und schlief fast sofort ein.
2
Der Sicherheitsexperte reichte Gunvald Larsson kaum bis zum Oberarm, aber er war sehr gut gebaut und sah elegant aus in seinem hellblauen Anzug mit den unten sehr weit geschnittenen und ungeheuer gut gebügelten Hosen. Dazu trug er ein rosafarbenes Hemd, glänzende schwarze, spitze Schuhe, die an einen Torpedo erinnerten, und einen tieflila Seidenschlips. Das Einzige, was den Luxus störte, war das Pistolenholster, das den Anzug unter der linken Achsel ausbeulte. Der Sicherheitsexperte hieß Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga, sein Haar war fast schwarz, die Haut hell mokkafarben und die Augen olivgrün. Er stammte aus einer äußerst vornehmen Familie und rangierte innerhalb des Staatsapparates relativ weit oben. Gunvald Larsson kam ebenfalls aus der Oberschicht, wenn er es auch nicht wahrhaben wollte, doch mit seinen einhundertzwölf Kilo wirkte er unweigerlich eher groß und bullig als fein und vornehm.
Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga breitete den Sicherheitsplan auf der Balustrade aus, aber Gunvald Larsson sah stattdessen an seinem Anzug herunter. Es hatte den Polizeischneider sieben Tage gekostet, ihn umzuarbeiten, aber das Ergebnis war exzellent. In diesem Land bewegte sich nämlich das Schneiderhandwerk immer noch auf hohem Niveau. Die einzige Unstimmigkeit hatte es wegen des ausgesparten Platzes für das Achselholster gegeben, den der Schneider als selbstverständlich vorausgesetzt hatte. Allerdings verwendete Gunvald Larsson niemals Achselholster, sondern trug seine Pistole an einem Clip am Gürtel. Hier im Ausland war er natürlich gar nicht bewaffnet, und den Anzug würde er in Stockholm tragen. Es hatte nur einen kurzen Disput gegeben, und natürlich hatte er seinen Willen durchgesetzt. Das wäre ja auch noch schöner. Mit einem Gefühl tiefster Zufriedenheit betrachtete er seinen in edlen Stoff gehüllten Körper und seufzte genüsslich, bevor er sich der Umgebung widmete.
Sie standen im achten Stock des Hotels, einem mit höchster Sorgfalt ausgewählten Ort. Das Ehrengeleit würde vor dem Balkon vorbeifahren und einen Häuserblock weiter vor dem Provinzpalast halten. Ohne große Begeisterung warf Gunvald Larsson einen höflichen Blick auf den Plan, den er inzwischen schon in- und auswendig kannte. Er wusste, dass der Hafen seit fünf Uhr früh für jeden Verkehr abgeriegelt und der Zivilflughafen seit der Landung der Präsidentenmaschine geschlossen war.
Sie hatten den Hafen und das azurblaue Meer direkt vor sich. Auf der äußeren Reede lagen mehrere große Passagierfähren und Frachter vor Anker. Lediglich ein Kriegsschiff, eine Fregatte und einige Polizeiboote waren im inneren Hafenbecken unterwegs.
Unterhalb ihres Aussichtspunktes lag die von Palmen und Akazien gesäumte Strandpromenade. Genau gegenüber befand sich eine Taxihaltestelle, und dahinter stand eine Reihe farbenfroher Pferdedroschken, die alle sorgfältig kontrolliert worden waren.
Alle Personen in der Umgebung, abgesehen von der Militärpolizei und den Gendarmen, die jeweils eine Armlänge voneinander entfernt entlang beider Seiten der Strandpromenade standen, hatten die Art von Metalldetektoren passieren müssen, mit denen mittlerweile alle größeren Flughäfen ausgestattet waren.
Die Uniformen der Gendarmen waren grün, die der Militärpolizei graublau. Die Gendarmen trugen Stiefel, die Militärpolizisten Schnürschuhe.
Gunvald Larsson unterdrückte ein Seufzen. Er war die Strecke bei der morgendlichen Generalprobe mit abgefahren. Alles war an Ort und Stelle gewesen, nur der Präsident hatte noch gefehlt.
Das Ehrengeleit sah folgendermaßen aus: erst eine Motorrollergruppe aus fünfzehn speziell ausgebildeten Sicherheitspolizisten. Danach ebenso viele Polizisten auf Motorrädern von der gewöhnlichen Schutzpolizei, gefolgt von zwei Autos voller Sicherheitsleute. Dann kam der Wagen des Präsidenten, ein schwarzer Cadillac mit schusssicherem Bleiglas.
Gunvald Larsson hatte als Platzhalter im Fond des Wagens gesessen – ohne Frage eine Ehre.
Dann würde ein offenes Auto mit Sicherheitsleuten folgen, nach amerikanischem Muster auf den Trittbrettern. Und schließlich weitere Motorradpolizisten, Übertragungswagen vom Radio und Autos mit anderen akkreditierten Journalisten im Schlepptau.
Außerdem waren auf dem Weg vom Flughafen Sicherheitsleute in Zivil verteilt.
Ein Detail schien auf jeden Fall gut bekannt.
Alle Laternenpfähle schmückte das Bild des Präsidenten, wobei der Weg ziemlich lang war, um nicht zu sagen sehr lang. Und Gunvald Larsson konnte den stiernackigen Kopf mit dem aufgedunsenen Gesicht und der Brille mit schwarzlackiertem Metallgestell bald nicht mehr sehen.
So weit das Schutzprogramm am Boden.
Der Luftraum wurde auf drei Ebenen von Militärhelikoptern mit drei Maschinen pro Gruppe überwacht.
Darüber hinaus jagte eine Division Starfighter hin und her, um den höheren Luftraum zu schützen.
Das Ganze war von einem Perfektionismus geprägt, der unangenehme Überraschungen ziemlich unvorstellbar machte.
Die Hitze um diese Zeit am Nachmittag war gelinde gesagt drückend.
Gunvald Larsson schwitzte, allerdings nicht übermäßig. Er konnte sich nicht vorstellen, dass hier etwas schieflaufen könnte. Die Vorbereitungen waren ausgesprochen umfassend und sorgfältig durchgeführt und die Planung schon vor Monaten begonnen worden.
Eine Sondergruppe hatte zur Aufgabe gehabt, Fehler in der Planung ausfindig zu machen. Und folgerichtig waren auch einige Korrekturen durchgeführt worden. Dazu kam noch, dass in diesem Land alle Attentatsversuche, und das waren nicht wenige, bisher missglückt waren. Der Reichspolizeichef hatte durchaus recht gehabt, als er sagte, dass man es hier mit den am besten qualifizierten Experten auf dem Gebiet zu tun hatte.
Nachmittags um Viertel vor drei warf Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga einen Blick auf die Uhr und sagte:
«Twenty-one minutes to go, I presume.»
Man hätte keinen Spanisch sprechenden Abgesandten gebraucht. Der Sicherheitsmann drückte sich in einem Oxford-Englisch aus, das in den vornehmsten Clubs von Belgravia absolut passend gewesen wäre.
Gunvald Larsson sah auf seine eigene Uhr und nickte.
In diesem Augenblick war es, um völlig exakt zu sein, dreizehn Minuten und fünfunddreißig Sekunden vor drei am Mittwoch, dem 5. Juni 1974.
Vor der Hafeneinfahrt drehte die Fregatte bei, um einen Willkommenssalut zu schießen, was ihre eigentliche Aufgabe war.
Hoch über der Strandpromenade malten die acht Starfighter weiße Zickzackbänder an den knallblauen Himmel.
Gunvald Larsson sah sich um. In der Verlängerung der Strandpromenade lag eine große, kreisrunde Stierkampfarena aus Ziegelsteinen mit runden rotweißen Arkaden. In der anderen Richtung ließ man gerade die verschieden gefärbten Wasserbögen in einer hohen Fontäne aufschießen. Es hatte das ganze Jahr über eine ungewöhnlich heftige Trockenheit geherrscht, und die Wasserspiele – und nicht nur die – kamen nur bei besonders feierlichen Gelegenheiten zum Einsatz.
Trotz aller sonstigen Unterschiede war dieses Land, ebenso wie Schweden, eine Scheindemokratie, beherrscht von einer kapitalistischen Wirtschaft und zynischen Berufspolitikern, die sich bemühten, den Anschein einer Art von Sozialismus zu erzeugen, aber es war eben nur ein Abziehbild.
Abgesehen von der Zeitverschiebung lagen die auffallendsten Unterschiede in den Religionen und der Tatsache, dass man vor Jahren die republikanische Staatsform eingeführt hatte.
Jetzt waren das Surren der Helikopter und die Sirenen der Motorräder zu hören.
Gunvald Larsson sah erneut auf die Uhr, der Tross schien um einiges vor dem Zeitplan zu liegen. Dann ließ er seinen porzellanblauen Blick über den Hafen gleiten und bemerkte, dass jetzt alle Polizeiboote in Bewegung waren. Die Hafenanlage selbst war im Großen und Ganzen unverändert, seit er als Seemann hier gewesen war, nur die Schiffe auf der Reede waren völlig andere. Supertanker, Containerschiffe, selbstlöschende und kistenförmige Gebilde nach dem Roll-on-Roll-off-Prinzip und große Fähren, auf denen die Autos eine wichtigere Rolle spielten als die Passagiere – das waren Erscheinungen, die er während seiner Zeit auf See nicht kennengelernt hatte.
Natürlich war Gunvald Larsson nicht der Einzige, dem auffiel, dass die Entwicklung der Ereignisse vor dem festgelegten Zeitschema lag.
Cassavetes y Larrinaga sprach schnell, aber ruhig und präzise in sein Funksprechgerät, während man vor der Hafeneinfahrt auf der Fregatte verstärkte Aktivität bemerken konnte.
Dies ließ Gunvald Larsson an zwei völlig verschiedene Dinge denken. Zum einen fand er, dass sein Spanisch ziemlich eingerostet war, und zum anderen stellte er fest, dass es abgesehen von der enormen polizeilichen Stärke nur drei Länder in der Welt gab, in denen man pro Einwohner mehr für militärische Zwecke ausgab als in Schweden, nämlich in Israel und den beiden Supermächten USA und der Sowjetunion.
Nachdem Cassavetes y Larrinaga sein Gespräch über Funk beendet hatte, lächelte er seinem blonden Gast zu und sah zu den kunstvollen Wasserspielen hinüber, wo die erste Motorradgruppe mit den speziell ausgebildeten Sicherheitspolizisten bereits zwischen den Reihen der grünuniformierten Gendarmen auftauchte.
Gunvald Larsson wandte den Blick zur anderen Seite. Direkt unter ihnen schlenderte mitten auf der Straße ein Sicherheitsmann herum. Er rauchte eine Zigarre und war offenbar damit beschäftigt, die Scharfschützen zu kontrollieren, die auf den umliegenden Hausdächern platziert waren. Hinter der Reihe der Gendarmen standen die schwarzen Taxis mit blauem Band an den Seiten und vor ihnen eine offene gelbschwarze Pferdedroschke. Der Mann auf dem Kutschbock war ebenfalls in Gelb und Schwarz gekleidet, und das Pferd trug gelbschwarze Federbüsche am Stirnband.
Dahinter standen Palmen und Akazien sowie mehrere Neugierige, wobei einige wenige das einzige Schild hochhielten, das von den Behörden genehmigt worden war, nämlich ein Bild von dem stiernackigen Kopf mit dem aufgedunsenen Gesicht und der Brille mit dem schwarzlackierten Metallgestell. Der Präsident war kein sonderlich beliebter Gast.
Das wussten alle, er selbst vermutlich auch.
Der Tross bewegte sich jetzt sehr schnell. Die ersten Wagen befanden sich bereits unterhalb des Balkons.
Der Sicherheitsexperte lächelte Gunvald Larsson zu, nickte beruhigend und begann, seine Papiere zusammenzufalten.
Genau in diesem Augenblick tat sich der Erdboden auf, und zwar im Grunde mitten unter dem schusssicheren Cadillac.
Die Druckwelle warf die beiden Männer nach hinten, aber wenn Gunvald Larsson irgendetwas war, dann war er stark. Er packte die Balustrade ganz fest mit beiden Händen und sah nach oben.
Die Straße war wie ein Vulkan aufgebrochen, aus dem nun eine fünfzig Meter hohe rauchende Feuersäule aufstieg.
Ganz oben tanzten diverse Gegenstände.
Besonders auffällig war der hintere Teil des schusssicheren Cadillacs, ein auf dem Kopf stehendes schwarzes Taxi mit blauem Band an den Seiten und ein zerfetztes Pferd mit gelbschwarzen Federbüschen am Stirnband, ein menschliches Bein in einem schwarzen Stiefel mit grünem Uniformstoff und ein Arm mit einer langen Zigarre zwischen den Fingern.
Gunvald Larsson wandte das Gesicht ab, als mehr oder weniger brennbare Gegenstände auf ihn herabzuregnen begannen. Er dachte gerade an seinen neuen Anzug, als ihn etwas mit voller Wucht auf die Brust traf und rückwärts auf die Marmorplatten des Balkons warf.
Er tat sich nicht weh, jedenfalls nicht sehr.
Der Lärm der Explosion nahm nach ungefähr einer Minute ab, und man konnte Jammern, verzweifelte Hilferufe und sogar Weinen und hysterisches Fluchen vernehmen, ehe die menschlichen Laute von Krankenwagensirenen und dem Heulen eines Feuerwehrautos übertönt wurden.
Gunvald Larsson stand auf, um nachzuschauen, was ihn zu Fall gebracht hatte.
Der Gegenstand lag vor seinen Füßen. Er sah einen Stiernacken und ein aufgedunsenes Gesicht, erstaunlicherweise saß die Brille mit dem schwarzlackierten Metallgestell noch an Ort und Stelle.
Der Sicherheitsexperte kam ebenfalls auf die Füße, offenkundig unbeschadet, wenn auch ein Teil der Eleganz verschwunden war.
Ungläubig starrte er auf den Kopf vor ihnen und bekreuzigte sich.
Gunvald Larsson betrachtete seinen Anzug, der nicht einmal mehr diesen Namen verdiente.
«Verdammt», sagte er.
Dann besah er sich den Kopf zu seinen Füßen.
«Vielleicht sollte man den mit nach Hause nehmen», sagte er zu sich selbst, «als Souvenir.»
Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga sah seinen Gast fragend an.
Das Wort Souvenir hatte er zumindest verstanden. Vielleicht waren die Schweden ja Kopfjäger.
«Catastrofe», sagte er.
«Ja, das kann man wohl sagen», meinte Gunvald Larsson.
Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga sah dermaßen unglücklich aus, dass Gunvald Larsson sich zu einem weiteren Kommentar veranlasst sah:
«Aber es kann Ihnen niemand einen Vorwurf machen. Außerdem hatte der Mann einen außergewöhnlich hässlichen Kopf.»
3
Am selben Tag, als Gunvald Larsson seine seltsamen Erlebnisse auf dem Balkon mit der schönen Aussicht hatte, stand in Stockholm ein Mädchen namens Rebecka Lind wegen bewaffneten Bankraubs vor Gericht.
Sie war achtzehn Jahre alt und hatte nicht die geringste Ahnung von den Dingen, mit denen Gunvald Larsson sich momentan beschäftigte. Wenn jemand ihr die Stadt genannt hätte, in der er sich im Augenblick befand, hätte sie sie nicht gekannt. Sie hatte auch noch nie etwas von dem Land gehört, in dem sie lag, und ebenso wenig kannte sie die hochgestellte Persönlichkeit, die gerade den Kopf verloren hatte. Ebenso wusste sie nicht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten immer noch Nixon hieß.
Dafür wusste sie vieles andere, aber das gehörte sozusagen nicht hierher.
Der Staatsanwalt in dem Fall war Bulldozer Olsson, seit vielen Jahren Experte in Sachen bewaffneter Bankraub, einem Phänomen, das sich wie die Pest über das Land verbreitete.
Er war ein ungeheuer vielbeschäftigter Mann, der so wenig Zeit zu Hause verbrachte, dass es drei Wochen gedauert hatte, bevor er bemerkte, dass seine Frau ihn ein für alle Mal verlassen hatte und ihr Kopf auf dem Kissen durch eine lakonische Nachricht ersetzt worden war. Das machte nun keinen größeren Unterschied, denn er war schnelles Agieren gewohnt und hatte sich innerhalb von drei Tagen eine neue Frau besorgt. Seine neue Lebensgefährtin war eine seiner Sekretärinnen, die ihn rückhaltlos und hingebungsvoll bewunderte, und tatsächlich wirkten seine Anzüge seit diesem Tag etwas weniger zerknittert.
Obwohl er es immer eilig hatte, bemaß er seine Zeit nach eigenem Gutdünken stets dermaßen knapp, dass er auch dieses Mal völlig außer Atem erst zwei Minuten vor Beginn der Hauptverhandlung erschien. Er war ein korpulenter, aber leichtfüßiger, kleiner Mann mit heiterem Auftreten und lebendigen Bewegungen. Außerdem trug er immer schweinchenrosa Hemden und Schlipse von einer derartigen Geschmacklosigkeit, dass sie Gunvald Larsson zu der Zeit, als er in Bulldozers Spezialeinheit arbeitete, fast zum Wahnsinn getrieben hätten. Übrigens waren dort auch Einar Rönn und Lennart Kollberg tätig gewesen, doch das lag schon einige Jahre zurück. Und Kollberg war inzwischen nicht einmal mehr Polizist. Bulldozer glaubte an schnelle Wechsel und frisches Blut unter seinen Mitarbeitern.
Er sah sich in dem kahlen und schlecht geheizten Vorraum des Gerichtssaals um und entdeckte eine Gruppe von fünf Personen, darunter seine eigenen Zeugen und eine Person, deren Gegenwart ihn äußerst erstaunte, nämlich den Chef der Reichsmordkommission.
«Was in aller Welt machst du denn hier?», fragte er Martin Beck.
«Ich bin als Zeuge berufen worden.»
«Von wem denn?»
«Von der Verteidigung.»
«Von der Verteidigung? Wer ist das?»
«Rechtsanwalt Braxén», erwiderte Martin Beck. «Er ist offenbar als Pflichtverteidiger ausgelost worden.»
«Blabla-Braxén!», rief Bulldozer bestürzt. «Ich habe heute schon drei Sitzungen und zwei Haftprüfungstermine gehabt, und jetzt soll ich also hier sitzen und für den Rest des Nachmittags Blabla-Braxén zuhören?»
«Informierst du dich denn vorher nicht, wer der Verteidiger ist? Und was hast du überhaupt bei dem Haftprüfungstermin gemacht?»
«Das ist bei solchen Fällen nur Routine», erwiderte Bulldozer. «Bei diesem hier hat es nur drei Minuten gedauert, und eine Verteidigung war nicht zugegen. Das war auch nicht nötig.»
Er eilte zu einem seiner Zeugen und begann in seinem Aktenkoffer zu wühlen, ohne die Papiere zu finden, die er suchte.
Martin Beck dachte, dass Bulldozer und Braxén sich in einigen Punkten recht ähnlich waren. Beide pflegten plötzlich zu verschwinden, während man mit ihnen redete, doch während Bulldozer das in rein physischer Hinsicht tat, indem er mit einem Mal aus der Tür rauschte, entfernte sich Braxén mental. Oft glaubte man, er befinde sich in einer anderen Welt.
Der Staatsanwalt ließ seinen Zeugen mitten in einem Satz stehen und kehrte zu Martin Beck zurück.
«Weißt du was über diese Geschichte?», fragte er.
«Nicht sonderlich viel, aber Braxéns Argumente waren so einleuchtend, dass ich das Gefühl hatte, herkommen zu müssen. Außerdem habe ich momentan nichts, was meine besondere Aufmerksamkeit erfordern würde.»
«Ihr bei der Mordkommission wisst ja gar nicht, was wirkliches Arbeiten bedeutet», meinte Bulldozer Olsson. «Ich selbst habe aktuell neununddreißig Ermittlungen laufen und ebenso viele, die auf Eis liegen. Komm mal bei mir vorbei, du würdest Augen machen.»
«Nein danke», entgegnete Martin Beck. «Nicht dass ich mich vor Arbeit fürchten würde, aber trotzdem, nein danke.»
«Schade», antwortete Bulldozer. «Manchmal denke ich, dass ich den besten Job innerhalb dieser Gerichtsmaschinerie habe. Unglaublich interessant und spannend. Jeden Tag neue Überraschungen und …»
Er hielt inne.
«So wie jetzt diese Sache hier mit Blabla-Braxén.»
Bulldozer Olsson gewann mit wenigen Ausnahmen alle seine Verfahren. Das Freundlichste, was man dazu noch sagen konnte, war, dass dies nicht sonderlich schmeichelhaft für das Rechtswesen war.
An die am wenigsten freundliche Variante mochte man gar nicht erst denken.
«Aber du kriegst einen netten Nachmittag geboten», sagte Olsson. «Braxén ist sicher gut in Form.»
«Ich bin nicht zum Spaß hier», entgegnete Martin Beck.
Das Gespräch wurde unterbrochen, als der Fall aufgerufen wurde. Alle Beteiligten, mit einer wichtigen Ausnahme, betraten den Gerichtssaal, der sich im Hauptgebäude des Gerichts befand und alles andere als einladend war. Die Fenster waren groß und majestätisch, was zwar auf keine Weise entschuldigte, aber vielleicht erklärte, dass sie offenkundig seit langer Zeit nicht geputzt worden waren.
Der Richter, der Beisitzer und sieben Schöffen starrten von einem Podium mit einem langen zusammenhängenden Katheder feierlich in den Saal.
Ein leichter blassblauer Schleier in einem der vor Staub flimmernden Sonnenstrahlen verriet, dass jemand kurz zuvor eine Zigarette ausgemacht hatte.
Die Angeklagte wurde durch eine kleine Seitentür hereingeführt. In ihrer Begleitung war eine grimmig aussehende Frau um die fünfzig in einem Kleid, das an eine Uniform erinnerte. Das Mädchen hatte schulterlanges, helles Haar, einen mürrischen Mund und braune Augen, die immer wieder in die Ferne schweiften. Sie trug ein bodenlanges, hellgrünes, besticktes Kleid aus einem leichten und dichten Stoff und an den Füßen schwarze Holzschuhe.
Das Gericht saß schon von Anfang an, die Übrigen blieben bis auf weiteres stehen.
Der Richter begann mit monotoner Stimme, den Fall zu erläutern, wandte sich dann an das Mädchen, das links von der Richterbank saß, und sagte:
«Angeklagt in dem Verfahren ist Rebecka Lind. Sind Sie Rebecka Lind?»
«Ja.»
«Könnte die Angeklagte bitte etwas lauter sprechen.»
«Ja.»
Der Richter sah in seine Unterlagen. Schließlich sagte er:
«Haben Sie noch andere Vornamen?»
«Nein.»
«Und Sie sind am 3. Januar 1956 geboren?»
«Ja.»
«Ich muss die Angeklagte bitten, etwas lauter zu sprechen.»
Er tat so, als müsste man das in allen Gerichtsverhandlungen routinemäßig sagen. Das war auch tatsächlich der Fall, da die Akustik im Gerichtssaal ausgesprochen schlecht war. Außerdem waren die Angeklagten es oft nicht gewohnt, sich bei offiziellen Angelegenheiten zu äußern, und die finstere und bedrückende Umgebung, der sie hier begegneten, ließ sie noch kleinlauter werden. Der Richter fuhr fort:
«Die Seite der Anklage wird von Oberstaatsanwalt Sten Robert Olsson vertreten.»
Bulldozer reagierte überhaupt nicht, sondern blätterte, ohne zu bemerken, was vor sich ging, in einer seiner Akten.
«Ist Oberstaatsanwalt Sten Robert Olsson zugegen?», fragte der Richter tonlos, obwohl er den Genannten schon Hunderte von Malen gesehen hatte.
Bulldozer zuckte zusammen, er war es nicht gewohnt, bei seinem richtigen Namen genannt zu werden.
«Ja, natürlich», sagte er eifrig. «Ich bin hier.»
«Gibt es einen Vertreter der Nebenkläger?»
«Es sind keine Forderungen aufseiten der Nebenkläger gestellt worden», sagte Bulldozer.
«Die Angeklagte wird von Rechtsanwalt Hedobald Braxén vertreten.»
Es wurde still, und alle sahen sich um. Der Gerichtsdiener schaute in den Vorraum hinaus. Blabla-Braxén hatte sich noch nicht gezeigt.
«Rechtsanwalt Braxén hat sich anscheinend verspätet», vermeldete der Beisitzer nach einer Weile.
Dann führte er murmelnd ein Gespräch mit dem Richter, woraufhin dieser verkündete:
«Dann können wir ja so lange die Zeugen aufrufen. Die Anklage hat zwei Zeugen berufen, die Bankkassiererin Kerstin Franzén und den Polizeimeister Kenneth Kvastmo.»
Beide erklärten sich anwesend.
«Die Verteidigung hat folgende Personen als Zeugen benannt: Kriminalkommissar Martin Beck, Polizeimeister Karl Kristiansson, Bankdirektor Rumford Bondesson und die Hauswirtschaftslehrerin Hedy-Marie Wirén.»
Alle erklärten ihre Anwesenheit.
Kurz darauf sagte der Richter:
«Der Anwalt der Verteidigung hat auch Direktor Walter Petrus als Zeugen berufen, dieser hat allerdings erklärt, er sei verhindert und habe mit der Sache nichts zu schaffen.»
Einer der Schöffen kicherte.
«Die Zeugen mögen nun den Gerichtssaal verlassen.»
So geschah es. Die beiden Polizisten, die bei solchen Gelegenheiten immer Uniformhosen und schwarze Schuhe und mehr oder weniger phantasielose Blazer trugen, sowie Martin Beck, der Bankdirektor, die Hauswirtschaftslehrerin und die Bankkassiererin trotteten in den Vorraum zurück.
Im Saal befanden sich somit – abgesehen vom Gericht – noch die Angeklagte, die Vollzugsbeamtin aus dem Gefängnis und eine Zuhörerin.
Bulldozer Olsson studierte eifrig seine Akten, doch nicht mehr als zwei Minuten lang, dann sah er neugierig zu der Zuhörerin, eine Frau, die nach seiner Schätzung ungefähr fünfunddreißig war. Sie saß in einer der Bänke und hatte einen Stenoblock aufgeschlagen. Sie war klein, vielleicht gerade mal eins sechzig, und hatte blondes, ganz glattes Haar, das nicht besonders lang war. Ihre Kleidung bestand aus ausgewaschenen Jeans und einem Hemd von unbestimmter Farbe. Sie trug Riemensandalen und hatte breite, sonnenverbrannte Füße mit geraden Zehen. Ihre flachen Brüste mit den großen Brustwarzen zeichneten sich deutlich unter dem Stoff des Hemdes ab.
Am bemerkenswertesten war ihr etwas kantiges Gesicht mit einer kräftigen Nase und einem durchdringenden blauen Blick, den sie der Reihe nach auf die Anwesenden richtete, wobei er besonders lange auf der Angeklagten und Bulldozer Olsson verweilte. Bei Letzterem wurde ihr Blick so durchdringend, dass der Staatsanwalt sich schließlich erhob, ein Glas Wasser holte und sich auf einen Platz hinter ihr setzte. Sie drehte sich sogleich um und fing seinen Blick auf.
Sexuell gesehen war sie überhaupt nicht sein Typ, wenn er überhaupt einen bevorzugte, aber er war sehr neugierig, zu erfahren, wer sie sein könnte. Jetzt, von hinten, konnte er sehen, dass sie kompakt gebaut war, ohne jedoch in irgendeiner Weise rundlich zu wirken.
Schließlich hielt er ihren Blick nicht länger aus, deutete an, dass er ein wichtiges Telefongespräch zu erledigen habe, und bat darum, den Saal verlassen zu dürfen. Er ging – neugieriger denn je – mit federndem Gang hinaus.
Wenn er Martin Beck gefragt hätte, der in einer Ecke des Vorraums herumhing, hätte er vielleicht eine Menge erfahren.
Zum Beispiel, dass sie nicht fünfunddreißig Jahre alt war, sondern neununddreißig, dass sie ein sehr umfassendes soziologisches Examen abgelegt hatte und derzeit in der Sozialfürsorge arbeitete.
Martin Beck wusste nämlich ziemlich viel über sie, allerdings handelte es sich dabei um Informationen, die er kaum preisgeben würde, denn die meisten waren persönlicher Natur.
Möglicherweise hätte er aber, wenn er gefragt worden wäre, ihren Namen genannt. Rhea Nielsen.
Bulldozer erledigte seine Telefongespräche in weniger als fünf Minuten. Seinen Gesten nach zu urteilen, erteilte er verschiedene Instruktionen.
Später im Gerichtssaal ging er seufzend auf und ab, setzte sich schließlich und blätterte in seinen Papieren. Die Frau mit dem durchdringenden Blick betrachtete jetzt nur noch die Angeklagte.
Bulldozer platzte fast vor Neugier. Während der folgenden zehn Minuten erhob er sich sechsmal und trippelte kurz durch den Gerichtssaal. Einmal holte er ein riesiges Taschentuch heraus und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Alle anderen saßen still auf ihren Plätzen.
Zweiundzwanzig Minuten nach der festgelegten Zeit flog die Tür auf, und Braxén trat ein. Er hielt eine brennende Zigarre in der einen und seine Unterlagen in der anderen Hand. Phlegmatisch studierte er die Akten, und der Richter musste sich dreimal bedeutungsvoll räuspern, bis er seine Zigarre zerstreut dem Gerichtsdiener überließ, damit dieser sie aus dem Saal entfernen konnte.
«Rechtsanwalt Braxén ist jetzt eingetroffen», sagte der Richter säuerlich. «Dürfen wir fragen, ob noch irgendetwas dagegen spricht, jetzt mit der Hauptverhandlung anzufangen?»
Bulldozer schüttelte den Kopf.
«Nein, absolut nicht. Nicht von meiner Seite.»
Braxén reagierte nicht, auch wenn er die Geschehnisse im Gerichtssaal verfolgte.
Nach einer Weile schob er sich die Brille auf die Stirn und sagte:
«Auf dem Weg zum Gerichtsgebäude wurde mir plötzlich klar, dass der Herr Staatsanwalt und ich alte Bekannte sind. Tatsache ist, dass er vor genau fünfundzwanzig Jahren auf meinem Schoß saß. So geschehen übrigens in Borås. Der Vater des Staatsanwalts war dort Rechtsanwalt, und ich hatte mein Referendariat abzuleisten. Zu jener Zeit setzte ich große Hoffnungen in meinen Beruf. Aber ich kann nicht behaupten, dass diese sich erfüllt hätten. Wenn man die Entwicklung der Rechtsprechung in anderen Ländern betrachtet, gibt es wirklich nicht viel, worauf wir stolz sein können. Ich erinnere mich an Borås als eine schreckliche Stadt, aber der Staatsanwalt war ein lebhafter und netter Junge. Am besten erinnere ich mich allerdings an das Stadshotel oder wie das hieß. Kaffee und Kuchen und staubige Palmen. Essensmarken, wobei man das Essen nur in Ausnahmefällen tatsächlich kriegte. Und wenn man es bekam, hätte es einer Hyäne die Haare zu Berge stehen lassen. Nicht einmal ein Rentner in unserer heutigen Gesellschaft hätte das als Menschennahrung durchgehen lassen. Das Tagesgericht war Fischauflauf, und von morgens bis abends wurde immer dasselbe Essen herein- und wieder hinausgetragen. Einmal hatte ich einen Zigarrenstumpen in meiner Portion. Aber wenn ich es recht bedenke, war das in Enköping. Wussten Sie übrigens, dass Enköping das beste Trinkwasser von ganz Schweden hat? Das wissen nicht viele Leute. Jeder Mensch, der hier in der Hauptstadt aufgewachsen ist, ohne Alkoholiker oder Drogenabhängiger zu werden, muss von ungewöhnlicher Charakterstärke sein.»
«Gibt es irgendwelche Einwände, nicht mit der Hauptverhandlung zu beginnen?», fragte der Richter geduldig.
Braxén erhob sich und trat in die Mitte des Saales.
«Meine Familie und ich gehören natürlich zu dieser Kategorie», meinte er kleinlaut.
Er war entschieden älter als die meisten im Raum, ein gebieterischer Mann mit einem beeindruckenden Bauch. Darüber hinaus war er auffällig schlecht und altmodisch gekleidet, und eine nicht allzu verwöhnte Katze hätte von seiner Weste frühstücken können. Nach einigen Minuten des Wartens, während deren er Bulldozer mit einem eigentümlichen Blick fixierte, sagte er:
«Abgesehen von der Tatsache, dass dieses kleine Mädchen niemals vor Gericht hätte gebracht werden dürfen, liegen keine rechtlichen Hindernisse vor. Rein technisch gesehen.»
«Einspruch!», rief Bulldozer.
«Rechtsanwalt Braxén kann sich seine Kommentare für später aufheben», sagte der Richter. «Wenn der Staatsanwalt nun bitte mit seinen Ausführungen beginnen würde.»
Bulldozer schoss von seinem Stuhl hoch und fing an, mit gesenktem Kopf um den Tisch zu marschieren, auf dem seine Akten lagen.
«Ich behaupte, dass Rebecka Lind am Mittwoch, dem 22. Mai dieses Jahres, einen bewaffneten Raubüberfall auf die Zweigstelle der PK-Bank in Midsommarkransen verübt hat und sich im Anschluss des Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig gemacht hat, indem sie sich gewaltsam gegen die Beamten, die sie festnehmen wollten, zur Wehr setzte.»
«Was sagt die Angeklagte?»
«Die Angeklagte ist unschuldig», erwiderte Braxén. «Und somit ist es meine Pflicht, dieses ganze … Gerede zurückzuweisen.»
Er wandte sich Bulldozer zu und meinte wehmütig:
«Was ist das für ein Gefühl, unschuldige Menschen zu verfolgen? Wenn ich an Sie als kleinen Jungen denke, fällt es mir schwer, zu begreifen, welcher – nun ja, nennen wir es einmal Arbeit – Sie heute nachgehen.»
Bulldozer schien beglückt. Er schwebte auf Braxén zu und sagte:
«Ich erinnere mich auch an jene Zeit in Borås. Vor allem daran, dass der damalige Referendar Braxén immer nach Zigarrenrauch und schlechtem Kognak stank.»
«Meine Herren», warf der Richter ein, «hier ist weder die Zeit noch der Ort für persönliche Erinnerungen. Rechtsanwalt Braxén bestreitet somit die Behauptungen der Anklage.»
«Wenn der Kognakduft nicht eine Frucht der Phantasie des Staatsanwalts ist, so dürfte er von seinem Vater herrühren», sagte Braxén. «Außerdem ist die Angeklagte unschuldig. Und das ist das letzte Mal, dass ich diesen Ausdruck verwende. Dieses junge Mädchen …»
Er kehrte zum Tisch zurück und wühlte in seinen Unterlagen.
«Rebecka Lind ist ihr Name», flocht Bulldozer hilfsbereit ein.
«Danke, mein Junge», sagte Braxén. «Rebecka Lund …»
«Lind», verbesserte Bulldozer.
«Rebecka ist ebenso unschuldig wie die Mohrrüben im Acker.»
Alle schienen über diese ungewöhnliche Bildsprache nachzusinnen. Schließlich sagte der Richter:
«Das ist ja wohl Sache des Gerichts, darüber zu urteilen, nicht wahr?»
«Leider», erwiderte Braxén.
«Was bezweckt der Herr Rechtsanwalt mit diesem Kommentar?», fragte der vorsitzende Richter mit einer gewissen Schärfe.
Daraufhin meinte Braxén:
«Leider ist es unmöglich, das ganze dahinterliegende Muster zu entwirren, denn dann würde sich der Prozess über Jahre hinziehen.»
Alle waren zutiefst bestürzt angesichts dieser Aussicht.
Braxén fuhr fort:
«Doch der Vorschlag des Vorsitzenden, dass ich meine Memoiren schreiben sollte, klingt interessant.»
«Habe ich je etwas Derartiges vorgeschlagen?», fragte der Richter entsetzt und war jetzt völlig aus der Fassung.
«Während eines langen Lebens in verschiedenen Gerichtssälen, in denen angeblich Recht gesprochen wird, kann man viele Erfahrungen sammeln», erklärte Braxén. «Außerdem war ich als junger Mann eine Weile in Südamerika, wo ich mich mit Meiereierzeugnissen beschäftigte. Meine Mutter, die alte Dame, lebt immer noch, und sie ist der Ansicht, dass dieser Milchjob in Buenos Aires die einzige ehrenhafte Arbeit war, der ich je nachgegangen bin. Übrigens hörte ich kürzlich, dass der Vater des Staatsanwalts trotz hohen Alters und zunehmenden Alkoholkonsums jeden Tag einen kleinen Spaziergang entlang des Flusses in Örebro unternimmt, wohin die Familie wohl in den vierziger Jahren gezogen ist. Mit den modernen Fortbewegungsmitteln ist es von Buenos Aires nicht weit zu den neuen Staaten in Afrika. Vor kurzem hat ein ungeheuer interessantes Buch über Kongo-Kinshasa meine Aufmerksamkeit erregt …»