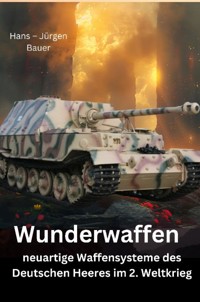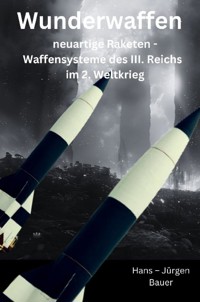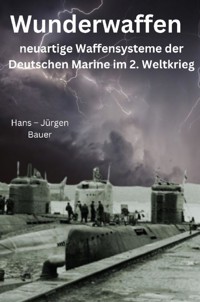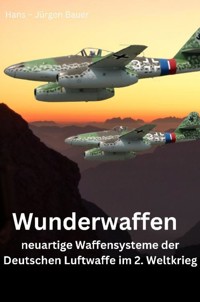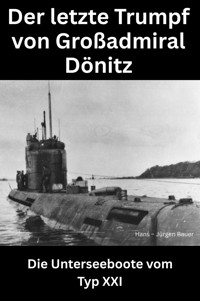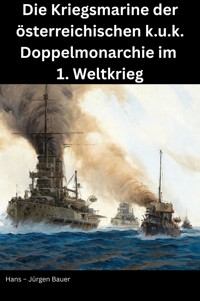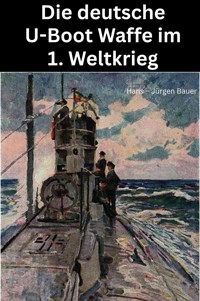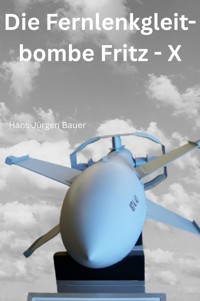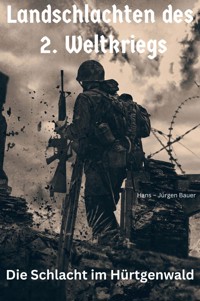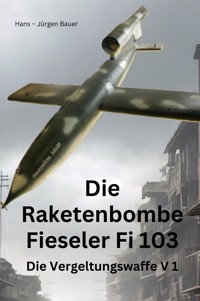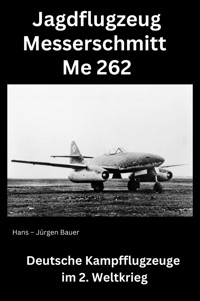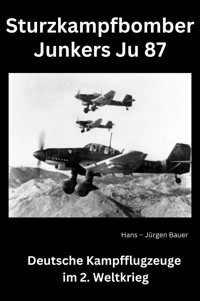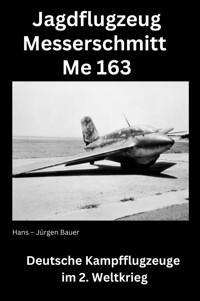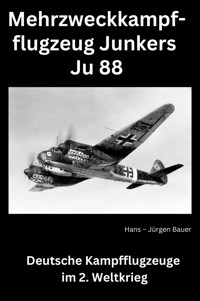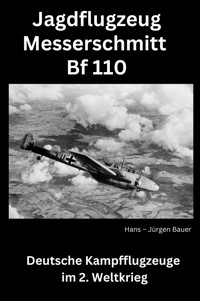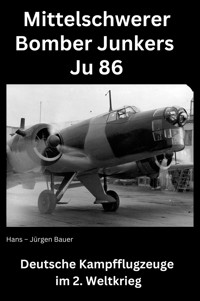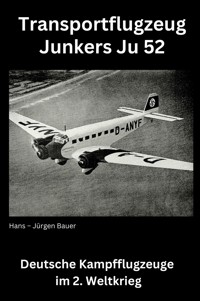Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Des Kaisers Platz an der Sonne: die Kolonie Kamerun Die deutschen Kolonien (offiziell Schutzgebiete genannt) wurden vom Deutschen Reich ab den 1880er Jahren erworben und es bestand aus den überseeischen Kolonien, Dependenzen und Territorien des Deutschen Reiches. Bereits vor der Reichsgründung im Jahr 1871 hatte es kurzlebige Kolonisierungsversuche einzelner deutscher Staaten gegeben, aber Bismarck widerstand dem Druck, ein Kolonialreich zu errichten, bis zum "Scramble for Africa" im Jahr 1884. Deutschland beanspruchte einen Großteil der noch nicht kolonisierten Gebiete Afrikas und errichtete im Lauf der Zeit das drittgrößte Kolonialreich nach Großbritannien und Frankreich. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 verlor Deutschland die Kontrolle über den größten Teil seines Kolonialreichs, aber einige deutsche Truppen hielten sich bis zum Ende des Krieges in Deutsch-Ostafrika. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde das deutsche Kolonialreich im Rahmen des Versailler Vertrags von den Alliierten offiziell beschlagnahmt. Jede Kolonie wurde ein Völkerbundmandat unter der Verwaltung, wenn auch nicht unter der Souveränität, einer der alliierten Siegermächte. In diesem Buch wird die Geschichte der Kolonie Kamerun behandelt. Umfangreiche Hintergrundinformationen und zeitgenössisches Bildmaterial zeichnen dieses Werk aus. Umfang: 141 Seiten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Des Kaisers Platz an der Sonne
Die Kolonie Kamerun
IMPRESSUM:
Autor: Hans-Jürgen BauerHerausgeber:M. PrommesbergerHändelstr 1793128 Regenstauf
Die Deutsche Kolonie Kamerun
Hauptstadt: Berlin, Deutsches Reich
Verwaltungssitz: 1884–1901: Duala
1901–1915: Buea
1915–1916 Jaunde
Verwaltungsorganisation: 16 Bezirke, 1–2 Residenturen,
2 Residenturbezirke
Oberhaupt der Kolonie: 1884/88: Kaiser Wilhelm I.
1888: Kaiser Friedrich III.
1888/99: Kaiser Wilhelm II.
Einwohner: Altkamerun: 2.600.000
Neukamerun: ca. 2.000.000
davon Europäer:1897: 253 (181 Deutsche),
1912: 1900 (1.000 Deutsche)
Währung: Goldmark
Besitzergreifung: 1884–1916
Heutige Gebiete: Altkamerun; östlicher Rand Nigerias
Neukamerun: Teile von Gabun, der Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik und der Republik Tschad
Kamerun war von 1884 bis 1919 eine deutsche Kolonie (auch Schutzgebiet). Die Kolonie hatte anfangs eine Fläche von 495.000 km², nach der Angliederung Neukameruns im Jahre 1911 hatte sie eine Fläche von 790.000 km² und war damit etwa 1,3-mal so groß wie das Mutterland. Durch den Versailler Vertrag von 1919 ging Kamerun offiziell in den Besitz des Völkerbundes über, der wiederum ein Mandat zur Verwaltung an die Briten und Franzosen gab. Daraufhin wurde Kamerun in ein Britisch-Kamerun und ein Französisch-Kamerun aufgeteilt.
Inbesitznahme
Deutsche Kolonie
Britisches Kamerun nach dem Ersten Weltkrieg
Französisches Kamerun nach dem Ersten Weltkrieg
unabhängiges Kamerun seit 1960
Urheber: Roke
Seit 1862 waren deutsche Handelshäuser in Gabun tätig, darunter das Hamburger Haus Woermann, dessen Agent Emil Schulz zugleich als kaiserlicher Konsul mit Amtsbefugnissen bis zum Kamerunästuar fungierte. Das Kamerunästuar (engl. Wouri estuary, auch Cameroon estuary) bezeichnet einen Ästuar der von einem Mündungsdelta mehrerer Zuflüsse bei Douala zu einer „sechslappigen Bucht“ übergeht. Er liegt in der Region der Bucht von Biafra, die seit 1970 dem Namen Bucht von Bonny trägt. Die Bezeichnung ist in zeitgenössischer Literatur zu Deutschen Schutzgebieten in Afrika gebräuchlich. Im Jahre 1868 errichtete Woermann die erste deutsche Faktorei in Douala.
Urheber: Aymatth2
Der Afrikahandel von C. Woermann
Die Firma C. Woermann, die Adolph Woermann übernahm, hatte ursprünglich mit westfälischen Leinen in Afrika gehandelt. Später war sie dazu übergegangen hauptsächlich Branntwein, Waffen und Pulver aus dem Deutschen Reich gegen Palmöl und Kautschuk zu tauschen. Diese Tauschgeschäfte, insbesondere der Branntweinhandel, der unter Adolph Woermann stark ausgeweitet wurde, waren sehr umstritten und mehrmals Thema im Reichstag. Adolf Stoecker brachte am 14. Mai 1889 einen Antrag ein, der sich ausschließlich mit dem Verbot oder Einschränkung des Branntweinexportes nach Westafrika befasste. Woermann verwies in der Debatte darauf, dass Branntweinbrennereien in Afrika kritisiert würden, obwohl sie gleichzeitig in Deutschland als „etwas so Nützliches“ gälten, und äußerte sich weiter:
„Es ist dieser Branntweinhandel in Afrika von einer Reihe von anderen Nationen, ja von fast allen anderen Nationen mit der allergrößesten Eifersucht angesehen. Es ist das der Punkt gewesen, wodurch sich die Deutschen überhaupt in den Handel in Westafrika haben hineinbohren können und sich so fest in den Handel Afrikas hineinsetzen konnten, daß sie jetzt eine ganz bedeutende Macht dort haben, und daß der deutsche Handel in Westafrika eine ganz bedeutende Rolle spielt, ...“
– Adolph Woermann: Reichstagsprotokoll, 67. Sitzung vom 14. Mai 1889, S. 1743
Die Entstehung der Afrika-Kolonien
Im Juni 1883 verfasste Adolph Woermann eine Denkschrift, in der sich der hanseatische Handel für eine neue Afrikapolitik einsetzte und Schutz durch das Deutsche Reich forderte. Das Schreiben wurde von der Hamburger Handelskammer angenommen und an die Reichsregierung weitergeleitet. Neben der Sicherung des Handels vor englischer und französischer Konkurrenz und der Ausschaltung des afrikanischen Binnenhandels wurde ferner die „Erwerbung eines Küstenstriches in West-Afrika zur Gründung einer Handelskolonie Biafra Bai“, das heißt an der Küste des heutigen Kamerun oder Südostnigeria, gefordert. Aufgrund seines hohen Ansehens gelang Adolph Woermann die Durchsetzung dieser Positionen und Ziele, wobei er teilweise auch persönliche Gespräche mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck führte.
Am 19. März 1884 ernannte Reichskanzler Bismarck den Afrikaforscher und bisherigen deutschen Generalkonsul in Tunis, Gustav Nachtigal, zum kaiserlichen Kommissar für die Westküste Afrikas, mit dem Auftrag, die für den deutschen Handel interessanten Gebiete unter deutsches Protektorat zu stellen. Hierzu gehörte auch der Küstenstrich zwischen dem Nigerdelta und Gabun, insbesondere der gegenüber der Insel Fernando Poo in der Bucht von Biafra gelegene Teil. Am 10. Juli 1884 traf der von Togo kommende Reichskommissar Nachtigal auf der Möwe in Duala ein. Nach der Unterzeichnung von Schutzverträgen zwischen der deutschen Delegation und den wichtigsten Führern der Duálá, Ndumb’a Lobe (Bell) und Ngand’a Kwa (Akwa), am 11. und 12. Juli 1884 kam es am 14. Juli in Duala zur Hissung der deutschen Flagge und Erklärung der „Schutzherrschaft“. Der fünf Tage später eintreffende britische Konsul Hewett, der Kamerun für England in Besitz nehmen wollte, musste sich mit einem förmlichen Protest begnügen. Er erhielt den Spitznamen „The too late consul“.
SMS Möwe
Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Duálá-Clans wurden im Dezember 1884 durch Mannschaften der Korvetten Bismarck und Olga unter dem Befehl von Konteradmiral Eduard Knorr unterdrückt. Die Kämpfe richteten sich zwar nicht primär gegen die deutsche Herrschaft, markieren aber mit der Unterdrückung durch die Reichsmarine den Beginn der militärischen Unterwerfung der Kolonie.
Die Auseinandersetzungen mit den Duala
In der Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Deutsche und Briten die Führung im Handel mit den Duala übernommen. Dies ging mit der Abolitionistenbewegung einher, und die britische Krone bezahlte die Händler, um die Sklaverei im Golf von Guinea zu beenden. Am 10. Juni 1840 und am 7. Mai 1841, wurden die Duala-Könige und King Bell die ersten, die Anti-Sklaverei-Verträge unterzeichneten. Als Gegenleistung belieferten die Europäer diese Herrscher jährlich mit Textilien, Waffen, Alkohol und anderen Geschenken beliefert. Zusätzlich schafften die Herrscher Praktiken ab, die die Briten als barbarisch betrachteten, wie die Opferung der Häuptlingsfrau nach seinem Tode. Die Briten wollten auch die Duala entsprechend ihren eigenen Vorstellungen von Zivilisation formen. Dies bedeutete, dass die Duala sich westliche Bildung aneigneten und zum Christentum übertraten.
Als Antwort auf die Drohung von ausländischen Händlern, übten die Briten Druck auf die Duala-Könige aus, damit jene die britische Annexion anforderten. Im Jahre 1879 entsandte König Akwa solch eine Bitte; König Bell tat es ihm im Jahre 1881 gleich (einige Geschichtsforscher glauben allerdings, dass diese Dokumente gefälscht wurden). Als König Pass All der Limba seine Territorien zu den Franzosen abtrat, machten die britischen Händler auf die Dringlichkeit der Eroberung der Duala-Gebiete durch die Krone aufmerksam. Im Juli 1884 allerdings unterzeichnete der deutsche Entdecker Gustav Nachtigal Land-Cessationsverträge mit den Königen Akwa, Bell, und Deido. Die Briten kamen zu spät an, und am 28. März 1885 wurde das Gebiet von Königin Victoria an das Deutsche Kaiserreich abgetreten.
Deutsche Kolonialzeit
Die deutsche Korvette Olga bei der Beschießung von „Hickorytown“ (heute Douala), am 21. Dezember 1884
Der Annexation folgte die Opposition von Seiten anderer europäischer Kolonialmächte gegen die deutsche Kolonialverwaltung. Aber auch der Prinz Lock Priso bevorzugte die britische Herrschaft und leitete eine Rebellion im Dezember 1884 ein. Zur gleichen Zeit kam es zur Konfrontation zwischen König Bell und seinem Volk, welche überwiegend gegen die deutsche Kolonialverwaltung waren. Bell befand sich dann selbst mit anderen Duala-Häuptlingen im sogenannten Duala-Krieg - welcher aufgrund einer Tötung eines Bonaberi-Dualas und Bells angebliche Weigerung, seine Profite mit den anderen königlichen Stämmen zu teilen, ausgetragen wurde. Deutschland stoppte den gewaltsamen Konflikt, als ein deutscher Staatsbürger dabei getötet wurde.
Erstürmung von „Belltown“ durch die Landungsabteilung der Korvette SMS Olga (Zeichnung von Carl Saltzmann, 1885)
Bell überlebte, aber seine Macht schwand signifikant. Da man realisierte, dass die Duala nie wieder der Herrschaft eines einzelnen Königs folgen würden, spielten die Deutschen die Konkurrenten gegeneinander aus. Sie unterstützten den geschwächten König Bell, um den machtvollen König Akwa zu bezwingen.
Trotz der Unruhen und eines kleinen Landgebietes wurde das Duala-Territorium zum wirtschaftlichen und politischen Nexus der Deutschen Kolonie Kamerun. Die Deutschen regierten ursprünglich von Duala aus, welches zu dieser Zeit noch Kamerunstadt hieß, aber verlegten ihre Hauptstadt 1901 zur Bakweri-Siedlung von Buea. Konstanter Schiffsverkehr entlang der Küste erlaubte es Einzelnen, auf der Suche nach Arbeit von einer Plantage oder Stadt zu einer anderen zu ziehen. Die Küstenvölker, vor allem die Duala und die Bakweri, vermischten sich wie noch nie zuvor.
Die deutsche Ankunft auf dem Festland bedeutete, dass das Monopol der Küstenvölker über den Handel endete. Die meisten Duala kehrten zur Subsistenz-Landwirtschaft oder zum Fischfang zurück, um zu überleben. Die Jahre des Kontakts mit Westlern und ein hohes Grad an Alphabetisierung erlaubte es einer gebildeten Oberschicht von Händlern, Klerikern und Farmern, sich weiter zu entwickeln. Diese Klasse war mit dem europäischen Recht und den Konventionen vertraut, was es ihnen erlaubte, die deutsche Kolonialregierung mit Petitionen, Gerichtsverfahren und speziellen Interessengruppen gegen die aus ihrer Sicht unbeliebte oder unfaire Politik zu opponieren. Eine Serie von diesen begann im Jahre 1910, als die deutsche Kolonialadministration eine neue Kopfsteuer initiierte und es versuchte, Land im Bezirk Duala sicherzustellen, um dann die eingeborene Bevölkerung aus der Stadt umzusiedeln. König Bells Nachfolger, König Rudolf Duala Manga Bell versuchte, Widerstand zu sammeln, indem er Abgesandte schickte, um die Anführer der Völker landeinwärts zu besuchen. Der Sultan des Königreiches Bamum, Ibrahim Njoya vom Volk der Bamum, gab der deutschen Kolonialverwaltung darüber einen Hinweis, woraufhin Bell und seine Kollaborateure 1914 aufgrund des Hochverrats hingerichtet wurden.
Das Kamerun-Spiel
Das Kamerun-Spiel (vollständiger Name Das Kamerun-Spiel oder King Bell und seine Leute) ist ein 1885 vom Moritz Ruhl Verlag aus Leipzig herausgegebenes rassistisches Kartenspiel aus der deutschen Kolonialzeit.
Beschreibung
Das Spiel basiert auf einem eher einfachen Spielkonzept und ist als Familienspiel ausgelegt. Jeder Mitspieler erhält am Anfang eine der Porträtkarten, auf denen stilisierte Mitglieder der Duala abgebildet sind. Die restlichen Karten werden versteigert und mit den ebenfalls vorher in gleicher Anzahl verteilten „Marken“ bezahlt, damit die Spielkasse wieder einen Betrag enthält. Nun zieht jeder Mitspieler eine der Ereigniskarten, die verlesen wird. Dem jeweiligen Duala werden damit willkürlich irgendwelche Handlungen zugeordnet, für welche der Spieler Spielgeldmarken aus der Kasse erhält oder in diese einzahlen muss. Auf einer Karte steht beispielsweise: „John Prisso – wird wegen Aufwiegelung der Stammesgenossen zum Aufruhr gegen die Deutschen zum Tode verurteilt, später jedoch zur Verbannung und Zahlung von 10 Marken begnadigt“, womit die Karte entweder aus dem Spiel ausscheidet oder der Kartenbesitzer 10 Marken bezahlen muss. Mit Karten, auf denen Texte wie „Njeka (Prissos Frau) – trägt einen Gesang in der Negersprache vor und erhält für das dadurch den anwesenden Europäern bereitete Ergötzen 2 Marken ausgezahlt“ oder „King Bell – hat schon seit langer Zeit einen umfangreichen Handel mit Palmöl, Elephantenzähnen, ausschließlich mit den deutschen Factoreien unterhalten und erhält dafür 3 Marken ausgezahlt“ standen, erhielt der Spieler zusätzliche Spielmarken.
Um das Spiel zu beenden und den Sieger zu ermitteln, wurden sämtliche Porträtkarten eingesammelt, gemischt und bis auf eine neu verteilt. Sie zeigen acht Paare und es wurden dann nach dem Prinzip von Schwarzer Peter solange Karten gezogen und abgelegt, bis nur noch ein Spieler die letzte Karte in der Hand hielt. Der war dann „von den Kamerun-Negern“ derjenige, welcher „die größte Treue und Ausdauer in seinen friedlichen Gesinnungen gegen die Deutschen bewahrt“ habe und erhielt als Sieger den restlichen Kassenbestand.
Hintergrund
Das Spiel erschien zum Weihnachtsgeschäft 1885, nachdem im selben Jahr auf der Kongokonferenz Kamerun als deutsche Kolonie international anerkannt worden war. Das reich ausgestattete Spiel bezog sich auf die Fahrt des Kanonenboots SMS Möwe auf nach Douala. Dort hatten die dortigen Häuptlinge King Bell und Akwa einen Schutzvertrag unterschrieben und damit ihre Hoheitsrechte abgetreten. Beworben wurde es als Familienspiel damit, dass man im Spielmaterial sechzehn „fein ausgeführten Neger-Porträts in Farbendruck auf Karton- und ebenso vielen Namens- und Ereigniskarten“ finde. Der Sieger gewann nach einem relativ einfachen Spielprinzip. Geprägt ist das Spiel von Auszeichnungs- und Bestrafungsaktionen, die später in vielen Spielen vorkamen, so dass Hillrichs es als „schwarzes Monopoly“ bezeichnet. Die Duala als Ureinwohner von Kamerun werden entweder als folgsame Unterstützer der Deutschen oder als böswillige Aufwiegler und Diebe dargestellt. Ihre traditionellen Kulthandlungen sollen so erscheinen, dass sie entweder der Belustigung der Kolonialherren dienen oder aber heimtückische Hexerei sind.
Das Spiel lässt sich als spezielle Form kolonialistischer Mobilmachung beschreiben, bei dem deutsche Familien als Freizeitbelustigung Kolonialismus spielerisch einüben konnten und gleichzeitig die angebliche sittliche Fehldisposition der Ureinwohner als ein vom Trunk ergebenes Volk von Händlern, das zu Streit, Verrat und Aufruhr neigt, in deutsche Wohnzimmer transportiert werden. Hugo Zöller hatte zu der Zeit geschrieben, das die „Eitelkeit, Faulheit und Habgier“ der Schwarzen nur durch harten Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche kontrolliert werden könne. Das Kamerun-Spiel war eines der ersten von vielen noch folgenden Spielen rund um das Thema koloniale Welt. Oft handelte es sich um reine Glücksspiele wie Kameruner Skat. Die Deutsche Kolonialzeitung schrieb mehrfach über Spiele „unserer engeren dunkelfarbigen Landsleute“. Dabei handelte es sich meist um einfache Kinderreigen oder Glücksspiele mit Spielmaterialien wie Kaurimuscheln oder Bohnen.
Hillrichs zufolge wurden durch das Spiel Vorurteile manifestiert und die eigenen Macht-, Eroberungs-, Unterwerfungs- und Herrschaftsansprüche über die angeblich „barbarischen Regionen“ gerechtfertigt. Er konstatiert eine partielle Selbst-Infantilisierung der Kolonialherren, obwohl im Spiel selbst die Schwarzen infantilisiert werden. Dies passe in die eher naive europäische Erwartung, durch Ausbeutung der kolonialen Bodenschätze und sonstigen natürlichen Reichtümer die eigene Ernährung und Versorgung sichern zu können.
Die Kongo – Konferenz
Die Kongokonferenz (oder Westafrika-Konferenz) fand vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885 auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Bismarck in Berlin statt und sollte die Handelsfreiheit am Kongo und am Niger regeln. Sie wird auch als Berliner Konferenz bezeichnet (allerdings nicht zu verwechseln mit dem Berliner Kongress 1878). Ihr Schlussdokument, die Kongoakte, bildete die Grundlage für die Aufteilung Afrikas in Kolonien im folgenden Wettlauf um Afrika.
Zeichnung der Teilnehmer der Kongokonferenz 1884
Die vorläufigen Grenzen der Kolonie Kamerun wurden auf der Kongo-Konferenz (Kongo-Akte) in Berlin festgelegt. Der endgültige Grenzverlauf beruhte dann aber auf den Verträgen vom 3. Mai 1885 (mit Großbritannien), 24. Dezember 1885 (mit Frankreich), 27. Juli 1886 (mit Großbritannien), 2. August 1886 (mit Großbritannien), 14. April 1893 (mit Großbritannien), 15. November 1893 (mit Großbritannien), 15. März 1894 (mit Frankreich), 1901 und 1902 (mit Frankreich) und 1908 (mit Frankreich).