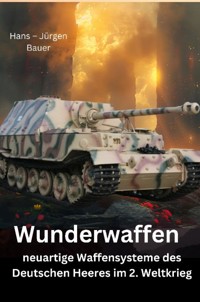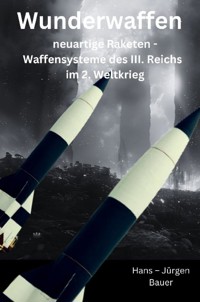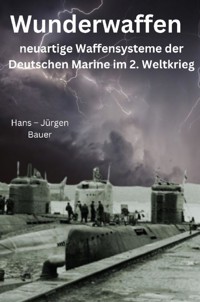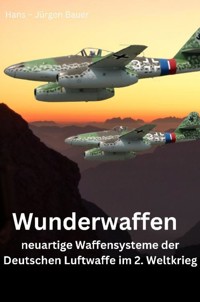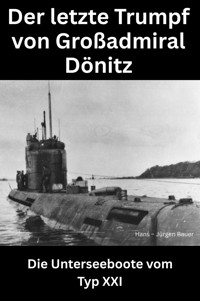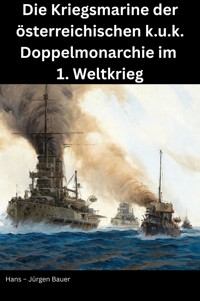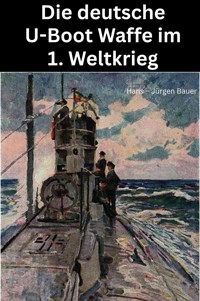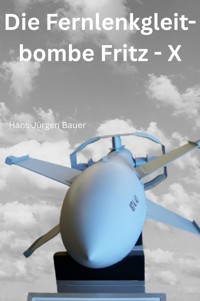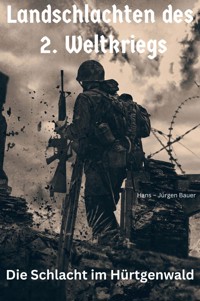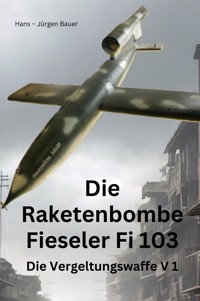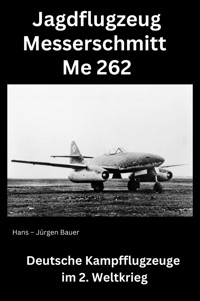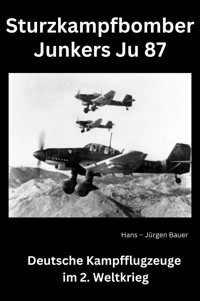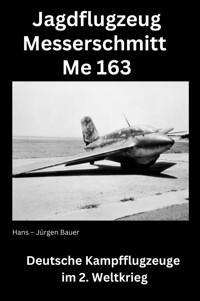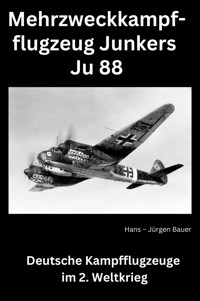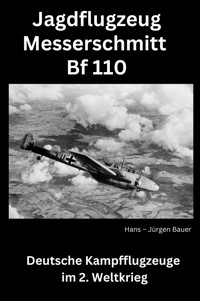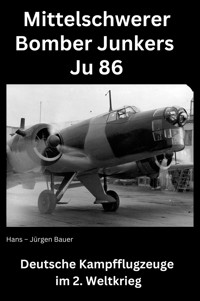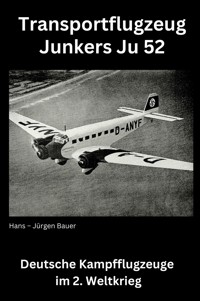Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Des Kaisers Platz an der Sonne: die Kolonie Togo Die deutschen Kolonien (offiziell Schutzgebiete genannt) wurden vom Deutschen Reich ab den 1880er Jahren erworben und es bestand aus den überseeischen Kolonien, Dependenzen und Territorien des Deutschen Reiches. Bereits vor der Reichsgründung im Jahr 1871 hatte es kurzlebige Kolonisierungsversuche einzelner deutscher Staaten gegeben, aber Bismarck widerstand dem Druck, ein Kolonialreich zu errichten, bis zum "Scramble for Africa" im Jahr 1884. Deutschland beanspruchte einen Großteil der noch nicht kolonisierten Gebiete Afrikas und errichtete im Lauf der Zeit das drittgrößte Kolonialreich nach Großbritannien und Frankreich. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 verlor Deutschland die Kontrolle über den größten Teil seines Kolonialreichs, aber einige deutsche Truppen hielten sich bis zum Ende des Krieges in Deutsch-Ostafrika. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde das deutsche Kolonialreich im Rahmen des Versailler Vertrags von den Alliierten offiziell beschlagnahmt. Jede Kolonie wurde ein Völkerbundmandat unter der Verwaltung, wenn auch nicht unter der Souveränität, einer der alliierten Siegermächte. In diesem Buch wird die Geschichte der Kolonie Togo behandelt. Umfangreiche Hintergrundinformationen und zeitgenössisches Bildmaterial zeichnen dieses Werk aus. Umfang: 120 Seiten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Des Kaisers Platz an der Sonne
Die Kolonie Togo
IMPRESSUM:
Autor: Hans-Jürgen BauerHerausgeber:M. PrommesbergerHändelstr 1793128 Regenstauf
Die Deutsche Kolonie Togo
Lage Schutzgebiet Togo (heute unabhängig als Togo und Teil Ghanas)
Hauptstadt: Berlin, Deutsches Reich
Verwaltungssitz: 1884–1886 Bagida
1886–1897 Sebe
ab 1897 Lomé
Verwaltungsorganisation:
Oberhaupt der Kolonie: 1885–1888: Kaiser Wilhelm I.
1888: Kaiser Friedrich III.
1888–1899: Kaiser Wilhelm II.
Einwohner: ca. 1.000.000,
100 Deutsche (1900)
320 Deutsche (1912)
Besitzergreifung: 1884–1914 bzw. 1919
Heutige Gebiete: Togo und Teile Ghanas
Togo war von 1884 bis 1916 eine deutsche Kolonie (auch Schutzgebiet). Das damalige Gebiet umfasste die heutige Republik Togo und den östlichsten Teil des heutigen Ghana und besaß eine Fläche von ca. 87.200 km².
Die Entstehungsgeschichte der deutschen Kolonie
Urheber: Colonial_Africa_1913_map.svg: Eric Gaba (Sting - fr:Sting)
derivative work: P. S. Burton (talk)
Schon ab 1857 gründeten die ersten hanseatischen Handelsunternehmen Faktoreien an der Sklavenküste, die ab 1882 durch einen regelmäßigen Dampferverkehr der Woermannlinie mit dem deutschen Kaiserreich verbunden war. Am 5. Juli 1884 unterzeichneten Plakkoo, der Stabträger (= Stellvertreter) des zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon verstorbenen Königs Mlapa III. und Gustav Nachtigal einen „Schutzvertrag“, womit nun einzelne Orte im heutigen Togo zum „Deutschen Schutzgebiet“ erklärt wurden. („König Mlapa gewährt allen deutschen Untertanen und Schutzgenossen, welche in seinem Lande wohnen, Schutz und freien Handel und will andren Nationen niemals mehr Erleichterungen, Begünstigungen oder Schutz gewähren, als den deutschen Untertanen eingeräumt werden.“). Der Vertragsort Baguida wurde von 1884 bis 1886 die erste Hauptstadt der Deutschen Kolonie Togo.
Am 5. September 1884 folgte ein weiterer „Schutzvertrag“ mit dem König von Porto Seguro. Nach einem Abkommen mit Frankreich 1885 gelangte der Ort Anecho (bis 1905 auch „Klein-Popo“ genannt) an Deutschland. Ab 1886 begann die teils gewaltsame Eroberung des nördlichen Hinterlandes. 1888 gründete Ludwig Wolf die Station Bismarckburg. 1890 folgte die Gründung der Station Misahöhe.
Die Station Bismarckburg
Bismarckburg war der Name einer Kolonialstation in der Kolonie Togo. Der Ort war nach dem Reichsgründer Otto von Bismarck benannt.
Die Station wurde im Juni 1888 von dem Forscher Ludwig Wolf gegründet. Sie war eine der ersten dauerhaft bewohnten Europäerstationen im Inneren Westafrikas und befand sich auf dem 750 Meter hohen Adadoberg. In den Jahren 1889/90 wurde die Station von Erich Kling geleitet und war Ausgangspunkt mehrerer Expeditionen zur Erforschung des Hinterlandes und zur Ausbreitung des deutschen Einflusses in dem Gebiet. Das kaiserliche Kommissariat unter Jesko von Puttkamer stand der Station aufgrund ihrer Abgelegenheit und wirtschaftlichen Ineffizienz skeptisch gegenüber. Statt den Handel zur deutschen Togoküste zu lenken, stärkte sie die bestehenden Verbindungen zur britischen Goldküste. Bereits am 30. Juni 1894 wurde der Status als Europäerstation aufgehoben. Zwischen 1888 und 1897 war in Bismarckburg eine Wetterstation der Deutschen Seewarte aktiv. Die Kolonialstation unterstand noch bis 1914 als Nebenstation einem deutschen Bezirksleiter in Kete Krachi. In der Nähe befindet sich heute Yégué in der Präfektur Sotouboua.
Folgeseite: Kautschukkarte von Togo (Bismarckburg liegt etwa in der Mitte des Landes) Datum 1914
Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Die weitere Entwicklung der Kolonie
Seit 1891 unterstand Togo nicht mehr der deutschen Verwaltung der Kolonie Kamerun. Der Afrikaforscher und Kolonialbeamte Dr. Hans Gruner erhielt 1892 von der deutschen Regierung den Auftrag, den Militärposten Misahöhe in der deutschen Kolonie Togo in eine wissenschaftliche Station umzuwandeln. Als Engländer und Franzosen sich 1893 und 1894 im Wettlauf um Afrika bemühten, die Länder westlich des Nigers ihrer Kolonialherrschaft zu unterwerfen, unternahm Gruner zusammen mit dem Arzt Richard Döring (* 1868) und Leutnant Carnap-Quernheimb auf Befehl der Regierung eine größere Expedition von Togo nach Sokoto. Damit sollte Togo um ein Vielfaches seiner damaligen Größe erweitert werden. Er brach dazu am 6. November 1894 von Misahöhe auf und erreichte Ende Januar 1895 Kankantschali, wo er einen Bündnisvertrag mit dem Fürsten von Gurma abschloss. Die Reisenden trafen dann am 19. Februar in Say ein und machten im März einen Abstecher nach Gando in Sokoto und kehrten durch Borgu nach Togo zurück. Neben dem Vertrag mit den Fürsten von Gurma hatten Gruner und sein Begleiter Ernst von Carnap-Quernheimb weitere vermeintliche „Schutzverträge“ mit den Oberhäuptern der Reiche Gando (Nupe und Ilorin) abgeschlossen.
Im Vertrag mit Frankreich von 1897 verzichtete Deutschland aber auf beide Gebiete. Togo wuchs nur nach Norden bis zur Region um Sansane-Mangu, wo 1896 eine Station errichtet wurde. 1897 wurde der Verwaltungssitz Togos von Sebe nach Lomé verlegt.
Sansanné-Mango oder Mango (früher Sansane-Mangu)
Urheber: Domenico-de-ga
Durch Grenzabkommen mit den benachbarten Kolonialmächten Frankreich (1887, 1897 und 1912) und Großbritannien (14. Juli 1886, 1. Juli 1890 und 14. November 1899) erhielt Togo mit der Zeit seine charakteristische Form. Als letzte Streitfrage wurde 1899 im Samoa-Vertrag die Aufteilung des sogenannten Salaga-Gebietes zwischen Deutschland und Großbritannien geklärt, das zwischen 1889 und 1899 neutrales Gebiet zwischen der britischen Goldküste und der deutschen Kolonie Togo war (siehe dazu auch das folgende Kapitel).
Militärische Formationen wie die Schutztruppen wurden in Togo nicht stationiert. Zwischen 1895 und 1899 kam es zu mehreren kleineren Aufständen, die von Polizeieinheiten unterdrückt wurden. 1897/98 bestand die koloniale Polizeitruppe aus einem Kommandeur, drei Unteroffizieren und 150 Einheimischen, die bis 1913 auf 2 Offiziere, 6 Unteroffiziere und 550 afrikanische Polizisten erweitert wurde. Zu dieser Zeit wurde auch ein größerer Aufstand der Dagomba unterdrückt und das Land unterworfen. In der Nähe der Stadt Yendi ist heute noch ein Massengrab gefallener Dagombakrieger zu sehen.
Die neutrale Zone
Salaga-Gebiet (auch Neutrale Zone) war die Bezeichnung für ein Ende des 19. Jahrhunderts zwischen den Kolonialmächten Deutschland und Großbritannien umstrittenes Gebiet um die Stadt Salaga im heutigen Nord-Ost-Ghana.
Die Grenzen von Togo 1897 mit dem sog. „Salaga-Gebiet“, das als neutrale Zone hinsichtlich der Abgrenzung britischer und deutscher Machtinteressen im Hinterland der Gold- und Togoküste zwischen 1890 und 1899 aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung bestanden hat.
Geographischer Raum
Das Salaga-Gebiet erstreckte sich in Nord-Süd-Richtung zwischen der Mündung des Dakaflusses in den Weißen Volta und dem 10. Breitengrad nördlicher Breite. Im Osten und Westen bildeten die Grenzen des Königreichs Dagomba die Außenbegrenzungen, so dass in etwa eine quadratförmige Fläche als neutrale Zone definiert wurde mit der Mündung des Trubong in den Schwarzen Volta als Westgrenze.
Grund der Einrichtung
In Verbindung mit dem Helgoland-Sansibar-Vertrag diskutierten die Regierungen aus London und Berlin u.a. auch über einen möglichen Grenzverlauf zwischen deutschen und britischen Einflussgebieten in Westafrika, d.h. auch im Hinterland der Gold- und der Mina- (Togo-)küste. Man diskutierte zunächst eine Lösung, welche eine Grenzziehung vorsah, die große Teile des Mamprusi-Landes und des Königreichs Dagomba in die britische Einflusssphäre eingliedern würde, während die Gegenden östlich des niederen Volta um Ho, Kpandu und ein großer Teil des Peki-Gebietes dem deutschen Territorium zugesprochen werden würden. Es kam jedoch in dieser Frage keine vertragliche Einigung zustande.
Einer der Hauptgründe für das Nichtzustandekommen einer Übereinkunft bestand in der Notwendigkeit einer Teilung des umstrittenen Raumes nach ethnischen Gesichtspunkten, um zukünftiges Konfliktpotential zu vermeiden. Aber ein Grenzverlauf entlang des Weißen Volta, der ein solches weitgehend berücksichtigt hätte, schien den Briten inakzeptabel zu sein, ging es doch um den Besitz wichtiger Handelsplätze. Salaga und Jendi waren immerhin die Endpunkte wichtiger transsaharischer Karawanenrouten. Daneben hätte die von den Briten angestrebte Grenzziehung dazu geführt, dass die durchaus bedeutenden Staatswesen der Mamprussi und Dagomba geteilt würden und in beiden Fällen die Residenzen der wichtigsten einheimischen Autoritäten sowohl auf deutschem als auch auf britischen Einflussgebiet verteilt waren. Daneben hätte ein Teil der Mamprussi im Norden unter französischer Oberhoheit gestanden. Auch auf britischer Seite war man sich darüber klar, dass ein solcher Zustand langfristig ein gefährliches Konfliktpotential barg. So residierte bspw. der König der Mamprusi in Gambaga, das in diesem Fall zum britischen Interessenbereich gehörte, während ihre wichtigsten Häuptlinge in Sansanné-Mango residierten, das auf deutscher Seite lag, jedoch ein Großteil der Agrarproduktion der Mamprusi im Norden auf französischem Gebiet erfolgte. Natürlich sollte aus britischer Sicht eine Vereinigung der Mamprussi, da man den König auf seiner Seite hatte, möglichst unter britischer Oberhoheit stattfinden. Da jedoch keine Einigung zu erzielen war, einigte man sich zunächst auf die Einrichtung einer für beide Seiten verbindlichen neutralen Zone.
Auflösung
Die "neutrale Zone" wurde mit einem deutsch-britischen Abkommen vom 14. November 1898 aufgelöst, das in Kombination mit dem trinationalen Samoa-Vertrag 1899 ratifiziert wurde. Die neue Grenze entsprach weitgehend der zunächst als bedenklich eingestuften Variante einer Teilung der Königtümer Dagomba und Mamprusi. Die neue deutsch-britische Grenze verlief im Dagomba-Land zu großen Teilen entlang des Flusslaufs des Daka. Dabei wurde es den auf der deutschen Seite siedelnden Mamprusi freigestellt, zu ihren Verwandten auf britischer Seite umzusiedeln, während es auf der anderen Seite den Tschekossi auf britischer Seite freigestellt wurde, auf das deutsche Territorium überzusiedeln. Einzig bezüglich der Dagomba hatten die Verantwortlichen der europäischen Regierungen keinerlei Konzepte, zumal sich die Dagomba bislang jedweder europäischer Einflussnahme erfolgreich widersetzt hatten. In dieser Frage spielte vor allem die Tatsache eine Rolle, dass durch die Grenzziehung der Dagomba-König und seine wichtigsten Häuptlinge voneinander getrennt würden, daneben kamen hier aber auch erbitterte nationale Rivalitäten seitens der beiden europäischen Kolonialmächte zum Tragen, denn immerhin lagen im Dagomba-Land mit Salaga und Jendi die südlichen Endpunkte wichtiger transsaharischer Karawanenrouten, was einer herrschenden europäischen Macht die militärische Kontrolle und hierdurch die Möglichkeit zu einer Steuererhebung eröffnete.
Durch die 1919 endgültig erfolgte Aufteilung der ehemaligen deutschen Kolonie Togo zwischen Frankreich und Großbritannien wiederum gelangte das gesamte ursprüngliche Salagagebiet unter britische Herrschaft und wurde damit letztlich 1957 Teil des unabhängig gewordenen Staates Ghana.
Die „Musterkolonie“ Togo
Deutscher Kolonialherr mit Einheimischen um 1885
Togo galt als die „Musterkolonie“ der deutschen Kolonialgeschichte. Hier unternahmen die Kolonialherren größere Anstrengungen im Bereich des Schul- und Gesundheitswesens (z. B. Impfaktionen gegen die Pocken) als in den anderen Kolonien. Drei Eisenbahnlinien wurden gebaut: die Küstenbahn (1905), die Inlandbahn (1907) und die Hinterlandbahn (1913 eröffnet). Auch im Bereich Straßenbau galt Togoland als mustergültig. Die Einheimischen waren hier zunächst ebenso weitgehend rechtlos wie in den anderen deutschen Kolonien und z. B. der Prügelstrafe ausgesetzt. Gleichwohl gab es 1902 eine Verordnung zur Beseitigung der Haussklaverei und ab 1907 Erhebungen und Studien zur Schaffung eines „Eingeborenenrechts“. Eine Verordnung von 1906 ließ an Schulen außer der Landessprache ausschließlich die deutsche Sprache zu.