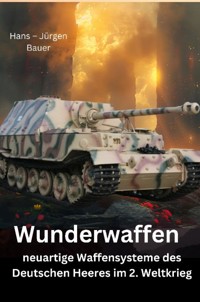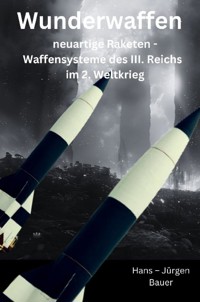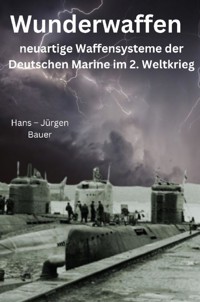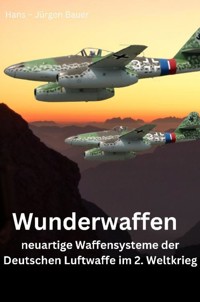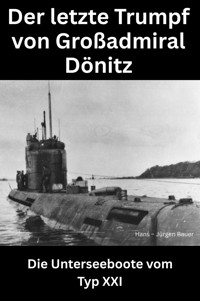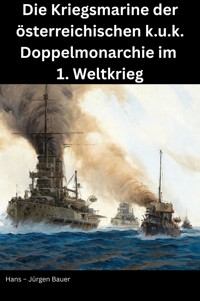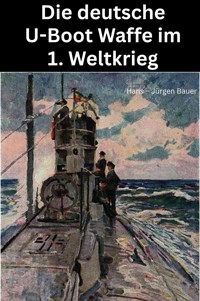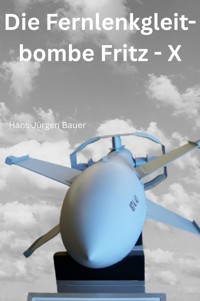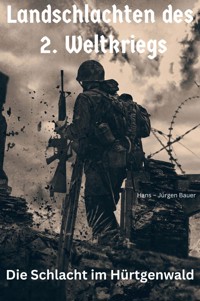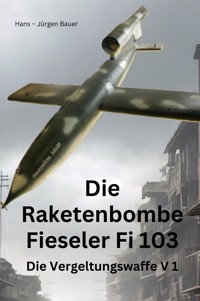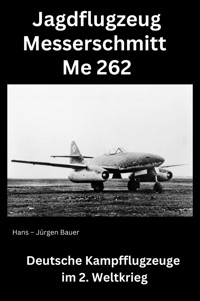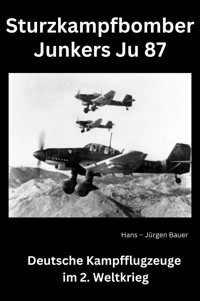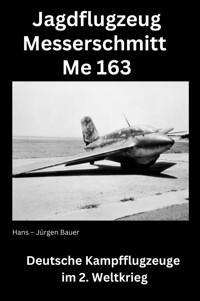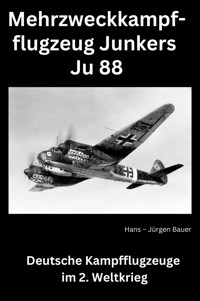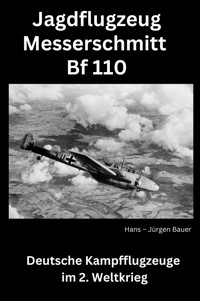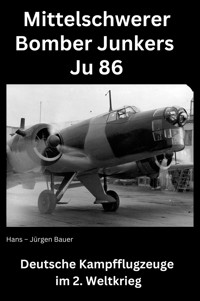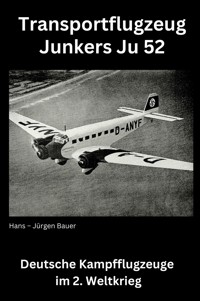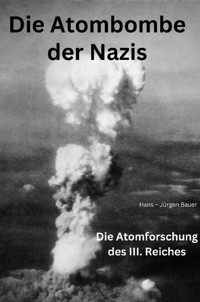
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Atombombe der Nazis Die Atomforschung des III. Reiches Hätte Hitler den 2. Weltkrieg gewinnen können? Unter Umständen mithilfe von Atomwaffen? Die Vorstellung, dass Atombomben, die auf einer V2 montiert wurden, ist fast undenkbar, denn gegen sie hätte es keine Abwehr gegeben. Und London und Paris wären auf jeden Fall in der Reichweite der V2 - Raketen gewesen. Immerhin war Deutschland ja vor Ausbruch des Krieges in der Forschung noch führend gewesen. Doch wie nah war das III. Reich wirklich an der erfolgreichen Entwicklung von Atomwaffen. Dieses Buch versucht hierauf eine Antwort zu geben. Es beschriebt die technischen Details zur Kernwaffenforschung in Deutschland und vermittelt Hintergrundwissen zu dem Thema, wie weit Deutschland wirklich gegen Kriegsende mit seinem Atomprogramm gekommen war. Es beantwortet auch die Frage, ob Hitler tatsächlich eine Bombe hätte bauen können. Umfangreiches zeitgenössisches Bildmaterial ergänzt dieses Werk. Umfang: 55 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 40
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Atombombe der Nazis
Die Atom-Forschung des III. Reiches
IMPRESSUM:
Autor: Hans-Jürgen BauerHerausgeber:M. PrommesbergerHändelstr 1793128 Regenstauf
Das Uranprojekt
Als Uranprojekt wird die Gesamtheit der Arbeiten im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkrieges bezeichnet, bei denen die 1938 entdeckte Kernspaltung technisch nutzbar gemacht werden sollte. Hauptziel war dabei, die Möglichkeiten zum Bau einer Kernwaffe abzuschätzen sowie einen Demonstrations-Kernreaktor zu bauen. Trotz einiger Erfolge gelang es den Wissenschaftlern bis Kriegsende nicht, eine selbsterhaltende nukleare Kettenreaktion in einem solchen Reaktor herzustellen. Es gibt keine Beweise dafür, dass gegen Kriegsende kleinere Kernwaffentests unternommen wurden, wie gelegentlich behauptet wird.
Im Verlauf des Krieges wurden die industriellen Produktionsanlagen von den Alliierten zerstört. Gegen Kriegsende wurden acht am Uranprojekt beteiligte Wissenschaftler von der Alsos-Mission gefasst und in Farm Hall (England) interniert. Andere, wie Manfred von Ardenne, wurden von sowjetischen Kräften festgesetzt. Die Versuchsaufbauten des Uranprojekts wurden demontiert und die Materialien beschlagnahmt. Die Wissenschaftler wurden nach dem Krieg wieder freigelassen und kehrten, teilweise nach jahrelanger Zwangsverpflichtung in der Sowjetunion, nach Deutschland zurück.
Beteiligte
Die wichtigsten am Uranprojekt beteiligten Wissenschaftler waren:
Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und Karl Wirtz am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik (KWI) in Berlin-Dahlem, später in Hechingen,
Robert Döpel im experimental-physikalischen Institut der Universität Leipzig zusammen mit W. Heisenberg im theoretisch-physikalischen Institut bis zu dessen Übernahme der Leitung des Berliner KWI für Physik (Mitte 1942),
Kurt Diebner in der Heeresversuchsanstalt Kummersdorf in Kummersdorf-Gut bei Berlin (später in Stadtilm),
Paul Harteck und Wilhelm Groth an der Universität Hamburg.
Weitere indirekt involvierte Institutionen waren das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie (Otto Hahn, Max von Laue und Horst Korsching) in Berlin-Dahlem, das Forschungslaboratorium für Elektronenphysik von Manfred von Ardenne in Berlin-Lichterfelde, sowie die Universitäten Heidelberg (Walther Bothe und Wolfgang Gentner) und Göttingen (Wilhelm Hanle und Georg Joos).
Von Industrieseite am Uranprojekt beteiligt waren:
die Auergesellschaft in Oranienburg zur Gewinnung von Uranoxid aus Uranerz,
die Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt (Degussa) in Frankfurt am Main zur Herstellung von reinem Uran,
die Anschütz & Co GmbH in Kiel am Bau und Entwicklung der Gaszentrifugen geleitet von Konrad Beyerle,
die Norwegische Hydroelektrische Gesellschaft (Norsk Hydro) bei Rjukan in Norwegen zur Produktion von schwerem Wasser und
die Leunawerke der I.G. Farben bei Merseburg zur weiteren Produktion von schwerem Wasser.
Vorgeschichte
Im Jahr 1934 hatte der italienische Physiker Enrico Fermi an der Sapienza-Universität von Rom chemische Elemente, unter anderem Uran, mit Neutronen bestrahlt und dabei durch Kernreaktion künstliche radioaktive Nuklide gewonnen. Die österreichische Physikerin Lise Meitner und der deutsche Chemiker Otto Hahn überprüften in den folgenden Jahren am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem Fermis Experimente und glaubten in den folgenden Jahren einige neue Elemente, sogenannte Transurane, nachgewiesen zu haben.
Versuchsanordnung von Otto Hahn und Fritz Straßmann bei der Entdeckung der Kernspaltung im Deutschen Museum in München.
Von J Brew - originally posted to Flickr as Nuclear Fission Deutsches Museum, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4291036
Aufgrund der Deutung, bei Fermis Versuchen seien neue Elemente entstanden und nachgewiesen worden, wurde ihm 1938 der Nobelpreis für Physik verliehen. Wie sich später herausstellen sollte, waren bei den Versuchen Transurane entstanden, bei den nachgewiesenen Betastrahlern handelte es sich allerdings nicht um selbige, sondern um Spaltprodukte.
Lise Meitner musste im Juli 1938 Deutschland aufgrund ihrer jüdischen Abstammung verlassen und konnte dank Otto Hahns Hilfe über Holland nach Schweden emigrieren. Hahn experimentierte mit seinem Assistenten Fritz Straßmann in Berlin weiter. Am 17. Dezember 1938 gelang ihnen erstmals der Nachweis von Bariumisotopen, welche aufgrund ihres deutlich niedrigeren Atomgewichts aus Uran nur mittels Kernspaltung entstanden sein konnten. Die vorher vertretene These, man habe das deutlich schwerere aber chemisch ähnliche Radium gewonnen, konnte anhand chemischer Extraktion widerlegt werden. Dieses Ergebnis war zunächst schwer zu verstehen. In einem Brief wandte sich Hahn an Lise Meitner, die zusammen mit ihrem Neffen Otto Frisch in der Nähe von Göteborg Weihnachten feiern wollte. Hahn beschrieb darin zwei Tage später seine entscheidenden Experimente und sprach erstmals von einem Zerplatzen des Urankerns als einer möglichen Erklärung, bat aber die Physikerin Meitner um eine Erklärung, die ihm als Chemiker nicht offensichtlich schien. Meitner fand die Lösung auf einer Schneeschuhwanderung mit Frisch und berechnete überschlagsmäßig die freiwerdende Energie auf etwa 200 MeV pro gespaltenem Urankern – dies ist auch im Verhältnis zu typischen Zerfallsenergien eine große Energiemenge. Hahn veröffentlichte seine Ergebnisse in einem Aufsatz, der am 6. Januar 1939 in der Zeitschrift Naturwissenschaften erschien. Ein weiterer Aufsatz Hahns, in dem er auf die Möglichkeit der Energiegewinnung mit Hilfe einer Kettenreaktion hinwies, folgte am 10. Februar 1939.