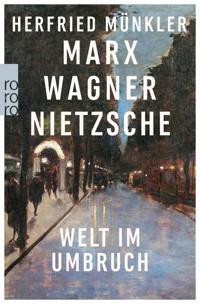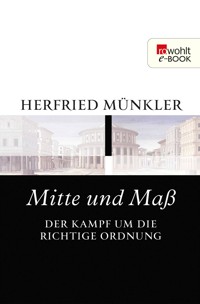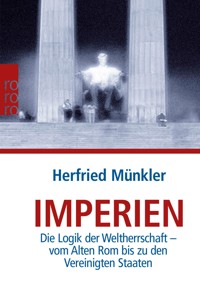9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Zeitalter der zwischenstaatlichen Kriege geht offenbar zu Ende. Aber der Krieg ist keineswegs verschwunden, er hat nur seine Erscheinungsform verändert. In den neuen Kriegen spielen nicht mehr die Staaten die Hauptrolle, sondern Warlords, Söldner und Terroristen. Die Gewalt richtet sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung; Hochhäuser werden zu Schlachtfeldern, Fernsehbilder zu Waffen. Herfried Münkler macht die Folgen dieser Entwicklung deutlich. Er zeigt, wie mit dem Verschwinden von klassischen Schlachten und Frontlinien auch die Unterscheidung von Krieg und Frieden brüchig geworden ist, und erörtert, wie man den besonderen Gefahren begegnen kann, die von den neuen Kriegen ausgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Herfried Münkler
Die neuen Kriege
Über dieses Buch
Das Zeitalter der zwischenstaatlichen Kriege geht offenbar zu Ende. Aber der Krieg ist keineswegs verschwunden, er hat nur seine Erscheinungsform verändert. In den neuen Kriegen spielen nicht mehr die Staaten die Hauptrolle, sondern Warlords, Söldner und Terroristen. Die Gewalt richtet sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung; Hochhäuser werden zu Schlachtfeldern, Fernsehbilder zu Waffen. Herfried Münkler macht die Folgen dieser Entwicklung deutlich. Er zeigt, wie mit dem Verschwinden von klassischen Schlachten und Frontlinien auch die Unterscheidung von Krieg und Frieden brüchig geworden ist, und erörtert, wie man den besonderen Gefahren begegnen kann, die von den neuen Kriegen ausgehen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2011
Copyright © 2002, 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke
Umschlagabbildung Associated Press
ISBN 978-3-644-01121-2
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung
Von der politischen Öffentlichkeit lange Zeit unbemerkt, hat der Krieg in den letzten Jahrzehnten schrittweise seine Erscheinungsform verändert: Der klassische Staatenkrieg, der die Szenarien des Kalten Krieges noch weithin geprägt hat, scheint zu einem historischen Auslaufmodell geworden zu sein; die Staaten haben als die faktischen Monopolisten des Krieges abgedankt, und an ihre Stelle treten immer häufiger parastaatliche, teilweise sogar private Akteure – von lokalen Warlords und Guerillagruppen über weltweit operierende Söldnerfirmen bis zu internationalen Terrornetzwerken –, für die der Krieg zu einem dauerhaften Betätigungsfeld geworden ist. Nicht alle, aber doch viele von ihnen sind Kriegsunternehmer, die den Krieg auf eigene Rechnung führen und sich die dazu benötigten Einnahmen auf unterschiedliche Art und Weise verschaffen: Sie werden durch reiche Privatleute, Staaten oder Emigrantengemeinden finanziell unterstützt, verkaufen Bohr- und Schürfrechte für die von ihnen kontrollierten Gebiete, betreiben Drogen- und Menschenhandel oder erpressen Schutz- und Lösegeld, und durchweg profitieren sie von den Hilfslieferungen internationaler Organisationen, da sie die Flüchtlingslager (oder zumindest die Zugänge zu ihnen) kontrollieren. Wie auch immer aber die Kriegsparteien zu den erforderlichen Mitteln gelangen – stets ist die Finanzierung des Krieges, anders als in den klassischen Staatenkriegen, ein wichtiger Aspekt der Kriegführung selbst. Die gewandelten Finanzierungsformen tragen entscheidend dazu bei, dass die neuen Kriege sich oftmals über Jahrzehnte erstrecken, ohne dass ein Ende in Sicht kommt. Will man die spezifischen Merkmale dieser neuen Kriege verstehen, muss man daher ihre wirtschaftlichen Grundlagen in den Blick nehmen.
Freilich sind, wenn im Folgenden den Ökonomien des Krieges und der Gewalt besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, darüber ideologische Faktoren keineswegs zu vernachlässigen. Ethnisch-kulturelle Spannungen und zunehmend auch religiöse Überzeugungen spielen in den neuen Kriegen eine wichtige Rolle. Die im letzten Jahrzehnt auf dem Balkan geführten Kriege, die Kriege in der Kaukasusregion sowie die Afghanistan-Kriege wären ohne ethnische und religiöse Gegensätze anders verlaufen oder hätten überhaupt nicht stattgefunden. Solche Ideologeme sind eine Ressource zur Mobilisierung von Unterstützungsbereitschaft, und darauf haben die Kriegsparteien in jüngster Zeit verstärkt zurückgegriffen. Offenbar hängt das damit zusammen, dass andere Motivations- und Legitimationsquellen kriegerischer Gewaltanwendung, die in vielen früheren Konflikten im Vordergrund standen, inzwischen an den Rand gedrängt worden sind. Das gilt vor allem für sozialrevolutionäre Ideologien; ihnen müsste eine sehr viel größere Bedeutung zukommen, falls Armut und Elend tatsächlich – wie immer wieder zu hören ist – die Hauptursachen dieser Kriege wären. Zweifellos ist die ungleiche Verteilung von Reichtum und Armut auch für die neuen Kriege relevant, doch sind kriegerische Auseinandersetzungen keineswegs dort am häufigsten anzutreffen, wo die bitterste Armut herrscht. Eher schon kann man behaupten, dass die hoffnungslose Verelendung einer Region umso wahrscheinlicher ist, je länger sich Kriegsunternehmer in ihr eingenistet und die vorhandenen Ressourcen ausgebeutet haben, und selbst mit der Beendigung des Krieges entsteht keine Hoffnung auf politische Stabilität und wirtschaftliche Erholung. Die spezifische Ökonomie der neuen Kriege sorgt in Verbindung mit deren langer Dauer dafür, dass die ausgezehrten und verwüsteten Regionen ohne umfassende Hilfe von außen nicht mehr auf die Beine kommen.
Angesichts der Unübersichtlichkeit der Konfliktgründe und Gewaltmotive bevorzuge ich den unscharfen, aber offenen Begriff der neuen Kriege, wobei ich mir durchaus darüber im Klaren bin, dass sie so neu eigentlich gar nicht sind, sondern in mancher Hinsicht eine Wiederkehr des ganz Alten darstellen. Ein Vergleich mit älteren Formen der Kriegführung kann dabei helfen, die Merkmale und Besonderheiten dieser Kriege herauszuarbeiten. Zum einen müssen diese gegen den klassischen Staatenkrieg abgegrenzt werden, der die heutige Vorstellung von Krieg in vieler Hinsicht immer noch prägt.[1] Darüber hinaus stellt sich jedoch die Frage, ob sich die neuen Kriege nicht in gewisser Hinsicht als eine Rückkehr hinter die Anfänge der Verstaatlichung des Kriegswesens beschreiben lassen, wie sie in Europa während der Frühen Neuzeit stattgefunden hat. Der Blick auf die Verhältnisse vor der Verstaatlichung des Krieges ist geeignet, Ähnlichkeiten mit den inzwischen entstandenen Verhältnissen aufzuzeigen, in denen der Staat nicht mehr ist, was er damals noch nicht war: Monopolist des Krieges.
Insbesondere die Konstellationen des Dreißigjährigen Krieges weisen viele Parallelen mit den neuen Kriegen auf. Charakteristisch für ihn war eine Gemengelage aus privaten Bereicherungs- und persönlichen Machtbestrebungen (Wallenstein, Ernst zu Mansfeld, Christian von Braunschweig), Expansionsbestrebungen der Politiker benachbarter Mächte (Richelieu, Bethlen Gabor) sowie Interventionen zur Rettung und Verteidigung bestimmter Werte (Gustav Adolf von Schweden), außerdem ein inneres Ringen um Macht, Einfluss und Herrschaftspositionen (Friedrich von der Pfalz, Maximilian von Bayern), wobei nicht zuletzt auch religiöskonfessionelle Bindungen eine Rolle spielten.
In den meisten größeren Kriegen unserer Tage – sieht man einmal ab von den wenigen nach klassischem Muster geführten Staatenkriegen wie etwa zwischen China und Vietnam, zwischen Irak und Iran oder zuletzt dem zwischen Äthiopien und Eritrea – ist eine ähnliche Gemengelage aus Werten und Interessen, staatlichen, parastaatlichen und privaten Akteuren zu beobachten. Vor allem sind sie gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Interessengruppen, die sich von einem dauerhaften Verzicht auf Gewalt mehr Nach- als Vorteile erwarten und denen daher am Frieden nichts gelegen ist. Die Kriege im subsaharischen Afrika, vom südlichen Sudan über das Gebiet der großen Seen und den Kongo bis nach Angola; die mit dem Zerfall Jugoslawiens verbundenen Kriege; die bewaffneten Konflikte in der gesamten Kaukasusregion, unter ihnen am prominentesten der Tschetschenienkrieg; die Afghanistan-Kriege seit Anfang der achtziger Jahre – sie alle sind dem Modell des Dreißigjährigen Krieges sehr viel ähnlicher als den zwischenstaatlichen Kriegen vom 18. bis ins 20. Jahrhundert.
Ein solcher historischer Vergleich kann dazu beitragen, die Besonderheiten der neuen Kriege deutlich zu machen. Dabei werden namentlich drei Entwicklungen zu verfolgen sein: zunächst die bereits angesprochene Entstaatlichung beziehungsweise Privatisierung kriegerischer Gewalt. Sie wurde dadurch möglich, dass die unmittelbare Kriegführung in den neuen Kriegen relativ billig ist. Leichte Waffen sind allenthalben günstig zu erhalten und erfordern keine langen Ausbildungszeiten. Diese Verbilligung hat mit der zweiten für die neuen Kriege charakteristischen Entwicklung zu tun, der Asymmetrisierung kriegerischer Gewalt, also dem Umstand, dass in der Regel nicht gleichartige Gegner miteinander kämpfen. Es gibt keine Fronten mehr, und deshalb kommt es auch nur selten zu Gefechten und eigentlich nie zu großen Schlachten, sodass sich die militärischen Kräfte nicht aneinander reiben und verbrauchen, sondern sich gegenseitig schonen und die Gewalt stattdessen gegen die Zivilbevölkerung richten. Diese Asymmetrisierung wiederum ist dadurch gekennzeichnet, dass in ihr bestimmte Formen der Gewaltanwendung, die zuvor untergeordnete taktische Elemente einer militärischen Strategie waren, selbst eine eigenständige strategische Dimension erlangt haben. Das gilt für den Partisanenkrieg, wie er sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt hat, und insbesondere für den Terrorismus. Man kann hier – und damit ist die dritte Tendenz benannt, die für die neuen Kriege typisch ist – von einer sukzessiven Verselbständigung oder Autonomisierung vordem militärisch eingebundener Gewaltformen sprechen. In der Folge haben reguläre Armeen die Kontrolle über das Kriegsgeschehen verloren, und diese ist zu erheblichen Teilen in die Hände von Gewaltakteuren geraten, denen der Krieg als Auseinandersetzung zwischen Gleichartigen fremd ist.
Ist es unter solchen Bedingungen überhaupt noch sinnvoll, am Begriff des Krieges als einer zusammenfassenden Bezeichnung großräumig organisierter Gewalt festzuhalten?[2] Tatsächlich hat mit dem Ende des staatlichen Monopols der Krieg zusehends seine Konturen verloren: Kriegerische Gewalt und organisierte Kriminalität gehen immer häufiger ineinander über, und es ist oftmals kaum noch möglich, zwischen kriminellen Großorganisationen, die sich mit politischen Ansprüchen drapieren, und den Überresten einstiger Armeen oder der bewaffneten Anhängerschaft eines Warlords zu unterscheiden, die sich durch Plünderungen und den Handel mit illegalen Gütern alimentieren. So ist «Krieg» zu einem politisch umstrittenen Begriff geworden: Redet man einer Eskalation der Gewalt das Wort, wenn man ihn auf diese Phänomene anwendet? Oder verschließt man die Augen vor den neuen Entwicklungen des Kriegsgeschehens, wenn man, am herkömmlichen Modell des Staatenkrieges festhaltend, den substaatlichen Formen der Gewaltanwendung die Qualität eines Krieges abspricht? Vor allem in der Auseinandersetzung mit den jüngsten Formen des internationalen Terrorismus hat diese Frage erhebliche politische Brisanz gewonnen.[3] Was als Krieg zu bezeichnen ist und was nicht, ist spätestens seit dem 11. September 2001 keine innerakademische Frage mehr, sondern eine Entscheidung von womöglich weltpolitischer Relevanz. Dieses Buch will dazu beitragen, hierauf eine Antwort zu finden.
1Was ist neu an den neuen Kriegen?
Nahezu alle Kriege, die in den letzten zehn bis zwanzig Jahren unsere Aufmerksamkeit für kurze oder längere Zeit in Anspruch genommen haben,[1] entwickelten sich an den Rändern und Bruchstellen der einstigen Imperien, die bis zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die Welt beherrscht und unter sich aufgeteilt hatten: So hatten die mit dem Zerfall Jugoslawiens verbundenen Balkankriege dort die größte Intensität und längste Dauer, wo bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein Donaumonarchie und Osmanisches Reich aneinander stießen und ihre Einflusssphären in einer Abfolge kleinerer und größerer Kriege immer wieder veränderten. Ähnliches gilt für die an der Südflanke der ehemaligen Sowjetunion – im Kaukasus und den angrenzenden Regionen – aufflackernden bewaffneten Konflikte und Kriege: Sie erstrecken sich im Wesentlichen auf jene Regionen, in denen seit dem 18. Jahrhundert das expandierende Zarenreich und das schwächelnde Osmanenreich um die Vorherrschaft rangen und es den Russen nur unter großen Anstrengungen und nie auf Dauer gelang, die hier ansässigen Bergvölker unter ihre Herrschaft zu bringen. Aus dem endgültigen Zusammenbruch des Osmanischen Reichs am Ende des Ersten Weltkriegs sind aber nicht nur die Konflikt- und Kriegsgebiete des Balkan und Kaukasus hervorgegangen, sondern auch die zahlreichen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, unter denen der Palästinakonflikt seit längerem am bedeutendsten und gefährlichsten ist.
Ähnliches gilt für Afghanistan, das während des 19. Jahrhunderts zu einer Pufferzone zwischen dem auch hier vordringenden Zarenreich und der britischen Herrschaft auf dem indischen Subkontinent wurde und das diese Funktion bis ins 20. Jahrhundert hinein behalten hat. Als die Sowjetunion Ende der siebziger Jahre innerafghanische Auseinandersetzungen zwischen modernistischen und traditionalistischen Kräften auszunutzen suchte,[2] um ihr Einflussgebiet über den Hindukusch hinaus zu erweitern und ein strategisches Sprungbrett zwischen dem Vorderen Orient und den dort lagernden Weltenergiereserven auf der einen und dem als potenziellem Verbündeten gegen China bedeutsamen Indien auf der anderen Seite zu gewinnen, begann ein sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckender Krieg, der schließlich im Zerfall sämtlicher Staatsstrukturen in Afghanistan endete. Sind in den achtziger Jahren die USA als indirekter Widerpart der Sowjetunion aufgetreten, indem sie die antisowjetischen Mudschaheddin mit Waffen und Geld versorgten, so ist nach dem Abzug der Russen und mit nachlassendem strategischen Interesse der USA an der Region der pakistanische Staat an deren Stelle getreten: Die Militärführung Pakistans hoffte, durch die Installierung eines befreundeten Regimes in Kabul könne man gegen Indien die für einen größeren Krieg erforderliche strategische Tiefe gewinnen.[3] Dieses Interesse wiederum resultierte aus einem Konflikt, der aus dem Zerbrechen des zuvor von den Briten beherrschten Raumes erwachsen ist: den immer wieder auch in zwischenstaatlichen Kriegen ausgetragenen Spannungen zwischen Indien und Pakistan. Ende der vierziger Jahre als verfeindete Staaten aus der «Konkursmasse» des britischen Empire hervorgegangen, konnten sie sich vor allem in Kaschmir nicht auf von beiden Seiten anerkannte Grenzen einigen, und so ist diese zum Teil zu Indien, zum Teil zu Pakistan (und teilweise auch zu China) gehörende Provinz bis heute ein ständiger Konfliktherd geblieben, in dessen schwer zugänglichen Bergregionen sich der Kleine Krieg, der Krieg der Partisanen und Milizen, seit Jahrzehnten eingenistet hat.
Schließlich finden nahezu alle Kriege Südostasiens und Schwarzafrikas – von Indonesien über Somalia bis nach Guinea oder Sierra Leone – in Gebieten statt, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg von europäischen Kolonialmächten beherrscht wurden. Dabei sind es freilich weniger die aus der Kolonialzeit stammenden Grenzziehungen, die zu Streitigkeiten zwischen den Staaten geführt haben, als vielmehr innere Auseinandersetzungen um politischen Einfluss und den jeweils einzuschlagenden sozioökonomischen Kurs. Neben ethnischen Konflikten, deren Ursprünge teilweise bis in die vorkoloniale Zeit zurückreichen und die von den Kolonialmächten zur Herrschaftssicherung ausgenutzt worden sind, spielen dabei nicht selten auch religiös-kulturelle Differenzen eine erhebliche Rolle. Beides ist freilich im Verlaufe der sich oft über Jahrzehnte hinziehenden Konflikte durch machtpolitische und wirtschaftliche Auseinandersetzungen so stark überlagert worden, dass sich nur selten ausmachen lässt, was Ursache und was bloßer Anlass ist. Außerdem beuten die Kriegsakteure solche Unterschiede nur zu gern als ideologische Ressource aus, mit der sich Anhänger gewinnen und Unterstützung mobilisieren lassen. Selbst wo das Zusammenleben in multikulturellen, multiethnischen Gemeinschaften über Jahrzehnte reibungslos funktioniert hat, wie etwa in Bosnien, werden ethnische und religiöse Trennlinien mit Ausbruch offener Gewaltanwendung zu Bruchstellen der Freund-Feind-Erklärung. Kurz, ethnische wie religiöse Gegensätze sind meist nicht die Ursachen eines Konflikts, sondern sie verstärken ihn nur. Die neuen Kriege werden von einer schwer durchschaubaren Gemengelage aus persönlichem Machtstreben, ideologischen Überzeugungen, ethnisch-kulturellen Gegensätzen sowie Habgier und Korruption am Schwelen gehalten und häufig nicht um erkennbarer Zwecke und Ziele willen geführt. Besonders dieses Gemisch unterschiedlicher Motive und Ursachen macht es so schwer, diese Kriege zu beenden und einen stabilen Friedenszustand herzustellen.
Ein erster Blick auf die geographische Verteilung und die Verteilungsdichte der Kriege am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt also, dass sich dort, wo eine stabile Staatsbildung stattgefunden hat, wie in Westeuropa und Nordamerika, Zonen eines dauerhaften Friedens entwickelt haben, während vor allem in den Zerfallsgebieten der großen Reiche der Krieg endemisch geworden ist. Zwar sind auch dort Staaten entstanden, die umgehend einen Platz in der Weltorganisation der Vereinten Nationen eingenommen haben, aber sie haben sich in ihrer überwiegenden Mehrzahl als schwach und kaum belastungsfähig erwiesen. Es ist hier nicht zur Entstehung einer ähnlich robusten Staatlichkeit gekommen wie in Europa. Inzwischen kann es keinen Zweifel mehr daran geben, dass die vielen Staatsbildungsprozesse in der Dritten Welt sowie an der Peripherie der Ersten und Zweiten Welt gescheitert sind.[4]
Als eine der wichtigsten Ursachen für dieses Scheitern muss der Mangel an integren und korruptionsresistenten politischen Eliten genannt werden, die im Zugriff auf den Staatsapparat nicht die Möglichkeit zur persönlichen Bereicherung, sondern Aufgabe und Pflicht sehen. Tatsächlich hat sich in vielen Regionen eine Praxis des «Kaperns» der Staatsgewalt durchgesetzt, die dann entweder der Ausweitung der Macht oder der Vergrößerung des Reichtums dient, und in der Regel lässt sich beides unschwer miteinander verbinden. Entgegen einer verbreiteten Vorstellung, die man in den Debatten über die Ursachen der neuen Kriege und die Chancen zu ihrer Beendigung immer wieder hören kann, deutet keineswegs Armut als solche auf die Gefahr einer Eskalation von Gewalt und den bevorstehenden Ausbruch von Kriegen hin; allenfalls das Nebeneinander von bitterem Elend und unermesslichem Reichtum ist ein aussagekräftiger Indikator für die Wahrscheinlichkeit, mit der innergesellschaftliche Auseinandersetzungen in offene Bürgerkriege umschlagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass solche Bürgerkriege nicht nach einem kurzen und heftigen Gewaltausbruch enden, sondern sich zu lange währenden transnationalen Kriegen auswachsen, steigt in dem Maße, wie auf dem umkämpften Territorium Bodenschätze vermutet werden, die durch ihre weltwirtschaftliche Vermarktung zu Quellen des Reichtums für jene werden können, die sie notfalls auch mit Gewalt unter ihre Kontrolle bringen. Potenzieller Reichtum ist eine sehr viel wichtigere Ursache für Kriege als definitive Armut. Ein weiterer Faktor, der zum Ausbruch innergesellschaftlicher Kriege beiträgt, besteht im Aufkommen zahlungskräftiger Emigrantengemeinden, die je nach Interessen und Loyalitäten eine oder mehrere der Kriegsparteien finanziell unterstützen und so deren Durchhaltefähigkeit erhöhen.
Bei der Entstehung der neuen Kriege spielen also mehrere Ursachen zusammen, von denen keine als die eigentliche und entscheidende herausgehoben werden kann, und daher greifen monokausale Ansätze wie eine modernisierte Variante von Imperialismustheorien, Konzepte des Neokolonialismus, ethnische Erklärungen oder der Verweis auf religiöse Gegensätze zu kurz. Jene undurchdringliche Gemengelage unterschiedlicher Motive und Ursachen, die den Friedensschluss zu einem oftmals aussichtslosen Projekt werden lässt, ist aber zunächst die unmittelbare Folge der Tatsache, dass in den neuen Kriegen nicht Staaten, sondern parastaatliche Akteure gegeneinander kämpfen.
Nun ließe sich gegen die These, dass die neuen Kriege aus dem Staatszerfall erwachsen und in ihm enden, sicherlich einwenden, sie sei vom Ansatz her zu pessimistisch: Sie rechne nicht mit der Möglichkeit, dass es sich bei diesen Kriegen, zumindest auf längere Sicht, um Staatsbildungskriege handeln könnte, wie sie auch den Prozess der Staatsbildung in Europa begleitet, gelegentlich unterbrochen, aber letztlich doch vorangetrieben haben.[5] Eine solche Analogie ist prinzipiell nicht völlig von der Hand zu weisen, zumal sich der aus dem Zerfall universaler Mächte erwachsene Staatsbildungsprozess in Europa alles andere als gradlinig und keineswegs innerhalb von ein, zwei Generationen vollzogen hat. Aber der entscheidende Unterschied zwischen den Staatsbildungskriegen in Europa oder Nordamerika (der Unabhängigkeits- und der Sezessionskrieg lassen sich ohne weiteres als Staatsbildungskriege begreifen) und den Staatszerfallskriegen in der Dritten Welt oder an der Peripherie der Ersten und Zweiten Welt besteht darin, dass Erstere unter quasi-klinischen Bedingungen, also ohne größere Einflüsse «von außen», verlaufen sind, während das für Letztere gerade nicht zutrifft: Die zum Zerfall junger und noch instabiler Staaten führenden Kriege unserer Tage unterliegen vielmehr ständigen politischen Einflussnahmen von außen, und vor allem sind sie in weltwirtschaftliche Austauschsysteme eingebunden, die eine politisch kontrollierte Entwicklung ihrer nationalen Ökonomien unmöglich machen. Gerade nationaler Reichtum in Form von Bodenschätzen, Erdöl und Erzen, Diamanten und Edelmetallen ist in der Regel nicht einer sich selbst tragenden Wirtschaftsentwicklung zugute gekommen, sondern hat zumeist die Konflikte um die Aneignung und Verteilung dieser Reichtümer lediglich forciert. So ist die Mehrzahl der failed states unserer Tage keineswegs nur am Tribalismus sozial wie kulturell unzureichend integrierter Gesellschaften gescheitert, sondern ebenso am Sog einer wirtschaftlichen Globalisierung, die vor allem dort ihre destruktiven Wirkungen entfaltet hat, wo sie nicht auf eine robuste Staatlichkeit traf.
Die in der Zeit des Kalten Krieges von beiden Seiten zu verantwortenden Einflussnahmen haben die angestrebte Konsolidierung der Staaten zumindest nicht befördert. Der Versuch sowohl des Westens als auch des einstigen Ostblocks, Staatsbildung durch die Entsendung von Militärberatern sowie die Lieferung von Waffen und Gerät zu beschleunigen beziehungsweise eine bereits einsetzende Erosion zu stoppen, endete fast immer in einem Desaster. Der polnische Journalist Ryszard Kapuściński, ein hervorragender Kenner der politischen Entwicklung Afrikas in den letzten dreißig Jahren, hat dies am Beispiel des von der Sowjetunion unterstützten äthiopischen Militärregimes des General Mengistu beschrieben: «Mengistu hatte mit Hilfe Moskaus die größte Armee in Afrika südlich der Sahara aufgebaut. Sie zählte 400000 Mann und verfügte über Raketen und chemische Waffen. […] Als bekannt wurde, dass ihr Führer geflohen war, zerfiel diese gigantische, bis an die Zähne bewaffnete Armee innerhalb weniger Stunden. […] Die Soldaten Mengistus ließen Panzer, Raketenwerfer, Flugzeuge und Kanonen stehen und machten sich, jeder auf eigene Faust, zu Fuß, auf Mauleseln oder mit Autobussen, in ihre Dörfer auf, nach Hause. Wenn man durch Äthiopien fährt, kann man in vielen Dörfern und Städten junge, kräftige und gesunde Männer sehen, die untätig vor den Häusern oder in den armseligen Bars entlang der Straße lungern – das sind die Soldaten der großen Armee von General Mengistu, die im Sommer 1991 an einem einzigen Tag zerfiel.»[6]
Die Vermutung, dass es sich bei den neuen Kriegen wohl eher um Staatszerfalls- als um Staatsbildungskriege handelt, wird dadurch verstärkt, dass inzwischen auch in den OECD-Ländern der Höhepunkt in der Entwicklung staatlicher Steuerungs- und Integrationsfähigkeit überschritten ist.[7] Wenn sogar hier die staatliche Administration mit der Aufgabe, komplexe Prozesse zielgenau und mit vertretbaren Kosten zu steuern, überfordert ist und seit Mitte der siebziger Jahre staatliche Kontroll- und Garantieansprüche kontinuierlich zurückgenommen worden sind, so haben vergleichbare Einwirkungen und Herausforderungen die sehr viel leistungsschwächeren und weniger robusten Staatsapparate der Entwicklungsländer regelrecht überrollt. Da ihre Eliten zudem noch nicht über das Stadium patrimonialer Macht- und Loyalitätssicherung hinausgelangt waren, ist die Art ihrer Herrschaftsausübung zumeist in offene Korruption und Ausplünderung der nationalen Ressourcen umgeschlagen. Die Notwendigkeit, die eigene Klientel fortgesetzt mit Wohltaten und Zuwendungen bei der Stange zu halten, und die Möglichkeit, die hierfür erforderlichen Geldmittel durch den Verkauf von Rohstoffen und die Vergabe von Schürfrechten oder den Handel mit illegalen Gütern aufzutreiben, hat sehr bald dazu geführt, dass zunehmend größere Anteile dieser Einkünfte für die eigene Risikovorsorge abgezweigt und auf Konten in Westeuropa oder den USA deponiert worden sind. So wurden in vielen Ländern die mühsam entwickelten Ansätze von Staatlichkeit und eines entsprechenden Ethos politischer Eliten und staatlicher Erfüllungsstäbe in kürzester Zeit ruiniert. Zwischen herkömmlichem Tribalismus und postmoderner Globalisierung sind die Ansätze von Staatsbildung in den meisten Drittweltländern buchstäblich zerrieben worden. Sie hatten, anders als im Europa der Frühen Neuzeit, keine Chance, sich zu entwickeln und die nötige Widerstandsfähigkeit auszubilden.
Dramatische Züge bekam diese Entwicklung freilich erst dadurch, dass beide Faktoren, der traditionelle Tribalismus und die neuen Formen der Globalisierung, in eben dem Maße, wie sie die Staatsbildung blockierten und deren Ansätze zerstörten, nicht nur die Entstehung von innergesellschaftlichen Kriegen begünstigt, sondern darüber hinaus auch zu deren Verstetigung beigetragen haben. Während unter den Bedingungen einer agrarischen Subsistenzökonomie, auf der das wirtschaftliche Leben im frühneuzeitlichen Europa über weite Strecken beruhte, Kriege nach geraumer Zeit schon deswegen wieder erlöschen, weil das Land zerstört, die Felder verwüstet und die Vorräte geplündert sind, ist dies bei den neuen Kriegen gerade nicht der Fall: Über die Kanäle der Schattenglobalisierung sind sie auf vielfältige Weise mit der Weltwirtschaft verbunden und beziehen daraus die für ihre Weiterführung nötigen Ressourcen. Nicht zuletzt deswegen hat sich auch der Vorschlag des amerikanischen Politikwissenschaftlers und Strategietheoretikers Edward Luttwak sehr schnell als illusorisch erwiesen, man solle diese Kriege zunächst ausbrennen lassen, um nach Erschöpfung der in ihnen einsetzbaren Ressourcen umso erfolgreicher einen stabilen und dauerhaften Frieden stiften zu können.[8] Die zeitweilig von Seiten des Westens, aber auch der Vereinten Nationen betriebene Embargopolitik, die den erhöhten Ressourcenverbrauch in Kriegen als ein Mittel zu ihrer schnelleren Beendigung nutzen wollte, schlug in nahezu allen Fällen fehl.[9] Fast immer ist es den Kriegsparteien gelungen, an die für die Weiterführung des Krieges erforderlichen Ressourcen heranzukommen – entweder auf dem herkömmlichen Weg, indem sie von einem ideologisch verbundenen oder strategisch interessierten Regime unterstützt wurden, oder weil sie auf die neuen Formen der Schattenglobalisierung zurückgreifen konnten. Das erklärt zugleich, warum ein knappes Viertel dieser Kriege inzwischen länger als zehn Jahre dauert.[10] In Angola wird seit bald dreißig Jahren gekämpft, im Sudan seit mindestens zwanzig Jahren, in Somalia seit über fünfzehn Jahren. Der Krieg in Afghanistan wird, sollte er denn jetzt tatsächlich zu Ende gehen, vierundzwanzig Jahre gedauert haben, der in Ostanatolien nähert sich, ebenso wie der in Sri Lanka, einer Dauer von zwanzig Jahren. Ohne Anlehnungsmächte, vor allem aber ohne Schattenglobalisierung wäre dies kaum möglich. Zu einer solchen Schattenglobalisierung gehören auch die bereits erwähnten Emigrantengemeinden, die durch den Transfer von Geldern, die Abwicklung von Geschäften aller Art, die Bereitstellung von Freiwilligen sowie die Aufnahme von Verwundeten und Erschöpften eine der am Krieg beteiligten Parteien unterstützen. Hierbei kommt der fast alle neuen Kriege begleitenden Entstehung von Flüchtlingslagern auf dem Territorium eines Nachbarstaates oder unter dem Schutz der Vereinten Nationen eine wichtige Rolle zu. Flüchtlingslager sind keineswegs bloß die «Müllhalden des Krieges», sondern ebenso dessen Nachschubzentren und Kraftreserven, in denen die humanitäre Hilfe internationaler Organisationen zumindest teilweise in Ressourcen für die Fortführung des Krieges umgewandelt wird.
Flüchtlingslager sind zur allgegenwärtigen Begleiterscheinung der neuen Kriege geworden. In ihnen wird das menschliche Leid und Elend dieser Kriege durch internationale Hilfsorganisationen gelindert; gleichzeitig dienen die verteilten Nahrungsmittel und Medikamente aber auch zur Versorgung der Kriegsparteien.
Hinsichtlich ihrer langen Dauer freilich unterscheiden sich die neuen Kriege kaum von den Staatsbildungskriegen im frühneuzeitlichen Europa, denn auch die konnten sich infolge eines religiös-ideologisch motivierten Ressourcenzuflusses von außen ebenfalls über viele Jahre hinziehen. Ganz im Gegensatz dazu waren die Staatenkriege, wie sie in Europa von der Mitte des 17. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts geführt wurden – von einigen Ausnahmen abgesehen – eher kurz; beide Seiten waren nämlich bestrebt, die Entscheidung der strittigen Angelegenheit in einer Schlacht auszutragen, deren Ausgang die Grundlage für die anschließenden Friedensverhandlungen bildete. Insbesondere Napoleon und der ältere Moltke haben diese auf dem Prinzip der Konzentration der Kräfte in Raum und Zeit beruhende Form der Kriegführung perfektioniert. Der Krieg wurde nach Regeln erklärt, und nach ebensolchen Regeln wurde er auch wieder beendet. Dementsprechend war er zeitlich präzise begrenzt: An seinem Anfang stand die Kriegserklärung und an seinem Ende der Friedensschluss. Auch wenn der Erste und besonders der Zweite Weltkrieg die Grundsätze dieser Art von Kriegführung vielfach durchbrochen haben, so hat der Staatenkrieg doch im Wesentlichen unsere Vorstellung vom Krieg bis heute geprägt: Er ist ein Kampf zwischen Soldaten, der nach Regeln, die als Kriegsrecht kodifiziert sind, ausgetragen wird. Nur wenn im Krieg nicht alles erlaubt ist, kann von Kriegsverbrechen gesprochen werden, die geahndet werden müssen.
All dies ist in den neuen Kriegen nicht der Fall. Nicht das Prinzip der Konzentration, sondern das der Dislozierung der Kräfte in Raum und Zeit bestimmt ihren Verlauf; meist werden sie nach den Grundsätzen des Partisanenkrieges geführt: Die Unterscheidung zwischen Front, Hinterland und Heimat löst sich auf, sodass die Kampfhandlungen nicht auf einen kleinen Geländeabschnitt beschränkt bleiben, sondern überall aufflackern können. Und vor allem wird versucht, einer größeren, womöglich entscheidenden Auseinandersetzung mit dem Gegner auszuweichen, entweder weil man sich ihm kräftemäßig nicht gewachsen sieht oder weil die eigenen Truppen für eine solche Form der Kriegführung nicht geeignet sind. In fast allen neuen Kriegen dominiert ein Typus von Bewaffneten, mit dem sich Kriege, wie sie die europäische Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts bestimmt haben, nicht hätten führen lassen. So sind die neuen Kriege dadurch charakterisiert, dass in ihnen fehlt, was die Staatenkriege gekennzeichnet hat: die Entscheidungsschlacht, die für Clausewitz «der eigentliche Schwerpunkt des Krieges» war. «Die Hauptschlacht ist um ihrer selbst willen da, um des Sieges willen, den sie geben soll und der in ihr mit der höchsten Anstrengung gesucht wird. Hier an dieser Stelle, in dieser Stunde den Gegner zu überwinden, ist die Absicht, in welcher der ganze Kriegsplan mit allen seinen Fäden zusammenläuft, alle entfernte Hoffnungen und dunkle Vorstellungen von der Zukunft sich zusammenfinden; es tritt das Schicksal vor uns her, um die Antwort auf die dreiste Frage zu geben.»[11] Solche Fragen werden in den neuen Kriegen nicht gestellt, und dementsprechend gibt es auch weder Stelle noch Stunde, an denen die Fäden des Krieges zusammenlaufen und die Entscheidung gesucht wird.[12]
Von fast allen beteiligten Parteien werden die neuen Kriege nach den Grundsätzen des, um mit Mao Tse-tung zu sprechen, «lange durchzuhaltenden Krieges» geführt. In Maos Partisanendoktrin allerdings war die Taktik des Rückzugs und Zerstreuens nach einem kurzen und schnellen Angriff bloß ein Mittel, einen zahlenmäßig sowie waffentechnisch weit überlegenen Gegner zu zermürben und seine Kräfte langsam aufzuzehren, um mit ihm in ein strategisches Gleichgewicht zu kommen; im Anschluss daran konnte die zunächst unterlegene Seite allmählich in die strategische Offensive übergehen und die militärische Entscheidung des Krieges suchen.[13] Die meisten Akteure der neuen Kriege dagegen bescheiden sich mit dem, was bei Mao «strategische Defensive» heißt: Sie gebrauchen die militärische Gewalt im Wesentlichen zum Zwecke der Selbsterhaltung, ohne je ernsthaft eine militärische Entscheidung zur Beendigung des Krieges anzustreben. Wird der Krieg von beiden Seiten mit diesen Absichten geführt, so ist klar, dass er, wenn hinreichend interne oder externe Ressourcen zur Verfügung stehen, im Prinzip endlos dauern kann. Dabei ist er oft als Krieg gar nicht mehr identifizierbar, weil kaum noch Kampfhandlungen stattfinden und die Gewalt gleichsam eingeschlafen zu sein scheint. Aber dann bricht sie plötzlich abermals hervor, und der Krieg gewinnt erneut an Intensität, bis er wieder abflaut und es den Anschein hat, er sei unbemerkt zu Ende gegangen. In der Bezeichnung der neuen Kriege als low intensity wars soll genau dieser Verlauf zum Ausdruck kommen.[14]
Die unterschiedlichen Formen der Kriegführung fußen auf unterschiedlich organisierten Ökonomien, aus denen sie ihre Kraft und Energie beziehen. War das Fundament der klassischen Staatenkriege eine zentral kontrollierte, nach Möglichkeit auf dem Autarkieprinzip beruhende Wirtschaft, die spätestens seit der Französischen Revolution durch eine umfassende Massenmobilisierung ergänzt wurde, so ist die Ökonomie der neuen Kriege durch hohe Arbeitslosigkeit, hohe Importraten und eine schwache, fragmentierte und dezentralisierte Verwaltung gekennzeichnet: «Man kann sagen, dass diese Kriegsökonomie einen neuen Typ der dualen Ökonomie repräsentiert, der vor allem in weltwirtschaftlichen Peripherien, die von der Globalisierung erfasst worden sind, auftritt.»[15]
Während die klassischen Staatenkriege durch Rechtsakte wie Kriegserklärung und Friedensschluss vom Zustand des Friedens getrennt waren und es in ihnen, wie Hugo Grotius in seinem großen Werk De iure belli ac pacis betont hat, kein Drittes zwischen Krieg und Frieden gab,[16] haben die neuen Kriege weder einen identifizierbaren Anfang noch einen markierbaren Schluss. In den seltensten Fällen wird man datieren können, wann einer dieser Kriege begonnen hat und wann die Gewalt, nachdem sie über einige Zeit erloschen ist, wieder auflodert. Die klassischen Kriege endeten durch einen Rechtsakt, der den Menschen die Gewissheit gab, dass sie nunmehr ihr Sozialverhalten und Wirtschaftsgebaren wieder auf Friedensbedingungen umstellen konnten; die meisten der neuen Kriege hingegen sind zu Ende, wenn die überwiegende Mehrheit der Menschen sich so verhält, als sei Frieden, und dabei zugleich die Durchsetzungskraft besitzt, die verbliebene Minderheit auf Dauer zu nötigen, sich ebenso zu verhalten. Das Problem ist freilich, dass in diesen Fällen die Definitionsmacht nicht bei der Mehrheit, sondern bei einer Minderheit liegt: Wo keine Staatsmacht vorhanden ist, die mit Hilfe ihrer Exekutivorgane den Mehrheitswillen durchzusetzen vermag, bestimmen diejenigen über Krieg und Frieden, die die größte Gewaltbereitschaft haben. Sie halten das Gesetz des Handelns in ihren Händen und zwingen den anderen ihren Willen auf. Das ist ein weiterer Grund für die lange Dauer innergesellschaftlicher und transnationaler Kriege: Wenn auch nur kleine Gruppen mit den Verhältnissen unzufrieden sind, die sich als Friedenszustand abzeichnen, ist es für sie ein Leichtes, den Krieg wieder aufleben zu lassen. Weil bei innergesellschaftlichen Kriegen alle zur Gewaltanwendung fähigen Gruppierungen für den Gewaltverzicht gewonnen werden müssen, sind die Friedensschlüsse, mit denen zwischenstaatliche Kriege beendet wurden, durch Friedensprozesse abgelöst worden, in deren Verlauf die Kriegsakteure auf den gemeinsamen Verzehr der Friedensdividende eingeschworen werden sollen. Diese Friedensprozesse sind in der Regel aber nur dann erfolgreich, wenn sie von einem Dritten moderiert werden, der die Gewaltoptionen der örtlichen Parteien notfalls mit überlegener Gewalt zu unterdrücken vermag und gleichzeitig erhebliche Geldmittel in den Friedensprozess investiert, um die Friedensdividende attraktiv genug zu machen. Dass unter solchen Umständen Friedensprozesse häufiger scheitern als gelingen, ist kaum verwunderlich.
In den bis Anfang des 20. Jahrhunderts geführten Kriegen gehörten etwa 90 Prozent der Gefallenen und Verwundeten zu den Kombattanten, wie sie durch das Völkerrecht definiert sind; in den neuen Kriegen am Ende des 20. Jahrhunderts ist die Opferbilanz ziemlich genau ins Gegenteil verkehrt: Bei etwa 80 Prozent der Getöteten und Verletzten handelt es sich um Zivilisten und nur bei den restlichen 20 Prozent um Soldaten, die bei Kampfhandlungen zu Schaden kommen.[17] Eine der Erklärungen für diese Umverteilung ist sicherlich im zahlenmäßigen Rückgang zwischenstaatlicher und der dramatischen Zunahme innergesellschaftlicher und transnationaler Kriege zu suchen. Aber damit ist es nicht getan. Entscheidend ist vielmehr, dass sich die Gewaltanwendung in den neuen Kriegen im Wesentlichen nicht gegen die bewaffnete Macht des Gegners, sondern gegen die Zivilbevölkerung richtet, die entweder – in so genannten «ethnischen Säuberungen», die sich bis zur physischen Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen steigern können – zum Verlassen eines Gebiets oder zur permanenten Unterstützung und Versorgung der bewaffneten Gruppen gezwungen werden soll. Vor allem Letzteres ist typisch für die neuen Kriege, und so verschwimmen in ihnen die Grenzen zwischen Erwerbsleben und Gewaltanwendung. Der Krieg wird zur Lebensform: Seine Akteure sichern ihre Subsistenz durch ihn, und nicht selten gelangen sie dabei zu beträchtlichem Vermögen. Jedenfalls bilden sich Kriegsökonomien aus, die kurzfristig durch Raub und Plünderungen, mittelfristig durch unterschiedliche Formen von Sklavenarbeit und längerfristig durch die Entstehung von Schattenökonomien gekennzeichnet sind, in denen Tausch und Gewaltanwendung eine untrennbare Verbindung eingehen.[18] Infolgedessen sind die Kriegsakteure und die ihnen verbundenen Gruppen zunehmend daran interessiert, den Krieg fortzuführen,[19] und das Mittel zur gewaltsamen Durchsetzung dieses Interesses ist nicht länger die Entscheidungsschlacht, sondern das Massaker.[20] In ihm wird nicht, wie in der Schlacht, ein bewaffneter und widerstandsfähiger Gegner zur Erfüllung eines politischen Willens gezwungen, sondern eine unbewaffnete und daher auch nicht widerstandsfähige Zivilbevölkerung wird durch exzessive Gewalt eingeschüchtert, damit sie den Bewaffneten in jeder Hinsicht zu Willen ist. Die Ökonomie des Raubes und der Plünderung beruht fast immer auf einer umfassenden Organisation von Angst. Fast alle neuen Kriege sind durch ein spezifisches Angstmanagement gekennzeichnet, das von den Bewaffneten gegen die Unbewaffneten aufgebaut und organisiert wird. In der Folge kommt es zu einer weitgehenden Entdisziplinierung der Bewaffneten; aus Soldaten werden Marodeure, für die das Kriegsrecht oder ein wie auch immer geartetes Militärstrafgesetzbuch keine Rolle mehr spielt. Dem entspricht die Tatsache, dass in den neuen Kriegen allenthalben eine starke Resexualisierung der Gewaltanwendung zu beobachten ist: von den in diesen Konflikten beinahe alltäglich gewordenen Vergewaltigungsorgien beziehungsweise regelrechten Vergewaltigungsstrategien[21] bis zu den immer häufiger vorkommenden Verstümmelungen der Opfer und der Trophäisierung menschlicher Körperteile. «Der Krieg», berichtet Hans Christoph Buch aus dem liberianischen Bürgerkrieg, «kehrt das Innere nach außen: Diese Metapher wird wörtlich wahr beim Anblick des abgeschnittenen Kopfes, der an einer Kreuzung in Monrovia die rote Verkehrsampel ersetzt und Autofahrern bis hierher und nicht weiter signalisiert. Erst bei genauerem Hinsehen erkenne ich, dass das quer über die Straße gespannte Seil, das die Auffahrt der Brücke sperrt, der Darm des Getöteten ist, dessen geköpfter Körper als makabres Stillleben auf einem Bürostuhl sitzt.»[22]
Besonders charakteristisch aber ist für die neuen Kriege die Verbindung militärischer Gewalt mit Hunger und Seuchen. Die Verstaatlichung des Krieges und die strategische Orientierung an seiner möglichst schnellen Entscheidung hatte in Europa seit dem späten 17. Jahrhundert dazu geführt, dass die vormoderne Trias von Hunger, Pest und Krieg, wie sie etwa auch in den apokalyptischen Reitern versinnbildlicht ist,[23] aufgelöst wurde und Zeiten des Krieges nicht mehr unbedingt mit Hungerkatastrophen und Epidemien einhergingen.[24] Im Gegensatz dazu sind die meisten Kriege der letzten zwanzig Jahre dadurch gekennzeichnet, dass in ihnen diejenigen, die sich nicht mit Waffengewalt Nahrung beschaffen können, dem Verhungern ausgeliefert sind oder in Flüchtlingslagern, in denen miserable hygienische Verhältnisse herrschen, von Seuchen dahingerafft werden. Die Entwicklung ist zeitweise noch durch eine Politik der Wirtschaftsembargos gegenüber Kriegsregimen verstärkt worden, durch welche diese ohne den Einsatz militärischer Gewalt zum politischen Einlenken bewegt werden sollten. Kleinkinder, Frauen und Alte entrichten insofern, auch wenn sie der Kriegsgewalt nicht unmittelbar zum Opfer fallen, in den neuen Kriegen regelmäßig den höchsten Preis. Da dieser Preis in die Opferbilanz eines Krieges gar nicht oder nur zum Teil eingeht, dürfte bei genauerem Hinsehen der Anteil von Zivilisten unter den Opfern noch um einiges höher liegen.
Es kommt also nicht von ungefähr, wenn für uns die neuen Kriege vor allem in Flüchtlingsströmen, Elendslagern und Verhungernden, nicht aber in Gefechten und Entscheidungsschlachten sichtbar werden. Die Enthegung des Krieges, die Diffusion der Gewalt bis in die äußersten Enden des gesellschaftlichen Kapillarsystems hat die neuen Kriege über die Unbestimmbarkeit ihres Anfangs wie Endes hinaus konturlos werden lassen. Weder kennen sie die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nonkombattanten, noch sind in ihnen definierte Ziele und Zwecke auszumachen, um derentwillen der Krieg geführt wird. Und wie in ihnen die Gewaltanwendung nicht zeitlich begrenzt ist, so wird sie auch nicht räumlich eingeschränkt: Innergesellschaftliche Kriege haben eine starke Tendenz, die Grenzen ihres Ursprungsgebiets zu überspringen und sich innerhalb kürzester Zeit in transnationale Kriege zu verwandeln. Schließlich gehen die Akteure dieser Kriege eine Fülle von Verbindungen mit der internationalen organisierten Kriminalität ein – sei es, um Beutegut zu verkaufen, illegale Güter zu vertreiben oder sich selbst mit Waffen und Munition zu versorgen –,[25] sodass sich verschiedentlich die Frage stellt, ob es sich bei den beobachtbaren Formen der Gewaltanwendung noch um kriegerische Gewalt oder schlichtweg kriminelle Akte handelt. Aber was heißt «Verbrechen», wenn es keine staatliche Ordnung mehr gibt? Der innergesellschaftliche Krieg in Kolumbien ist das wohl prominenteste Beispiel für diese Diffusion,[26] aber auch der Tschetschenienkrieg wird von beiden Seiten in einer Weise geführt, bei der nicht mehr klar ist, wo die Grenze zwischen Kriegshandlungen und gewöhnlicher Gewaltkriminalität verläuft.[27] «Da das Verbrechen und der Schwarzmarkt», schreibt David Rieff über den Bosnienkrieg, «im Krieg Verbündete sind, waren die meisten Händler keine gewöhnlichen Kriminellen auf der Jagd nach einer schnellen Mark, sondern Gangster in Uniform, Mitglieder der radikalsten und mordgierigsten paramilitärischen Tschetnik-Gruppen. Es war schon mehr als Ironie, dass viele der Soldaten, die sich im Hotel Bosna voll laufen ließen und anschließend krakeelend durch die Straßen von Banja Luka zogen – wobei sie beiläufig Handgranaten durch die Fenster der von Moslems bewohnten Häuser warfen –, dieselben waren, bei denen die Moslems das zum Leben Notwendigste kaufen mussten.»[28] Die Unterscheidung zwischen Gewaltanwendung und Erwerbsleben hergestellt und tendenziell durchgesetzt zu haben, war eine der häufig übersehenen Leistungen des Staates, die er allein dadurch bewirkte, dass er der faktische Monopolist des Krieges war. Insofern ist es nahe liegend, die neuen Kriege zunächst dadurch zu definieren, dass man sie gegen die klassischen Staatenkriege absetzt und auf diese Weise das spezifisch Andere und Neue an ihnen herausarbeitet.
Die Entstaatlichung des Krieges, die ihren deutlichsten Ausdruck im vermehrten Auftauchen parastaatlicher und privater Akteure findet, wird nicht zuletzt durch die Kommerzialisierung der kriegerischen Gewalt und die zunehmende Diffusion von Gewaltanwendung und Erwerbsleben vorangetrieben.[29] Für die neuen Kriege ist charakteristisch, dass der Staat sein Monopol der Kriegsgewalt verloren hat. Wenn er in ihnen überhaupt noch in Erscheinung tritt, dann nur in einer Reihe mit privaten Kriegsunternehmern, die sich teilweise aus ideologischen Gründen, vor allem aber um des Raubens und Plünderns willen den Kriegführenden zugesellt haben. Die gefürchteten Tschetniks etwa, jene paramilitärischen Gruppen und Banden, die in den jugoslawischen Staatszerfallskriegen als Freiwillige für die serbische Sache gekämpft haben, taten dies in vielen Fällen primär aus wirtschaftlichen Gründen: Die Beute, die ihnen in den Wohnungen und Häusern der Vertriebenen und Ermordeten in die Hände fiel, erlaubte ihnen zeitweilig eine Art der Lebensführung, von der sie als Zivilpersonen nur träumen konnten. In den neuen Kriegen bekommt die dem spanischen General Spinola, dem Söldnerführer Ernst zu Mansfeld und schließlich dem Schwedenkönig Gustav Adolf zugeschriebene Devise, wonach der Krieg den Krieg ernähren müsse, wieder aktuelle Relevanz: Die paramilitärischen Verbände, die Truppen der Warlords, lokale Milizen und Söldnereinheiten werden nicht von funktionsfähigen Staaten ausgerüstet und besoldet, die durch Steuern einen Teil des gesellschaftlichen Mehrprodukts für diese Zwecke abschöpfen, sondern müssen sich in der Regel selbst versorgen. Das hat zu einem unmittelbaren Anstieg der Gewalt besonders gegen Zivilisten geführt, ist sie doch das einzige Mittel, über das die Bewaffneten verfügen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und in Bürgerkriegskonstellationen ist es obendrein das effektivste Mittel hierzu: Wer eine Waffe trägt, hat nicht nur bessere Chancen zu überleben, er lebt auf diese Weise auch besser und sicherer unter Verhältnissen, in denen die Verteilung des zum Leben Notwendigen vorzugsweise mit Waffengewalt geregelt wird.
Es sind vor allem die Warlords, lokale Kriegsherren und überregionale Kriegsunternehmer, die als Protagonisten und Hauptprofiteure der Entstaatlichung des Krieges auftreten.[30]