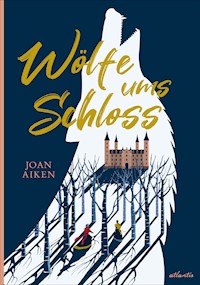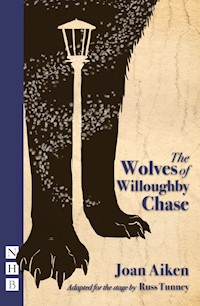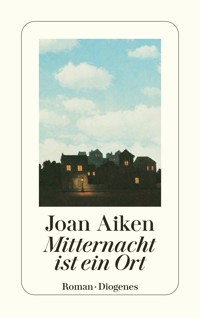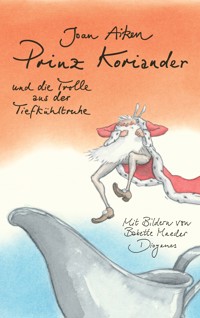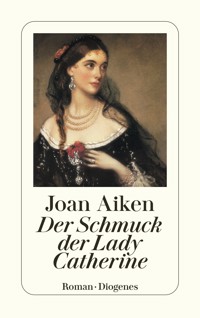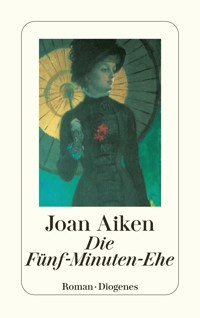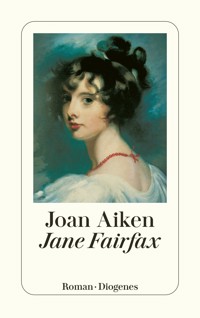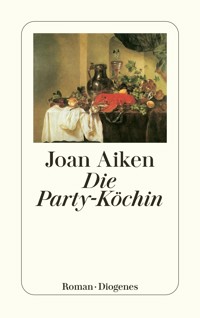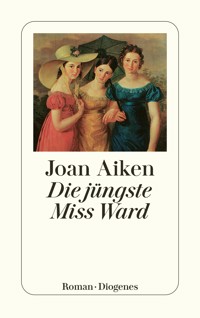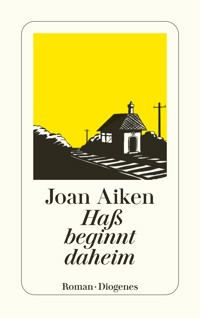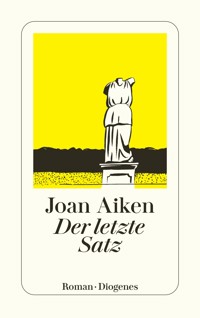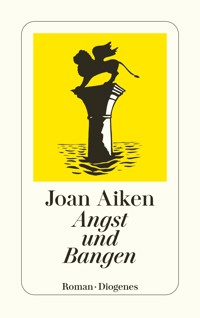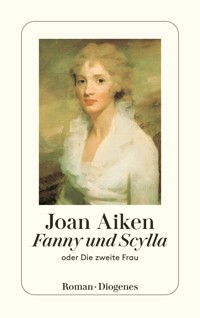
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die frisch vermählte, sechzehnjährige Fanny wird von ihrem Gatten erniedrigt und mißhandelt. Viele tausend Meilen entfernt, in Nordindien, fliehen zwei junge Menschen um ihr Leben, verfolgt von den Kriegern eines rachsüchtigen Maharadschas. 1001 Abenteuer müssen die Zwillinge bestehen, bis sie endlich in England im Haus ihrer Cousine ankommen. Hier jedoch stehen finstere Ereignisse bevor…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 979
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joan Aiken
Fanny und Scylla
oder Die zweite Frau
Roman
Aus dem Englischen von Brigitte Mentz
Diogenes
Prolog
In der Nacht des vierten April 1775 widerfuhr Henry Goble, der als Gärtner auf dem Gut des Dritten Grafen von Egremont arbeitete, etwas so Trauriges und Absonderliches, daß es ihn von heute auf morgen von Grund auf verwandelte: Aus dem freundlichen, ausgeglichenen Burschen, der es sich gerne bei einem Krug Bier, einem Würfelspiel und einer freundlichen Plänkelei wohlsein ließ, wurde ein schweigsamer, zurückgezogener, grüblerischer Menschenfeind.
Dieser Wandlung ging eine Kette von Ereignissen voraus, die durch einen unglücklichen Zufall ausgelöst worden waren. Der gutherzige Goble hatte sich als Bürge für einen Kumpanen hergegeben, einen munteren, nichtsnutzigen italienischen Landschaftsgärtner namens Ridotti, den man nach Petworth geholt hatte, wo Lord Egremont seine Hauptresidenz hatte. Dort sollte er bei der Verschönerung von Park und Garten des Petworth Guts mitwirken.
Ridotti, ein verschwenderischer, sorgloser Südländer, gleichwohl ein geschickter Gärtner, stürzte sich Hals über Kopf in hohe Schulden für modische Kleidung und eine Handvoll Bücher über Gartenpflege, wurde zahlungsunfähig und zog sich dann im nebelfeuchten englischen Winter eine Lungenentzündung zu, die ihn schnell hinwegraffte. So konnten seine Gläubiger bei ihrer Ankunft nur seine wenigen Habseligkeiten zur teilweisen Deckung seiner Schulden beschlagnahmen, und der unglückselige Goble wurde ins Gefängnis von Petworth geworfen.
Goble, ein rechtschaffener Petworther Bürger mittleren Alters, nahm seine Einkerkerung zunächst nicht allzu schwer, abgesehen davon, daß sein Stolz verletzt war. Lord Egremont, der im Moment auf seinen Gütern in Northumberland weilte, wurde in wenigen Tagen zurückerwartet, und sobald er wieder da war, würde er die erforderlichen Gelder für seinen Gärtner vorschießen, das war so klar wie das Amen in der Kirche, denn er war ein freundlicher, großzügiger Herr mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.
Einstweilen lebte sich Goble mit großem Gleichmut in seiner elenden Unterkunft ein. Außer ihm und einem betrunkenen Fuhrmann, den man wegen Pöbelei und öffentlicher Ruhestörung eingekerkert hatte, befand sich erfreulicherweise momentan niemand im Gefängnis. Während Goble an seinem Penny-Laib, seiner täglichen Brotration herumkaute, kam er zu dem Schluß, daß er nach seiner Entlassung Lord Egremont unverzüglich auf den üblen Zustand des Stadtgefängnisses aufmerksam machen mußte. Er konnte es gut und gern einflechten, während sie die neuen Rasenflächen abschritten, oder wenn sie im Park besprachen, wie tief der Zaun eingelassen werden sollte – der weite luftige Raum würde einen überaus zwingenden Kontrast bilden zu diesen zwei elenden Räumen hier, die kaum einen Meter achtzig hoch waren und zu Zeiten zehn bis zwanzig Gefangene zu beherbergen hatten, männliche wie weibliche bunt durcheinandergewürfelt. Man konnte nicht heizen, es gab kein Wasser, keinen Hof, keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Auf einem Lederbeutel, der draußen vor der Tür hing, stand die Inschrift: »Gedenket der armen Gefangenen«, aber Henry hatte in früheren Tagen, wenn er auf seinen rechtschaffenen Wegen vorbeikam, nie Essen oder Geld darin gesehen. Tatsächlich waren im Januar dieses Jahres drei von acht Insassen nach nur zwei bis drei Wochen Einkerkerung an Hunger und Kälte gestorben. Zitternd dankte Henry Goble seinen Sternen, daß Ridottis Gläubiger erst im April vorstellig geworden waren; selbst jetzt noch war der feuchtmuffige kleine Raum mit den Steinwänden und dem Backsteinboden erbärmlich kalt.
Vielleicht hat Gott mich hierhergesandt, dachte Goble, der ein frommer Mensch war, auf schlichte, aufrichtige Art; vielleicht war es Sein Wille, weil Er denkt, daß ich Seine Lordschaft dazu bewegen könnte, diese Stätte herzurichten.
Nachdem diese Angelegenheit zu Henrys Zufriedenheit gelöst war, erleichterte er sich widerstrebend (da kein Gefäß vorhanden war) in einer Ecke, wälzte sich auf ein Strohbündel und bemühte sich, seine Lage im Schlaf zu vergessen.
Es gelang ihm nicht. Der Raum war zu kalt, zu feucht, zu übelriechend. Der Gestank – nicht zu vergleichen mit dem Geruch anständigen Gartenmists – quälte ihn, die feuchte Luft drang ihm durch Mark und Bein. Der Fuhrmann befand sich jenseits von Gut und Böse und schnarchte nervenzerreibend in seiner Ecke.
Schließlich verlor Goble die Geduld und schrie nach dem alten Wärter.
»Bring ein halbes Dutzend Kerzen, Mudgeley, du alter Dachs!«
Kerzen würden zumindest den Gestank etwas vertreiben, und er konnte seine Hände darüber wärmen.
»Kerzen? Un wo krieg ich das Geld her für die?« erwiderte Mudgeley griesgrämig jenseits der Tür. Er war verärgert, weil man ihn aus seinem ersten Schlaf gerissen hatte.
»Meine Mutter wird es dir morgen früh geben, das weißt du genau.«
»Ah – un daß es ’ne Schande is, wird die denken, daß ihr Sohn eingelocht is«, sagte Mudgeley boshaft.
Gobles Eltern betrieben eine Bäckerei in einer engen Straße namens Bywimbles, in der Nähe der Kirche.
»Geht dich nichts an, was sie denkt, bring mir jetzt Licht!« sagte Goble.
»Schon gut, schon gut«, brummte Mudgeley und humpelte langsam davon zu einer Kiste, in der er verschiedene verderbliche Waren vor den Ratten verwahrte. Als er schließlich wieder auftauchte, schob er ein Bündel Talgkerzen durch ein Gitter in der Tür mit der Bemerkung: »Ruf mich bloß nich nochmal – du kannst nämlich brüllen, solang wie du willst, ich werd mich ’n Dreck drum scheren.« Und er zog sich auf sein eigenes schmuddeliges Lager zurück.
Goble schichtete das feuchte Stroh unter sich auf und stellte die Kerzen in einem Ring auf, befestigte sie mit ihrem eigenen Wachs auf den Backsteinen und kauerte sich über sie und wärmte seine Hände in der bescheidenen Wärme. Wie lange sie wohl brennen würden – ein paar Stunden, drei vielleicht? Um fünf wurde es hell, er mußte also nur zwei Stunden Dunkelheit überstehen.
Er versuchte mit aller Kraft, sich abzulenken, indem er Pläne machte: Er würde Erbsen säen und eine Ladung Kies für die Rasenanlage anfordern, und er mußte Seine Lordschaft daran erinnern, daß er die jungen Bäume im Park einzäunen mußte, weil das Wild sie sonst anknabberte.
Dann hob er den Blick – denn ein weißes, flammendes Leuchten, stärker als das Kerzenlicht, fesselte sein Auge – und sah ein leibhaftiges Gespenst vor sich.
Henry Goble hatte nie zuvor in seinem Leben einen Geist gesehen, aber nun hatte er einen vor sich, das stand außer Frage: Ein durchsichtiges, nebelhaftes, schimmerndes, waberndes Etwas mit einem erkennbaren menschlichen Gesicht und zwei durchdringenden Augen, die ihn kummervoll anstarrten.
»He! W-Was willst du?« flüsterte Goble. Die Erscheinung war ein einziges trauriges, aufrichtiges Flehen. Goble hatte keine Angst um sich, aber dennoch weckte der geisterhafte Besucher in ihm ein tiefes Gefühl drohenden Unheils.
»Mein Name ist Wilshire!« verkündete das Gespenst. »Ned Wilshire – der arme, arme Ned Wilshire. Vergiß das nie!«
Später, in den zahllosen Nächten, in denen Goble über dieses Ereignis sinnierte, konnte er sich nie mehr daran erinnern, wie die Geisterstimme geklungen hatte – er wußte nur noch, daß sie seltsam durchdringend war und direkt in seine Seele einzudringen schien, ohne Umweg über seine fleischlichen Ohren. Bis zu seinem Tode blieb ihm jedes Wort, das die Erscheinung an ihn gerichtet hatte, im Gedächtnis haften, als wäre es in Granit gemeißelt. »Mein Name ist Wilshire, und ich bin an dieser Stätte elendiglich verhungert! Ich will Vergeltung. Wenn mein herzloser Bruder sich um mich gekümmert hätte, wäre ich jetzt noch am Leben. Vergiß den armen Ned Wilshire nicht – den armen Ned Wilshire, der an Hunger gestorben ist! Ich wünsche, daß mein Bruder aufgespürt werde und meine Qual über sein Haupt komme. Vergiß mich nicht!«
Dann löste sich die Erscheinung auf typische Geisterart unversehens wieder auf, ohne den Namen des Bruders oder seinen Aufenthaltsort anzugeben oder zu verraten, ob der Bursche überhaupt noch am Leben war.
Es versteht sich von selbst, daß der arme Goble nach diesem schauerlichen Besuch die noch verbleibenden Stunden dieser Nacht wach blieb, starr vor Kälte und Furcht, während seine Kerzen vor sich hin flackerten und verlöschten. Als schließlich der Morgen graute, wurde der alte Mudgeley von Boxall, dem Tageswärter, abgelöst, einem entfernten Cousin von Goble, dessen Jahreseinkommen von zwanzig Pfund ihn nicht zu stolz machte, mit den Gefangenen zu plaudern. Von ihm wollte Goble sofort wissen, ob je ein gewisser Ned Wilshire im Gefängnis von Petworth gesessen hatte. Wilshire war kein einheimischer Name. Boxall konnte sich nicht an so einen Namen erinnern, aber er war erst zwei Jahre im Amt. Er erklärte sich gutmütig bereit, in den Akten nachzusehen, und kam alsbald mit der Kunde zurück, daß tatsächlich ein Wilshire aufgeführt wurde, der vor drei Jahren am Kerkerfieber gestorben war.
»Das ist ja nicht zu glauben! Er hat dir tatsächlich die Wahrheit gesagt«, wiederholte Boxall mehrmals voller Staunen, als könne man Geistern normalerweise nicht trauen, und einer, der die Wahrheit sprach, wäre etwas ganz Absonderliches.
»Wilshire? – Wo der wohl herstammt?« murmelte Henry Goble. Bis jetzt fühlte er nur leichten Unmut – die Erschöpfung eines vielbeschäftigten Mannes, dem man eine neue, unerwartete Aufgabe aufgebürdet hatte, obwohl er schon genügend zu tun hatte. Irgendwie sah er sich genötigt, den Bruder dieses Mannes ausfindig zu machen, um ihm sein sträfliches Versäumnis vorzuhalten.
»Vielleicht kommt er von Wiltshire«, schlug Boxall hilfreich vor. »Da gibt’s viele Leute dort in der Gegend, hab ich gehört.«
Diesem wenig ergiebigen Gespräch wurde jäh ein Ende bereitet, als vor dem Gefängnis laut rumpelnd ein Vierspänner vorfuhr.
»Hallo! Aufmachen!« bellte draußen eine Stimme.
»Was soll das denn nun?« murmelte Boxall, während er zum Eingang stapfte. »Heut is kein Schiedsgerichtstag nich, und das is auch nich die Stimme von Wachtmeister Hoad; außerdem is der sowieso in Byworth.«
Wie sich herausstellte, befanden sich in der Kutsche ein paar Rekrutierungsbeamte auf dem Weg von Godalming nach Portsmouth. Sie hatten einen Schmugglertrupp gefangen. Die Männer waren aneinandergekettet und wirkten sehr niedergeschlagen, aber die Beamten waren übel gelaunt, weil sie gehofft hatten, bei einem mitternächtlichen Überraschungsschlag an einem wohlbekannten Schmugglertreffpunkt namens Gunshot Heath am andern Ende von North Chapel einen erheblich größeren Fang zu tun. Offenbar hatte man Wind bekommen von ihrer Absicht, und die Ausbeute war geringer ausgefallen als erwartet.
»Wir werden dich von deinen Vögeln befreien, auf die Weise kannst du immerhin einige Lebensmittel sparen«, sagte der Rekrutierungsbeamte zu Boxall.
»Äh, da weiß ich nichts von – von Rechts wegen muß der Magistrat das wissen, bevor sie die mitnehmen«, sagte Boxall zweifelnd.
»Misch dich da nicht ein, verdammt nochmal – hier ist mein Berechtigungsschein, und du bekommst einen Beleg für sie, soll alles schön seine Ordnung haben. Macht schon«, rief er seinen Männern zu, »holt sie raus!«
Mit größtem Widerstreben fügte sich Boxall. Goble und der benommene Fuhrmann wurden in die Kutsche gestoßen und mit der Schmugglerbande zusammengekettet. Goble war kaum weniger benommen als der Fuhrmann angesichts der plötzlichen Wende seines Schicksals; natürlich wußte er von den Fangzügen der Presspatrouillen, aber im Schutz des Anwesens Seiner Lordschaft hatte er nie damit gerechnet, daß man ihn ergreifen könnte, und außerdem hatte er bereits die obere Altersgrenze von fünfundfünfzig Jahren erreicht, mit der jeder Mann in Sicherheit sein sollte; aber für Gefängnisinsassen gab es natürlich keine Begrenzung, sie waren Freiwild für alle.
»Gib meiner Mutter Bescheid«, sagte er, seine Sprache wiederfindend, zu Boxall, der immer noch verdattert in der Tür seines leeren Gefängnisses stand. Dann knallte die Peitsche des Kutschers, die Pferde fielen in Trab, und die Kutsche rasselte aus der Stadt hinaus. Goble sollte Petworth in den nächsten dreizehn Jahren nicht wiedersehen. In dieser Zeit hatte er unendlich viel Gelegenheit, über den letzten ergreifenden Auftrag vom armen Ned Wilshire nachzusinnen.
1
Als die sechzehnjährige Fanny Herriard durch Vermittlung ihres Vaters, des Reverend Theophilus, und mit seiner vollen Billigung und Befürwortung dem achtundvierzigjährigen Thomas Paget, dem Regulating Officer von Gosport, versprochen wurde, machte sie sich keinerlei romantische Illusionen bezüglich dieser Partie. Sie unternahm nicht den geringsten Versuch, sich selbst davon zu überzeugen, daß Mr. Paget ein heldenhafter oder schneidiger Mann war – obwohl er sich vorzugsweise Captain Paget nennen ließ. Sie wußte, daß ein Regulating Officer sich in Wahrheit kaum von einem Zivilisten unterschied – und außerdem wußte sie von ihrem Papa, daß Mr. Paget nur den Rang eines Leutnants innehatte. Dazu kam, daß ihr zukünftiger Bräutigam Witwer war, mit zwei Töchtern, die älter waren als Fanny, und einer jüngeren Tochter, und bis zu diesem Jahr hatte er kaum mehr besessen als seinen Tagessold von einem Pfund, dazu zehn Schillinge für seinen Lebensunterhalt. (Seine frühere Frau, so war anzunehmen, hatte etwas eigenes Geld mit in die Ehe gebracht.)
Jüngst nun wurde Captain Paget überraschend vom Schicksal begünstigt, so daß er sich in der Lage sah, an eine zweite Heirat zu denken, diesmal eher zum Vergnügen denn aus praktischen Gründen. Eine entfernte Cousine von ihm, die er nie persönlich kennengelernt hatte, war in den Genuß einer gewaltigen – und gänzlich unerwarteten – Erbschaft gelangt, als sie sich gerade mit einem reichen Mann von hohem Rang verehelicht hatte; und sie hatte die erfreuliche, großzügige Idee, die weniger begüterten Mitglieder ihrer Familie aufzuspüren, um ihr Glück mit ihnen zu teilen. Der erstaunte Thomas sah sich daher nicht nur aus heiterem Himmel mit einem stattlichen Einkommen beschenkt, genug, um ihn in die Lage zu versetzen, ein florierendes Geschäft zu betreiben, sondern er gelangte darüber hinaus auf unbestimmte Zeit in den Besitz eines größeren und weit komfortableren Hauses als sein eigenes, zu einem sehr günstigen Pachtpreis.
Der Grund für dieses zusätzliche Glück lag in der hingebungsvollen Zuneigung seiner großzügigen Cousine Juliana zu ihrem frischangetrauten Gatten, einem holländischen Edelmann, der bis zu seiner Heirat als persönlicher Diener und Geheimsekretär in der Entourage des Prinzen von Wales gedient hatte. Graf van Welcker hatte im vorigen Jahr, 1796, zu seiner Freude alten Familienbesitz in Demerara zurückgewonnen, aufgrund einer Wiedereroberung dieser Region für das britische Imperium durch Laforey und Whyte. Das hatte zur Folge, daß der Graf gezwungen war, sich aus den Diensten des Prinzen beurlauben zu lassen und eine Reise zu unternehmen, die einige Jahre dauern konnte. Seine Braut, der die Vorstellung einer derart langen Trennung unerträglich war, hatte beschlossen, ihn zu begleiten, und hatte daher Thomas Paget liebenswürdigerweise ihr eigenes Haus in Petworth bis zu ihrer (zweifellos in weiter Ferne liegenden) Rückkehr überlassen.
Trotz all dieser Vorteile konnte man nicht sagen, daß Captain Paget als Person besonders erfreulich oder interessant war: Er war ein unansehnlicher, hagerer, spröder Mann, mit rotblondem Haar, ziemlich schmalen Lippen, blaßblauen Augen und verfärbten Zähnen; an einer Hand fehlten ihm zwei Finger, und er redete kurz und abgehackt. Aber man durfte immerhin hoffen, daß er nun, da er selbst so generös bedacht worden war, bislang unterdrückte liebenswürdige und großherzige Züge entfalten würde. Einige von Fannys Schwestern jedenfalls (sie war die jüngste von acht) dachten oder sagten, daß Fanny von Glück reden konnte, wahr und wahrhaftig, wenn man bedachte, daß der Papa jeder seiner Töchter nur zweihundert Pfund Mitgift geben konnte. Der Reverend Theophilus Herriard war ein hart arbeitender Pfarrer der Church of England, seit langem verwitwet, und seine Töchter konnten froh sein, wenn sie überhaupt einen Ehemann abbekamen.
Aber allein Fanny, ein scheues, feinfühliges Mädchen mit einem beträchtlichen Vorrat an empfindlichem Stolz, kannte das volle Ausmaß ihres Glücks: Durch die Heirat war sie in der Lage, von Zuhause wegzukommen, bevor ihre adleräugigen Schwestern das Ausmaß der Qual herausfanden, unter der sie litt, seit Barnaby Ferrars, der sorglose Sproß des Gutsherrn, sie zurückgewiesen hatte.
»Heirat?« hatte er herzlich lachend gesagt. »Du meinst, wir könnten heiraten? Oh, du Gänschen, das würde mein Vater nie zulassen! Nein, nein, nein, liebes kleines Schätzchen, wir gleichen zwei Schmetterlingen, die in der Luft herumschweben und tanzen und sich küssen – so! – und dann weiterflattern zu anderen Begegnungen; du wirst einen guten, freundlichen, achtbaren Burschen finden, der dich jeden einzelnen Tag deines Lebens verhätscheln und verwöhnen wird; und ich – ich werde dich, liebe kleine Rose, und unsere glücklichen Schäferstündchen bei der Heuernte nie vergessen, wenn ich dereinst mit irgendeiner vermögenden Dame verheiratet bin, die die Löcher stopfen wird, die mein Vater durch seine Spielleidenschaft in seinen Besitz gerissen hat. Gold – Gold – ich muß für Gold verkauft werden, mein Engel –«, und er hatte sie mit einer Butterblume unterm Kinn gekitzelt. Denn ihre Liebelei – der Himmel wußte es, wie unschuldig sie war – hatte sich in einem warmen, sonnigen Juni entfaltet, als das ganze Dorf – Schulkinder, Großeltern, Gutsherrensöhne und Pfarrerstöchter – in den Wiesen mithalf, das kostbare Heu einzubringen. Aber dann hatte Barnabys Vater sein Versprechen wahrgemacht und seinem Sohn einen Offiziersposten bei den Husaren erkauft. Als Barnaby einige Wochen später pfeifend vorbeigekommen war, um die Herriard-Familie, die gerade beim abendlichen Tee versammelt war, darüber zu informieren, daß seine Abreise bevorstand, war Fanny glücklicherweise in der Lage gewesen, sich mit den Resten ihres Stolzes und ihrer Würde zu wappnen – gerade ihr beherrschtes und zurückhaltendes Wesen hatte er, wiewohl sie es nicht wußte, besonders anziehend gefunden –, und so erzählte sie ihm, mit Anstand ihr brechendes Herz verbergend, daß ihre eigene Verlobung arrangiert worden sei; daß sie im September Captain Paget, einen Schulkameraden ihres Vaters, heiraten werde.
»Das ist ja wunderbar! Liebe kleine wilde Rose, ich freue mich, das zu hören. Viel Glück euch beiden«, sagte Barnaby ziemlich uninteressiert, und nachdem er die Herriards darüber in Kenntnis gesetzt hatte, daß sein Regiment nach Indien beordert war, wo es ein scharfes Auge auf Tippoo Sahib haben sollte, sagte er ihnen allen sorglos Lebewohl und zog beschwingt durch die Dämmerung davon.
»Barnaby ist überaus selbstgefällig«, sagte Harriet.
»Eigentlich sollte der Gutsherr ihn verheiraten, damit er einen Erben bekommt, bevor er in die Ferne zieht«, sagte Maria.
»Maria, solche Gedanken sind dir nicht förderlich, und wir haben ohnehin nichts damit zu schaffen«, tadelte sie ihr Vater.
»Mir kam es mal so vor, als hätte Barnaby ein Auge auf unsere Fanny geworfen«, sagte Kitty mit einem hämischen Seitenblick auf ihre jüngste Schwester. Aber Fanny sagte nichts, beugte nur den Kopf tiefer über ihre Näharbeit – sie säumten gemeinsam die Leintücher für ihre Aussteuer – und war überaus erleichtert, als der Pfarrer sagte: »Genug geplaudert, Kinder. Es ist Zeit fürs Abendgebet.«
Im September gehörten die heißen Monate der Heuernte längst der Vergangenheit an, und im nassen grauen Herbstwetter half Captain Paget seiner jungen Braut nach der schlichten Trauung, die ihr Vater gehalten hatte, in die Kutsche, die sie von Sway in New Forest, wo Fanny ihr ganzes bisheriges Leben verbracht hatte, zu ihrem neuen Heim in Sussex bringen sollte.
Es war eine kalte, trübselige Reise. Regen drang durch die Ritzen der klapprigen Mietskutsche, verwandelte die Straßen in Morast, und die Stoppelfelder vor und hinter der Mautschranke präsentierten sich in einem unappetitlichen Graubraun. Dennoch hatte Fanny, die noch nie in ihrem Leben gereist war, ein offenes Auge für alles, was sie sah. Obwohl es ihr sehr unwahrscheinlich erschien, daß sie ihren wortkargen Bräutigam je lieben könnte, war sie ihm über die Maßen dankbar, daß er sie von ihren wachsamen Schwestern und einem Zuhause, das mit qualvoller Trauer behaftet war, wegbrachte. Sie hatte die ehrliche Absicht, freundlich, liebevoll und fügsam zu sein, und sich nach Kräften zu bemühen, eine erfolgreiche Ehe zu führen.
Aber sie mußte bald feststellen, daß ihre höflichen Fragen und Kommentare bezüglich der Dörfer, die sie passierten, höchst unwirsch aufgenommen wurden. Captain Pagets schreckliches Gewerbe machte es erforderlich, daß er nahezu die ganze Woche unterwegs war, zu Pferde oder mit der Kutsche; die Landschaft interessierte ihn nicht, und im Moment war er nur von dem Wunsch besessen, nach Hause zu kommen und die neue Ära ehelicher Genüsse so unverzüglich wie möglich feierlich einzuleiten. Er überhörte Fannys höfliche Bemerkungen und fuhr den Kutscher scharf an, die Pferde anzutreiben und sie nach Petworth zu bringen, bevor aus dem Regen eine Sintflut wurde.
Weise beschloß Fanny zu schweigen. Aber schon einen Augenblick später vergaß sie ihren Vorsatz wieder, weil sie etwas über das Haus erfahren wollte, zu dem sie unterwegs waren, und sie fragte versonnen: »Wird Ihre Cousine Juliana uns empfangen, wenn wir ankommen?«
Eine Cousine, und zudem eine so gütige und gutsituierte Cousine, wäre gewiß eher dazu geneigt, freundlich zu sein, als ihre Stieftöchter, diese recht beängstigenden, unbekannten Wesen, die nicht zur Hochzeit erschienen waren, da ihr Vater das nicht für notwendig erachtet hatte.
»Juliana? Nein, nein, die ist schon mitten auf dem Ozean, sie und ihr prächtiger holländischer Ehemann.«
Wenn man bedachte, mit welchem Segen die Gräfin van Welcker ihn überschüttet hatte, klang Mr. Pagets Ton nicht gerade herzlich, dachte Fanny; es ist weit schwerer, dankbar zu empfangen als zu geben, und vielleicht war ihm auch bereits aufgegangen, daß es seine eigenen Probleme mit sich brachte, wenn man derart großzügig beschenkt wurde.
»Wie heißt das Haus Ihrer Cousine, Sir?«
»Hermitage«, sagte er kurz angebunden, in einem Tonfall, der nahelegte, daß er diesen Namen für verstiegen hielt und ihn gern durch einen schlichteren ersetzen würde, wenn es in seiner Macht läge. Er fügte hinzu: »Ich glaube, früher war ein Kloster auf dem Grundstück; zweifellos ist der Name so zu erklären.«
»Hermitage!« Fanny schauderte, für sie klang der Name kalt und furchterregend. Sie zog die Wagendecke enger um ihre Schultern.
»Und was für ein Haus ist es, Sir?«
»Was für ein Haus? Was für ein Haus? Ein Haus eben.«
»Nein, verstehen Sie mich recht, ist es alt oder neu? Liegt es direkt in Petworth oder außerhalb auf dem Land?«
Captain Paget antwortete kurz, daß es, soweit er wußte, ein neues Haus war, in den letzten zwanzig Jahren gebaut, und es lag am Rand der Stadt, die ungefähr dreitausend Einwohner hatte.
»Wie sonderbar es sein wird, in einer Stadt zu leben«, murmelte Fanny und fügte, in dem Bemühen freundlich und munter zu erscheinen, hinzu: »Ich bin sehr auf die Geschäfte gespannt und auf die Lagerhäuser und die Buden auf dem Markt.«
»Man wird dich dort gewiß nicht häufig sehen. Eine gute Hausfrau weiß alles so einzurichten, daß sie ihr Heim nach Möglichkeit nie verlassen muß«, lautete die recht entmutigende Antwort ihres Ehemanns.
Fanny hatte bereits erfahren, daß in ihrem neuen Heim vier Dienstboten beschäftigt waren: eine Köchin, ein Hausmädchen, ein Jungknecht und ein Mann für Arbeiten außerhalb des Hauses, der über dem Stall schlief und für den Garten und die Pferde zuständig war. Die Aussicht, die Verantwortung für so ein großes Anwesen übernehmen zu müssen, erschreckte sie, und sie sagte ängstlich:
»Werden Sie weiterhin Ihrem Gewerbe nachgehen, Sir, da Sie doch jetzt die Mühle erworben haben?« Man hatte ihr nämlich erzählt, daß Captain Paget mit einem Teil des Geldes seiner Cousine eine kleine Kornmühle in Haslingbourne erworben hatte, eine Meile von Petworth entfernt, deren Erträge sein Einkommen ordentlich aufstocken würden.
»Meinem Gewerbe nachgehen? Natürlich!« sagte er schroff. »Wie kommst du darauf, daß ich es nicht tun könnte?«
»Ich habe – ich meinte nicht –« Fanny wußte, daß sie auf keinen Fall offenbaren durfte, wie abstoßend sie das Gewerbe ihres Gatten fand, sie stammelte daher etwas davon, wie bedauerlich es sei, daß er somit gezwungen sei, so oft von zu Hause wegzusein.
Thomas Paget sah ungeduldig aus dem Kutschenfenster – sie fuhren langsam einen steilen Hügel hinab, und der Kutscher war gezwungen, die Bremsen anzuziehen, sonst wäre das Fahrzeug schneller und schneller losgerattert und außer Kontrolle geraten. Fanny sah aus dem anderen Fenster auf eine blaugraue, neblige Waldlandschaft hinaus, in der weit und breit kein Haus zu sehen war, und kämpfte verzweifelt mit den aufsteigenden Tränen.
Ihr Hals war eng, wie zugeschnürt, sie schluckte und preßte die Hände zusammen. Zum hundertsten Male kam ihr der Nachmittag bei der Heuernte in den Sinn – der Höhepunkt ihrer Tändelei mit Barnaby, wie sich herausstellen sollte, obwohl sie damals gedacht hatte, daß es nur das Vorspiel war zu größerer, unendlicher Glückseligkeit. Er war ihr hinter einer frisch errichteten Garbe begegnet und hatte sie mit einem Regen leichter, lachender, frecher Küsse auf Gesicht und Hals überfallen, bis die Stimmen von zwei anderen Erntehelfern sie schuldbewußt auseinanderstieben ließen. Sie war benommen vor Freude, das Blut prickelte in ihren Adern wie hausgemachter Apfelmost, und sie glaubte in diesem Moment, daß ein Leben voller Glanz und Seligkeit vor ihr lag.
Und alles hatte so bald ein Ende gehabt!
Fanny spähte über den Rand ihrer Wagendecke zu ihrem grauhaarigen Bräutigam hinüber und fragte sich, ob sie je so für ihn empfinden könnte.
Captain Paget hatte sie erst einmal geküßt – eine kurze, förmliche Berührung der Lippen nach der Trauung. Er ist ein kalter Mann, dachte Fanny recht erleichtert, er ist ja auch schon alt und hat womöglich nichts mehr mit Küssen und Kosen im Sinn. Eigentlich ganz gut, weil es mir sicher keinen Spaß machen würde. Mit ihm ganz bestimmt nicht.
Fanny, die mit ihren Schwestern nach alter Tradition unaufgeklärt im Pfarrhaus aufgewachsen war, hatte nur eine überaus verschwommene, völlig unzulängliche Vorstellung davon, was Ehemänner mit ihren Ehefrauen trieben. Ihre Mutter war kurz nach ihrer Geburt gestorben, und die Herriard-Mädchen wurden von ihrem Vater davon abgehalten, mit den Dienstboten zu schwatzen, die in dem betriebsamen, ärmlichen Haushalt ohnehin so hart arbeiten mußten, daß ihnen keine Zeit blieb, den jungen Damen Geschichten zu erzählen. Anläßlich ihrer Verlobung hatte ihr Vater widerwillig ein kurzes Gespräch mit ihr geführt, in dem er sie darüber belehrte, daß sie und ihr Gatte ein Fleisch würden – eine schwer verständliche, abstoßende Formulierung –, und daß sie sich fraulich und ergeben allem zu fügen habe, was er von ihr verlange. Das hatte sie versprochen und würde es auch halten, beschloß Fanny. Schluckend versuchte sie die Erinnerung an Barnabys feste junge Lippen auf ihrem Nakken zu verscheuchen, aber sie hoffte fieberhaft, daß die weibliehen Pflichten nicht gar zu viel erfordern würden. Vielleicht würde Mr. Paget, der immerhin schon drei Kinder hatte, sie nur umarmen und mit ihr kosen, wie ein Vater; ihr eigener Vater hatte dazu nie Zeit gefunden; das wäre angenehm und erfreulich, dachte Fanny hoffnungsvoll, und wenn er das tat, gelang es ihr vielleicht ganz leicht, ihm freundliche Zuneigung entgegenzubringen wie eine Tochter.
Er sah sich nach ihr um und trommelte mit den Fingern auf die Armlehne, und sie warf ihm ein gezwungenes, nervöses Lächeln zu.
»Sind das etwa Tränen in deinen Augen? – Was hat das zu bedeuten?« fragte er mit vor Argwohn scharfer Stimme.
»Es – es ist etwas kalt. Und ich habe – gerade einen Moment lang – mein Zuhause vermißt«, stammelte Fanny.
Ihr Ehemann unterzog sie einer neugierigen, durchdringenden Musterung. Er schien ärgerlich, feindselig, gar eifersüchtig. Ganz gewiß konnte niemand ihm etwas über ihre kurze Romanze erzählt haben, dachte sie angstvoll, niemand konnte den Namen Barnaby Ferrars erwähnt haben. Niemand hatte es gewußt – keine Seele – nicht einmal ihre Schwestern. Außerdem hatte sich keine von ihnen je allein mit Captain Paget unterhalten. Sie selbst war bis heute nie mit ihm allein gewesen. Und ihr Vater hatte zum Glück nicht die geringste Ahnung, daß sie und Barnaby je mehr als ein paar Worte ausgetauscht hatten.
Nein, Captain Paget konnte nichts wissen. Seine folgenden Worte bestätigten es ihr.
»Du bist wahrhaftig fast noch ein Kind«, sagte er. »Als dein Vater mir vorgeschlagen hat, eine seiner Töchter zu heiraten, habe ich ganz bewußt dich, die Jüngste, ausgewählt.«
»Wir – wir haben uns gefragt, warum – wo Kitty doch viel hübscher ist –«, wagte Fanny zu bemerken.
Als ›hübsch‹ konnte man Fanny sicher nicht bezeichnen. Sie hatte ein ovales Gesicht mit einem spitzen Kinn, eine gerade, fein geschwungene Nase, dunkle haselnußbraune Augen und einen sensiblen Mund. Über das Muttermal auf ihrem rechten Wangenknochen hatte ihre Schwester Kitty oft häßliche Bemerkungen gemacht, und auch Fanny selbst war es ein Ärgernis. Ihr war nicht bewußt, daß es ihrem Gesicht etwas Besonderes verlieh und daß modebewußte Damen in London genau an diese Stelle einen Schönheitsfleck plazieren würden, um der klassischen Ebenmäßigkeit ihres Antlitzes eine besondere Note zu geben. Sie war keine Schönheit, aber wer einmal ein Auge auf sie geworfen hatte, kam nicht so leicht wieder los. Das auf den ersten Blick ruhige, spröde, gleichmäßige Gesicht konnte sich blitzartig beleben und wache Intelligenz ausstrahlen. Ihr glänzendes, seidiges haselnußbraunes Haar, das genau den gleichen Farbton hatte wie ihre Augen, schmiegte sich weich um ihren schmalen, nußförmigen Kopf und war im Nacken zu einem Knoten geschlungen.
»Papperlapapp!« sagte Captain Paget ziemlich schroff. »Was bedeutet Schönheit? Wenn die Blume blüht, versammeln sich die Bienen. Ich wollte mir eine Braut sichern, die ihre Reize noch nicht spielen ließ – nicht spielen lassen konnte. Dein Vater hat mir versichert, daß das für dich zutrifft. – Das stimmt doch hoffentlich?« stieß er plötzlich hervor.
»J-Ja, Sir«, log Fanny und grub sich die Fingernägel in die Handflächen.
»Das will ich auch gehofft haben! Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. – Ah, endlich erreichen wir Petworth«, fuhr er in einem anderen Tonfall fort und blickte in die regenfeuchte Dämmerung hinaus. »In zehn Minuten sind wir daheim, dem Himmel sei Dank. Ich hoffe, daß diese zwei Gänse und meine Schafsköpfe von Dienern alles einigermaßen ordentlich und behaglich eingerichtet haben.«
»War denn das Haus nicht eingerichtet, Sir?« wollte Fanny wissen, die ungeheuer erleichtert war über den Wechsel des Gesprächsthemas.
»Wäre ich genötigt, Möbel herbeizuschaffen, wenn es möbliert gewesen wäre?« sagte er ungehalten. »Nein – meine Cousine Juliana hat sich – aus Gründen, die nur ihr selbst bekannt sind – dazu entschlossen, sämtliches Mobiliar und alle Haushaltsgegenstände nach Demerara mitzunehmen.«
Inzwischen hatten sie Petworth erreicht. In dem Zwielicht war wenig von der Stadt zu erkennen, abgesehen vom Zollhaus und einigen Fachwerkhäusern. Die Kutsche ratterte durch enge gepflasterte Straßen und hielt mit einem Ruck auf dem kiesbedeckten Vorplatz eines Gebäudes an, das man nur verschwommen als einen schlicht aus Stein und Backstein erbauten Herrensitz erkennen konnte.
Sowie die Kutsche anhielt, flog die Eingangstür auf, und verzagt erblickte Fanny mindestens ein halbes Dutzend Personen. Einige davon waren offensichtlich Dienstboten, die unverzüglich von Thomas damit beauftragt wurden, das Gepäck abzuladen, und er drängte Fanny durch die Tür und schob dabei zwei junge Damen und ein Kind unsanft beiseite.
»Martha, Bet, macht doch Platz. Herrgott, wie soll ich denn so ins Haus kommen? Nein, Fanny möchte keinen Tee trinken – warum sollte sie ihre Eingeweide malträtieren und ihre Verdauung schädigen mit solchem Zeugs, wenn es in einer halben Stunde Essen gibt? Bis dahin wird sie es gut aushalten. Guter Gott, was für ein rauschender Empfang – was habt ihr bloß um alles in der Welt angestellt?« fuhr er zornig fort und ließ den Blick in der Eingangshalle schweifen, die sie gerade betreten hatten. Es war ein mittelgroßer Raum, der tatsächlich einen trostlosen Anblick bot, mit halbausgerollten Teppichen, halbausgepackten Kisten, verstreutem Stroh und willkürlich ausgewählten Möbelstücken, die man provisorisch aufgestellt hatte.
»Die Karren mit den Möbeln sind erst vor einer Stunde angekommen –« setzte die größere der jungen Damen an.
»Schweig! Martere meine Ohren nicht mit Ausflüchten! Ihr hättet ja einen Boten aussenden können, um sie anzutreiben. Ich will jetzt nichts weiter hören. Vielen Dank! Ich bringe jetzt Fanny nach oben auf mein Zimmer – und ich hoffe, daß wenigstens das ordentlich ist.« Er brachte das in einem derart furchterregenden Ton hervor, daß beide Mädchen im Chor ausriefen:
»O ja, Papa! Und ein Feuer brennt –«
»Gut – und wenn wir wieder hinunterkommen, ist diese Unordnung beseitigt und das Essen fertig. Kümmert euch darum!« fuhr er sie an und schob Fanny vor sich eine enge Treppe hinauf, dann um ein paar Ecken und schließlich in ein geräumiges Schlafzimmer hinein.
Fanny fühlte sich recht benommen. Sie hatte kaum Zeit gehabt, ihre Stieftöchter in Augenschein zu nehmen – hatte nur bemerkt, daß die eine groß und blaß, die andere recht hübsch und die dritte noch ein Kind war – konnte deren Willkommensgrüße nicht erwidern, und außerdem hätte sie gerne eine Tasse Tee getrunken! – Zweifellos würde ihr Ehemann sich nach dem Essen besser fühlen, dachte sie und erinnerte sich daran, wie kurz angebunden ihr Vater oft vor dem Essen war, besonders in der Fastenzeit.
»W – was für ein schönes Zimmer!« wagte sie beschwichtigend zu sagen. Sie sah sich um. Das Schlafzimmer war erst dürftig eingerichtet mit einer Kommode, einem kleinen Teppich, einem Bett und zwei Stühlen, im Kamin flackerte ein schnell entfachtes, recht kümmerliches Feuer. Einen reizvollen Anblick bot das große halbrunde Erkerfenster, durch das man auf den dämmrigen Rasen, Rosenbüsche und eine Eibenhecke hinaussah. »Wie wunderschön das im Sommer sein muß –«, fuhr Fanny fort und fragte sich, ob sie wohl den Wunsch nach heißem Wasser äußern dürfte. Aber ihr Ehemann sagte knapp:
»Zieh dich aus.«
»Was –?«
»Mach schon – zieh das Kleid aus.«
»Aber es waren doch nur ein paar Schritte von der Kutsche – ich bin überhaupt nicht naß –«
»Stell dich nicht so dumm an – mach, was ich sage!«
Und da sie immer noch nicht recht begriff, was er wollte, und ihn mit staunenden Augen ansah, machte er sich selbst daran, den Verschluß von Fannys gestreiftem Musselinkleid zu öffnen – wobei er etliche Ösen abriß – dann zog er das Gewand von ihren Schultern und warf es auf den Boden. »Jetzt den Unterrock – steh nicht so stocksteif da.«
»Aber –«
»Dein Unterrock, Mädchen!«
Ihre Langsamkeit regte ihn vollends auf, und er schleuderte seine Stiefel und Reithosen von sich und warf Fanny aufs Bett.
Was nun folgte, war so entsetzlich für Fanny, daß jede grausige Einzelheit dieser ersten Begegnung bis an ihr Lebensende in ihrer Erinnerung haften blieb, obwohl sich in den nächsten Wochen und Monaten wieder und wieder dasselbe zutrug. Die wilde Entschlossenheit ihres Gatten, dessen Gesicht plötzlich rot angelaufen war und der blindlings auf sie losging, sie halb erdrückte und auf ihr herumturnte, keuchend, fluchend und vor sich hinmurmelnd, der ihre Existenz offenbar nur kurzzeitig wahrnahm, als er sie anknurrte: »Mach die Beine weiter auseinander, dumme Gans!« – der ungeheure Schock des ganzen Erlebnisses – der absolute Widerspruch zu ihren Erwartungen bezüglich dieser Seite von Thomas Paget – all das zusammen hatte eine verheerende Auswirkung auf Fanny.
Etwa zehn Minuten später, als sich ihr Gatte nüchtern erhob und nach seinen Hosen angelte, die unterm Bett gelandet waren, blieb Fanny reglos und nach Luft schnappend liegen. Nicht so sehr die Schmerzen setzten ihr zu – obwohl es die schlimmsten waren, die sie je empfunden hatte –, sie war vielmehr entsetzt über ihre eigene Unwissenheit und fragte sich voller Angst, was er wohl mit ihr angestellt hatte, welchen Schaden er bei ihr angerichtet hatte, indem er Körperregionen, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hatte, derartig brutal traktierte.
»Komm, lieg nicht rum wie eine Schwachsinnige«, sagte er gereizt. »Steh auf und zieh dich an! Es gibt gleich Essen. Ein paar von den Hohlköpfen werden wohl demnächst mit dem Gepäck erscheinen.«
»Ich blute –«
»Das will ich hoffen – sonst hätte ich mit deinem Vater ein Wörtchen zu reden!«
»Die Laken sind voller Blut«, sagte sie und fing an zu weinen.
»Dann sag den Dienstmädchen, daß sie sie waschen sollen! – Wo ist mein Halstuch? Verdammt nochmal, kannst du dich nicht nützlich machen, Frances? Lieg nicht so rum! Ich will noch weg zum Presspatrouillen-Treffen, um zu erfahren, ob meine Bekanntmachung ein paar Freiwillige angezogen hat – Himmel nochmal«, rief er verzweifelt aus, »ich dachte, ich hätte mir eine Frau zugelegt, keine jammernde kleine Vogelscheuche. Wenn ich wiederkomme, will ich gefälligst ein fröhlicheres Gesicht sehen, mein Mädchen, oder ich werde dir was erzählen!« Er schlug die Tür zu, um seinem gerechten Zorn Ausdruck zu verleihen, und eilte dann mit Rufen nach Jem, dem Jungknecht, der ihm seinen Offiziersmantel bringen sollte, die Treppe hinab.
Fanny lag noch ein paar Minuten benommen da. Als sie dann gedämpfte Schritte auf der Treppe hörte, schlüpfte sie unter das zerwühlte Bettzeug und bedeckte ihre Blöße mit einem Laken.
Thomas Paget war kaum je zufriedenzustellen. In der Blüte seiner Jahre hatte er es sich zur Regel gemacht, seine Erwartungen so hoch zu schrauben, daß sie unfehlbar enttäuscht werden mußten; das allein schien ihm Genugtuung zu bereiten.
Als Sohn eines nichtsnutzigen jüngeren Sprößlings einer heruntergekommenen Adelsfamilie war dem Heranwachsenden aufgegangen, daß er – im Gegensatz zu seinen Cousins, die alle Geld oder Besitztümer erben würden –, wenn’s hochkam, erwarten konnte, daß reichere Verwandte es ihm ermöglichten, eine Laufbahn bei der Handelsschiffahrt oder der Marine einzuschlagen, ob ihm das nun gefiel oder nicht. Und genauso geschah es: Ein Onkel erkaufte ihm einen Posten bei der Marine und Thomas hätte durch Glück oder Geschick in diesem Gewerbe reüssieren können. Aber das Glück blieb aus. Schon bei seinem zweiten Einsatz, einem völlig unbedeutenden gegen einen spanischen Freibeuter, hatte er das Pech, daß ihm ein Finger und der Daumen der rechten Hand abgeschossen wurde, was bedeutete, daß er für den aktiven Dienst nicht mehr zu gebrauchen war. Andere Seemänner wären vielleicht mit dieser Behinderung zurechtgekommen, aber Thomas Paget war nicht von diesem Schlag. Außerdem war er bei seinen Kameraden und Vorgesetzten wegen seines mißgünstigen, kleinlichen, streitsüchtigen Charakters nicht eben beliebt. Er neigte dazu, über jede noch so geringfügige Angelegenheit zu rechten, die sein eigenes Ansehen oder seine Stellung betraf, und seine Mitmatrosen begrüßten es daher sehr, als er ihnen auf immer Lebewohl sagte.
Da er nur kurze Zeit im aktiven Dienst gewesen war, konnte er nicht mit einer Leibrente rechnen, und nach einer derart abgeschnittenen Marinelaufbahn blieb ihm einzig die Wahl, den Posten eines ›Gelben Admirals‹ oder Regulating Officers anzunehmen, das heißt, eines Offiziers, der die Presspatrouillen befehligte, die, von der Regierung bevollmächtigt, Männer aller Berufssparten aufgriffen und gewaltsam in den Dienst der königlichen Marine stellten. Nur sehr wenige Berufe, wie Fischer und Erntearbeiter, waren ausgeschlossen – und Männer unter achtzehn oder über fünfundfünfzig Jahren; aber diese Ausnahmen wurden, wenn es zweckdienlich war, häufig nicht beachtet.
Jede Stadt des Landes hatte ihre eigene Presspatrouille, der je nachdem fünfzehn bis dreißig Männer angehörten, und jede Patrouille wurde von einem Marineoffizier angeführt, dem sogenannten Regulating Captain. In der Regel handelte es sich bei diesen Offizieren um gescheiterte Existenzen, Männer, deren Berufslaufbahn aus unterschiedlichen Gründen fehlgeschlagen war.
Thomas Paget war immerhin das Glück vergönnt gewesen, eine junge Frau zu ehelichen, die zwar unansehnlich war, ihn aber zur Entschädigung innig liebte und zudem, als Tochter eines begüterten Leichenbestatters, etwas Geld in die Ehe brachte. Aber Thomas verwaltete ihr Geld schlecht, und seine Frau enttäuschte ihn bitterlich. Zunächst brachte sie nur weibliche Nachkommen zur Welt, und in der Folge hatte sie etliche Fehl- und Totgeburten. Vielleicht war Thomas nur deshalb geradezu besessen von dem Wunsch, einen Sohn zu bekommen, weil ihm ein Stammhalter vorenthalten wurde, ein Sohn, ein Knabe, der all das erreichen konnte, was sein Vater nicht erreicht hatte. Und dann war seine Frau – was noch ärgerlicher war – nach der fünften oder sechsten Fehlgeburt nicht etwa gestorben, sondern schwermütig geworden, so daß eine Scheidung ausgeschlossen war. Da sie nicht gemeingefährlich war, konnte sie auch nicht ohne erschreckend hohe Kosten in eine Anstalt eingewiesen werden, also wurde sie unterm Dach seines Hauses in eine Kammer eingesperrt. Zunächst gab ihr Gatte selbst dann noch nicht die Hoffnung auf, einen Sohn zu bekommen, und selbst nachdem er sie eingesperrt hatte, kam es noch zu weiteren Fehlgeburten. Nach der zweiten gab Thomas dann die Hoffnung endgültig auf. Unglücklicherweise lebte die erste Mrs. Paget noch ganze zehn Jahre; vor sich hinbrabbelnd und kreischend und ihr Essen durch die Gegend schleudernd, während ihr Gatte unten im Haus seine Wut in sich hineinfraß und die Enttäuschung wie ein Gift sein Wesen zersetzte.
Zu guter Letzt starb Mrs. Paget gnädigerweise an Verstopfung. Sobald die Trauerfeierlichkeiten vorüber waren, wurde er, ohne Zeit zu verlieren, mit seinem Schulfreund Theophilus Herriard wegen dessen jüngster und gesündester Tochter handelseinig. Der Pfarrer mußte erfreut gewesen sein, wenigstens eine seiner acht Töchter zufriedenstellend unterzubringen, bevor er selbst das Zeitliche segnete – denn er war ein erfolgloser Mann.
Und nun hatte sich Thomas’ Schicksal gar dramatisch zum Guten hin gewendet, indem ihm seine Cousine Juliana Haus und Vermögen vermachte. Daß er von dem Haus Besitz ergreifen konnte, war als besonderer Segen anzusehen, da die Nachbarn an seinem früheren Wohnort gemunkelt hatten – wie Nachbarn so sind –, daß die erste Mrs. Paget keines natürlichen Todes gestorben sei, etwas sei da ganz und gar nicht geheuer, man könne Gift drauf nehmen, daß ihr gefühlloser Gatte sie umgebracht habe, nachdem er keinen Sohn von ihr bekommen und ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Durch den Umzug in eine andere Gegend – und mit einer hieb- und stichfesten Begründung dafür – war Thomas in der Lage, all das unerfreuliche Geschwätz hinter sich zu lassen. Er hatte seine Hochzeit bewußt so lange hinausgezögert, bis er seine Braut direkt in die neue Behausung bringen konnte. Nun traf es sich auch noch glücklich, daß weder Petworth noch Chichester eigene Presspatrouillen hatten, obgleich es in Godalming, Littlehampton und Shoreham solche gab; in diesem Landstrich von Sussex klaffte eine deutliche Lücke, und Thomas, der zuvor Regulating Officer in Gosport gewesen war, ersuchte die Admiralität um Versetzung, die man ihm gerne bewilligte. Nun mußte er nur die bislang nicht beackerte Gegend nach einer einträglichen Ladung Männer durchkämmen, für die er einen Schilling pro Kopf bekam, ferner die Erträge seiner Mühle in Haslingbourne einstreichen und die Freuden seiner neuen Ehe genießen. Das Leben war aufgeblüht für ihn.
Etwas freundlicher als üblich ließ er sich von seinem Knecht Jem den Umhang über die Schultern legen, dann setzte er seinen Dreispitz auf und schritt hinaus in den Platzregen.
Fünf Minuten, nachdem ihr Ehemann außer Hörweite davongestapft war, raffte sich Fanny dazu auf, ihr Bett zu verlassen.
Sie bewegte sich steifbeinig wie eine alte Frau und stieß unwillkürlich kleine Schmerz- und Elendslaute aus. Benommen stolperte sie umher und sammelte die verstreuten Kleider ein. »Es gibt gleich Essen«, hatte Thomas gesagt. Sie hatte schreckliche Angst davor, erneut sein Mißfallen zu erregen, indem sie sich zur ersten Mahlzeit in diesem Hause verspätete.
Und was sollten seine Töchter denken, was sie so lange hier oben trieb?
Sie hob ihr Musselinkleid vom Boden auf, aber es war staubig, zerknittert und zerrissen. Und die Kisten mit ihren Sachen waren noch nicht nach oben gebracht worden. Sie fand im Zimmer weder Nadel noch Faden zum Annähen der abgerissenen Schnürbänder; außerdem brauchte sie dringend heißes Wasser zum Waschen. Sie fühlte sich beschmutzt, steif, kalt und übel zugerichtet. Der zarte Stolz, der sie die Qual durchstehen ließ, die Barnabys sorgloser Rückzug ihr bereitet hatte, und mit dessen Hilfe sie ihren Schmerz vor ihren Schwestern verborgen hatte, schien jetzt ganz und gar vernichtet. Ihr war bewußt, daß sie seelisch gebrochen war, nur noch zur Sklavin taugte. Verschwommen erwog sie davonzulaufen – aber wohin sollte sie flüchten? Zu ihrem Vater gewiß nicht – er würde sie niemals wieder aufnehmen. Und eine andere Möglichkeit gab es nicht … Aber sie war viel zu eingeschüchtert und schwach, um sich ernsthafte Gedanken über eine Flucht zu machen.
Vor der Tür vernahm sie gedämpfte Stimmen.
»Ich geh auf keinen Fall rein. Sie soll allein zurechtkommen!«
»Was soll ich denn da drin?«
»Verflixt, wenn ich gehe –«
»Tess soll ihre Sachen reinbringen und ihr helfen – wenn sie Hilfe will. Eins ist gewiß – ich werde nie Mama zu ihr sagen. Ein sechzehnjähriges Mädchen!«
»Pscht, Martha, sie könnte dich hören. Los Tess, sag ihr, daß nicht viel Zeit ist – daß Papa es nicht ausstehen kann, wenn man ihn warten läßt.«
»Ja, Miss«, sagte eine viel leisere, schüchterne Stimme.
Vier Füße gingen die Treppe hinab, und nach einer Weile hörte Fanny ein zaghaftes Klopfen an der Tür.
»Herein!« rief sie matt und wischte sich die Tränen von den Wangen, mit einer Falte des Unterrocks, den sie umklammert hielt, und sie wickelte sich das Kleidungsstück um den Körper, als die Tür aufging und eine kleine Dienstmagd eintrat, die eine ihrer zwei Kisten hinter sich herzog.
»Ich bitt schön, Ma’am, ich bin Tess, ich will Ihnen behilflich sein«, sagte das Mädchen.
In ihrem Elend klang die Stimme der Dienstmagd in Fannys Ohren schnippisch und wissend. Sie sah Fanny neugierig an, sicher würde sie gleich in den Dienstbotentrakt laufen und ihren Kumpanen erzählen, in was für einem Zustand sie die neue junge Frau des Herrn vorgefunden hatte.
»Ich brauche keine Hilfe, danke. Du kannst gehen«, sagte Fanny und bemühte sich, ihrer zittrigen Stimme einen sicheren, kühlen Ton zu verleihen. Sie starrte auf den Unterrock in ihrem Schoß und hielt mit aller Gewalt die Tränen zurück.
»Soll ich die Kiste nich aufmachen?« fragte Tess erstaunt. »Soll ich gar nichts für Sie tun?«
»Oh, na gut – ja – öffne sie. – Kannst du mir etwas heißes Wasser bringen?«
»Weiß nich, Ma’am«, sagte das Mädchen zweifelnd. »Weiß nich, ob der Waschkessel schon heiß genug is.« Und sie fügte hinzu: »Miss Martha, die hat gesagt, ich soll Ihnen sagen, Ma’am, daß es gleich, wenn der Herr zurück is, Essen gibt, und er – der Herr – kann’s nicht leiden, wenn er warten muß.«
Fanny deutete mit einem schwachen Nicken an, daß sie verstanden hatte. Sie hörte, wie die Seile von der Kiste gelöst wurden und der Deckel aufging, dann klackte die Tür hinter Tess zu, und Fanny begrub ihren Kopf unter dem Kissen in einem erneuten Tränenausbruch. Aber sie traute sich nicht, zu lange zu weinen, da Tess bald mit dem heißen Wasser zurücksein könnte.
Aber nichts dergleichen geschah – wahrscheinlich war der Kessel widerspenstig – also mußte sich Fanny wohl oder übel anders behelfen. Sie hatte etwas Rosmarinwasser, das ihre Schwester Maria für sie zubereitet hatte. Als eine der acht armen Pfarrerstöchter war sie es schließlich gewohnt, ohne die Dienste einer Zofe zurechtzukommen – aber sie vermißte jetzt zum ersten Mal ihre einst allgegenwärtigen Schwestern, die unablässig alles und jedes kommentierten und kritisierten – »Du liebe Güte, Kind, die Schärpe ist nicht gerade, komm her, ich mach sie nochmal fest – steh still, dein Spitzeneinsatz sitzt schief – dein Haar muß geglättet werden, warte, ich kämme es dir schnell –«
Jetzt wäre ihr sogar Kittys Anwesenheit willkommen gewesen.
Gongschläge dröhnten durchs Haus, und Fanny band mit zitternden Fingern die Bänder ihrer Hausschuhe zu, breitete so gut es ging die Tagesdecke über die schrecklichen Laken, griff nach ihrem Beutel, hob den Kopf, öffnete die Schlafzimmertür und stieg langsam die Treppe hinab. Dabei bemühte sie sich, den brennenden Schmerz, den das Treppensteigen ihr verursachte, mit Würde zu verbergen.
Sie stellte fest, daß man die Halle seit ihrer Ankunft nach Kräften hergerichtet hatte. Keine Spur von Unordnung war zurückgeblieben, abgesehen von einer verirrten Hobelspanlocke auf den nackten Dielen. Niemand war zu sehen, aber nach rechts und links standen die Türen offen. Fanny warf einen Blick durch die linke Tür und sah einen gedeckten Tisch, aber glücklicherweise war niemand im Zimmer. Sie wandte sich nach rechts und betrat scheu den Raum, der den Salon oder das Wohnzimmer darstellen mußte. Er lag unter ihrem Schlafzimmer und hatte die gleichen halbrunden Erkerfenster, durch die man in die Dunkelheit hinaussah, da noch keine Vorhänge angebracht waren. Vorsichtig sah sie sich in dem Zimmer um und erblickte einen abgetretenen Teppich, ein paar traurige, schäbige Möbelstücke, die streng geometrisch angeordnet waren, und drei junge Damen, die in ihrer Haltung kaum weniger streng wirkten. Nein, eine davon war noch ein Kind.
Da die jungen Damen sie nur anstarrten, ohne ein Wort zu sagen, sah sich Fanny gezwungen, die Konversation zu eröffnen. Sie tat es nur sehr widerstrebend, da sie alles andere als freundlich dreinsahen.
»Guten Abend«, sagte sie mit nervöser Höflichkeit. »Ich – ich denke, wir sollten uns einander bekanntmachen.«
Schweigen, während sie feindselig auf ihr besticktes Kleid aus weißer Seide starrten, das an den Schultern ausgeschnitten war und mit einem Spitzeneinsatz zusammengehalten wurde. Es war ihr hübschestes Kleid, das einzige neue, das sie außer ihrem Brautkleid besaß, und sie war sehr erleichtert gewesen, daß es ganz oben in der Kiste lag. Sie hatte das Gefühl, daß allein seine Eleganz ihr über diese schwere Begegnung hinweghelfen konnte. Sie hatte erwartet, daß Thomas’ Töchter modisch gekleidet waren, aber jetzt war sie verlegen und kam sich viel zu vornehm vor, da die zwei älteren Dämchen schlichte Reifröcke aus blauem beziehungsweise braunem Wollstoff trugen, während das kleine Mädchen ein blauweißgestreiftes Baumwollkleid anhatte, vor das eine Kinderschürze gebunden war.
»Ich werde mal raten, wer von euch wer ist«, sagte Fanny nahezu verzweifelt, als die Paget-Töchter immer noch nichts sagten. »Du mußt Elisabeth sein«, sagte sie zu der größeren, »und du Martha – und du bist dann Patience.« Die Worte ›Ich bin eure neue Mama‹ blieben ihr im Halse stecken, als drei Paar kalte graue Augen sie musterten.
»Es – es ist reichlich sonderbar, nicht wahr?« fuhr Fanny beharrlich fort, da alle drei hartnäckig schwiegen. »Ihr zwei seid beide größer als ich, glaube ich.«
Die Worte ›und älter‹ wurden unhörbar von Marthas Lippen geformt, während Fanny sie nervös anlächelte, aber sie sprach sie nicht aus. Patty jedoch rief mit einem verächtlichen Blick auf den Neuankömmling: »Natürlich sind sie viel größer!«
Alle drei Mädchen waren auffallend kräftig gebaut und großgewachsen für ihr Alter. Fanny wußte, daß sie neunzehn, siebzehn und acht waren. Sie glichen ihrem Vater mit ihrem teigigen Teint und den groben Knochen, dem rotblonden Haar und den wässrigen blaugrauen Augen, den blassen Lippen und dem verschlossenen Gesichtsausdruck. Nur Martha, die Mittlere, sah leidlich gut aus; ihre Wangen waren rosiger und ihre Wimpern dunkler als die ihrer älteren Schwester, ihr Mund, ihre Nase und ihr Kinn waren hübscher geformt, und ihr Haar, das etwas dunkler war, schien sich natürlich zu locken. Bet, das arme Mädchen, war wirklich mitleiderregend unansehnlich. Sicher war das einer der Gründe, warum sie mit ihren neunzehn Jahren noch nicht unter der Haube war. Sie hatte eine knollige Nase mit einem Höcker, ihr Mund war formlos, ihr dünnes rotblondes Haar hing ihr schlaff in den Nacken, nur über der Stirn und über den Ohren war es in wenig überzeugende Locken gedreht, und ihre dicken weißen, fast wimpernlosen Augenlider verdeckten Augen, die dermaßen blaß waren, daß man nur staunen mußte, daß sie einen so scharf ansehen konnten. Die kleine Patty schob die Unterlippe vor und zeigte mit finsterem Blick offen ihre Ablehnung.
Die Haustür schlug zu.
»Da kommt Papa«, sagte Martha erleichtert.
Fanny graute davor, Thomas wiederzusehen, hatte aber dennoch das Gefühl, daß seine Gegenwart die unangenehme Spannung lösen würde. Er trat ein, warf einen Blick auf Fanny und sagte: »Du hast dich also mit den Mädchen bekanntgemacht.
Gut. – Dieses Kleid ist viel zu fein, wie kommst du nur dazu, es anzulegen? Wir erwarten keine Gäste. Du wirst erfrieren im Eßzimmer.«
»Wünschen Sie, daß ich mich umziehe?« stammelte Fanny und meinte zu sehen, wie Bet und Martha einen raschen Blick tauschten angesichts dieser Unterwürfigkeit.
»Was, jetzt – wo das Essen auf dem Tisch steht? Nein, nein«, sagte Thomas ungehalten. »Eins von den Mädchen kann dir einen Schal bringen – Bet – hol was aus der Halle für deine Stiefmutter.«
Bet ging langsam aus dem Zimmer, mit zusammengepreßten Lippen und finsterer Miene, entweder wegen des Auftrags, oder weil es ihr nicht gefiel, daß Fanny als ihre Stiefmutter bezeichnet wurden.
»Beeil dich!« rief Thomas hinter ihr her, und dann ging er rasch ins Eßzimmer und rief ärgerlich durch eine weitere Tür, die offenbar in die Küche führte:
»Kate! Tess! Jem, wo seid ihr alle? Wo zum Teufel bleibt das Essen?«
Beschwichtigende Stimmen antworteten, und Fanny hörte hastige Schritte und Besteckklappern. »Kommt her!« rief Thomas seinen Töchtern und Fanny zu. »Wenn sie uns warten sehen, fällt ihnen vielleicht deutlicher auf, daß es acht Minuten über die Zeit ist.«
Als sie am Tisch Platz nahmen, brachte eine kräftige, rotgesichtige Frau eine Suppenterrine herein und Bet kam eilig mit einem schmutziggrünen Umschlagtuch zurück, das sie Fanny unhöflich hinschleuderte. Diese mußte ihr Essen dann reichlich unbequem zu sich nehmen, da ihr das Tuch ständig von den Schultern rutschte.
Das Essen war keine heiter beschwingte Angelegenheit. Thomas machte ab und zu eine Bemerkung zu seinen Töchtern oder stellte ihnen eine Frage, um zu überprüfen, ob seine Anordnungen befolgt wurden. Meist handelte es sich um scharfe Tadel. Als die kleine Patty ihren Suppenlöffel fallen ließ, schimpfte er:
»Habt ihr beiden ihr immer noch keine Manieren beigebracht?«
Fanny begriff, daß es der kleinen Patty nicht oft gestattet war, mit ihrem Vater zusammen zu speisen.
»Sie beträgt sich im allgemeinen sehr gut«, erwiderte Bet kurz. »Ich glaube, sie ist nur verschüchtert in Gesellschaft.«
»An die Gesellschaft, wie du es nennst, wird sie sich gewöhnen müssen«, bemerkte Thomas und warf einen wenig schmeichelhaften Blick auf seine junge Ehefrau. »Setz es dir zur Aufgabe, Frances, ihr ordentliche Tischmanieren beizubringen.«
Das peinliche Mahl war bald vorüber. Zum Abschluß gab es einen Heidelbeer-Apfelkuchen, der saure, matschige blaugraue Früchte und zahllose Kerne enthielt. Danach brachte die rotgesichtige Köchin eine Portion gebratener Knochen herein und stellte sie vor ihren Herrn.
»Ah, das wird besser munden. Morgen müssen Sie etwas Besseres zuwege bringen als heute, Kate, sonst muß ich mich nach einer neuen Köchin umtun.«
Kate brummte, daß man sich nicht blitzartig auf eine neue Kochstelle umstellen könne.
»Sie haben auch eine neue Herrin, vergessen Sie das nicht. Ich erwarte erhebliche Fortschritte in den nächsten Wochen – oder einige Veränderungen sind fällig!«
Kate warf der neuen Herrin einen abweisenden Blick zu, und Fanny fühlte mit sinkendem Mut, daß ihre Stellung in diesem Haushalt schon angeschlagen war, bevor sie sie überhaupt etablieren konnte, und es stand nicht in ihrer Macht, etwas dagegen zu tun.
Thomas wandte sich an Frau und Töchter, während er sich ein Glas Portwein einschenkte.
»Verzieht euch jetzt – allesamt. Ich habe zu arbeiten und werde mich in mein Gartenhaus zurückziehen. Vielleicht werde ich später den Tee mit euch einnehmen. Bringt das Kind zu Bett.«
Patty wollte protestieren, wurde aber von Bet beschwichtigt, die sie nach oben begleitete. Martha folgte Fanny mit mürrischer Miene in den Salon. Dort brannte ein Feuer im Kamin, und sein Schein spiegelte sich zehnfach in den gerundeten Scheiben der Erkerfenster wider. Draußen kam ein Wind auf, der in den Ästen unsichtbarer Bäume seufzte und im Kamin bollerte und flüsterte, als wäre ein lebendiges Wesen dort eingesperrt.
Fanny zitterte in ihrem hübschen dünnen Gewand, zog den Schal eng um sich und trat in die Nähe des Feuers. Mit schwerem Herzen erinnerte sie sich daran, wie wohlig sie sich letzte Nacht in dem großen durchgelegenen Bett an Charlotte und Kitty geschmiegt hatte; sie hatten gescherzt und gelacht, und sogar Kitty war auf einmal betrübt gewesen, daß ihre jüngere Schwester und willfährige Dienerin sie verließ.
Martha schien jetzt aber weniger feindselig als im Beisein ihrer Schwestern.
»Sagen Sie, Fanny, waren Sie je in Winchester?« wollte sie wissen. »Oder in Salisbury? Da soll es so unbeschreiblich elegante Geschäfte geben.«
Fanny mußte zugeben, daß sie diese Städte noch nie besucht hatte, aber sie fand schnell heraus, daß es Martha nur darum ging, von ihrem eigenen Aufenthalt in Brighton zu erzählen, wo sie vor zwei Jahren in Begleitung einer Tante, einer Schwester ihrer Mutter, gewesen war. Die Beschreibung dieser prachtvollen Stadt mit ihren Leihbibliotheken und Konditoreien, dem berühmten Pavillon, den Haartrachten und großen Toiletten der Damen und den draufgängerischen jungen Stutzern hielt sie minutenlang beschäftigt und hob ihre Laune. Bet, die während ihrer Lobesreden zurückkam, verdrehte verzweifelt die Augen; eindeutig war sie mit dem Glanz von Brighton mehr als vertraut.
»Du warst eben nicht dort, Bet«, sagte Martha verteidigend. »Tante Philips hatte offenbar keine Lust, dich mitzunehmen. Ich habe Fanny nur ein bißchen erzählt.«
»Hat Papa dir erlaubt, sie so zu nennen?«
»Nein, aber das ist gleichgültig. Ich werde auf keinen Fall Mama zu ihr sagen. Du lieber Gott! Ich werde mich doch nicht soweit erniedrigen, daß ich eine Person, die jünger ist als ich, so anspreche!«
Während die zwei Schwestern sich stritten – Bet erklärte, daß Martha sich fügen müsse, wenn der Vater es gebot, und Martha blieb hartnäckig dabei, daß es ihr nicht im Traum einfiele – nutzte Fanny die Gelegenheit, um nach oben zu schlüpfen und das Binsenkörbchen zu holen, in dem sie ihr Nähzeug aufbewahrte. Sie hatte ein paar Taschentücher gesäumt und war dabei, sie mit Thomas’ Initialien zu besticken; ihre Familie hatte befunden, dies sei eine schickliche Gabe der Braut an den Bräutigam.
Als sie in den Salon zurückkehrte, hatten die Mädchen offenbar das Thema gewechselt. Sie ereiferten sich jetzt über die Vorzüge von Petworth als Wohnort.
»Ich finde es nicht übel«, sagte Bet kurz. »Ich habe bei der Durchfahrt einen ganz gut aussehenden Kurzwarenladen gesehen – und einen Schneider – und ein paar Schuhgeschäfte. Und da es so ein kleiner Ort ist, läßt Papa uns vielleicht alleine ausgehen; auf jeden Fall gibt’s hier keine Matrosen.«
»Ich weiß, daß Pa die Stadt nicht mag«, sagte Martha. »Ich habe nämlich gehört, wie er gesagt hat, daß er nur hierher geht, weil er das Haus von Cousine Juliana so günstig bekommt, daß er sich aber in keiner anderen Stadt des Königreichs so ungern niederlassen würde.«
»Wie sonderbar! Warum nur?« fuhr es Fanny heraus.
Bet sagte: »Oh, ich schätze, weil es so ein elendes, winzig kleines Loch ist, wo er schwerlich viele Männer zwangsverpflichten kann.«
»Nein«, widersprach ihre Schwester. »Weil er Lord Egremont nicht leiden kann, vom Petworth House.«
»Pah! Wie käme er dazu?« wollte Bet wissen.
Martha sah zur Tür und sagte mit gedämpfter Stimme: »Lord Egremont hat nur Mätressen, keine richtige Ehefrau! Und ich glaube, eine von denen hat ausgerechnet in dem Haus hier gelebt, bevor es in den Besitz unserer Cousine gelangte. Sie war Französin, und Lord Egremont hat das Haus für sie gebaut, und sie ist am Faulfieber gestorben.«
»Wer hat dir das erzählt?«
»Kate. Sie hat’s vom Schornsteinfeger erfahren.«
»Und wenn schon«, hielt Bet ihr entgegen, »was hat Pa mit Lord Egremont zu schaffen? Er kommt doch nie mit dem Landadel in Berührung, gleichgültig wo wir sind. Niemand will etwas mit einem Offizier der Presspatrouille zu tun haben.«
Beide Schwestern verfielen bei dem Gedanken an diese unbekömmliche Wahrheit in bedrücktes Schweigen. Aber dann sagte Martha entschieden:
»Aber immerhin war unsere Cousine Juliana mit Lord Egremont befreundet, also macht er uns vielleicht seine Aufwartung.«
»Pa wird uns gewiß nicht gestatten, seine Bekanntschaft zu machen.«
Um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, sagte Fanny: »Erzählt mir doch etwas über eure Cousine Juliana. Kennt ihr sie gut?«
»Ach, woher denn! Sie ist nach Übersee gegangen. Wir haben sie nie kennengelernt«, antwortete Bet müde. Aber Martha rief aus:
»Sie war ein unerhört hübsches Mädchen! Da über dem Klavier hängt ihr Porträt. Und sie hat während der Französischen Revolution die unwahrscheinlichsten Abenteuer erlebt – man war drauf und dran, sie zu enthaupten, aber sie ist in einem Ballon nach England entkommen – und sie hat einen holländischen Grafen geheiratet – und hat einen Haufen Geld von einem reichen alten Onkel geerbt, einem indischen Nabob, der nicht besser war, als man’s erwartet. Deshalb hat sie an Pa geschrieben –«
»Der Onkel war nicht in Indien, Martha – er ist zurückgekommen und in England gestorben.«
»Was spielt es schon für eine Rolle, wo er gestorben ist? Mein Gott, sei doch nicht so pingelig!« rief Martha ungehalten aus. »Dann hat Cousine Juliana dieses Haus von der französischen Lady gekriegt, die gestorben ist – und dann hat sie es Pa als Wohnsitz angeboten, solange sie in Übersee ist –«
»Hat sie ihren Reichtum auch noch mit anderen Verwandten geteilt?« fragte Fanny, die fasziniert war von dieser verschwenderischen Großzügigkeit; ein Charakterzug, der (wie sie sich eingestehen mußte) Juliana Pagets Cousin Thomas gänzlich abging.
»Ja, sie hat an eine alte Cousine in Bath geschrieben – aber die war schon tot, aus der Kutsche gefallen – und an einen Cousin und eine Cousine in Indien.«
»Pa war ziemlich verärgert, als ihm zu Ohren gekommen ist, daß sie das getan hat«, kommentierte Bet säuerlich.
»Warum? Was sind das denn für Verwandte in Indien?«
»Zwillinge – ein Seitensprung des alten Nabob«, setzte Martha an und erntete einen mißbilligenden Blick ihrer Schwester. »Warum soll ich das denn nicht erzählen, Bet? Sie ist doch –«, sie warf einen vielsagenden Seitenblick auf Fanny, »sie ist jetzt eine verheiratete Frau, sie nimmt keinen Schaden, wenn sie es erfährt.«
Fanny lehnte ihr schmerzendes Rückgrat gegen die harte, aufrechte Lehne ihres Windsor-Stuhls und fragte sich recht bekümmert, was die Tatsache, daß sie verheiratet war, mit der Geschichte von den Zwillingen in Indien zu tun hatte.
»Es schickt sich nicht für dich, so eine Geschichte zu erzählen«, sagte Bet züchtig und preßte ihre bleichen Lippen zusammen.
»Ach, papperlapapp! Ich weiß es von Miss Fox, und die war nicht verheiratet! Also, Fanny, es trug sich folgendermaßen zu: Der alte Nabob in Indien – General Henry Paget, eben der, der Cousine Juliana das Vermögen hinterlassen hat – hatte zwei außereheliche Kinder von einer Dame, die halb Portugiesin, halb Hindu-Heidin –«
»Martha! Zügle bitte deine Zunge! Was würde Papa dazu sagen?«
»Na was schon? Es ist nichts weiter als die Wahrheit, und deswegen war er auch so außer sich, als er gehört hat, daß Cousine Juliana außer an uns auch noch an die Zwillinge geschrieben hat. Sie tragen den Namen Paget, obwohl sie sicher kein Recht darauf haben, weil ihre Mutter nicht mit dem Nabob verheiratet war, davon weiß jedenfalls niemand etwas –«
»Aber wenn er so reich war, hat er doch sicher für seine Kinder vorgesorgt«, sagte Fanny verwundert. »Selbst wenn sie nicht ehelich waren.«
»Nein, das hat er nicht getan. Augenscheinlich hatte er, als er nach England zurückkam, die Absicht, der Portugiesin Geld zu schicken, aber als er an die Adresse geschrieben hat, wo sie gewohnt hat, als er sie verließ, war sie verschwunden, und niemand wußte wohin. Und dann hat er sich gesagt ›Zum Teufel mit ihr, sie hat sich mit einem anderen davongemacht. Ich will mit ihr und den Zwillingen nichts mehr zu tun haben –‹.«