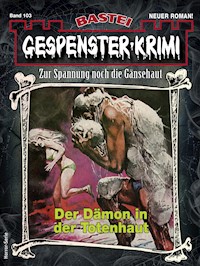
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
West-Indische Inseln, in der Kolonialzeit
Theresia Tyler war das schönste Mädchen von ganz Georgetown gewesen, und noch auf ihrem Totenbett war die Neunzehnjährige schöner als jede andere.
Ihr armlanges schwarzes Haar war kunstvoll frisiert, wie sie es im Leben geliebt hatte. Der Raum, in dem sie aufgebahrt lag, war erfüllt vom Duft der Blüten der roten Bougainvillea, die man über ihren Leichnam gestreut hatte. Zwei Kerzen brannten neben ihr.
Ihre Familie hielt Wache an ihrer Seite. Umsonst!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Dämon in der Totenhaut
Vorschau
Impressum
Der Dämon in der Totenhaut
von Camilla Brandner
West-Indische Inseln, in der Kolonialzeit
Theresia Tyler war das schönste Mädchen von ganz Georgetown, der Hauptstadt der Cayman-Inseln in der Karibik, gewesen, und noch auf ihrem Totenbett war die Neunzehnjährige schöner als jede andere. Ihr Gesicht hatte immer schon die typische kalkige Blässe der vornehmen weißen Frau gehabt, die von Kindheit an jedem Strahl der tropischen Sonne aus dem Weg gegangen ist.
Ihr armlanges schwarzes Haar war kunstvoll frisiert, wie sie es im Leben geliebt hatte. Der Raum, in dem sie aufgebahrt lag, war erfüllt vom Duft der Blüten der roten Bougainvillea, die man über ihren Leichnam gestreut hatte. Zwei Kerzen brannten neben ihr.
Ihre Familie hielt Wache an ihrer Seite. Umsonst!
Schlag Mitternacht übermannte sie alle eine so tiefe Müdigkeit, dass sie halb bewusstlos in sich zusammensanken. Die Kerzen erloschen und sandten bittere Rauchfäden aus. Ein weiblicher Schatten huschte herein, der eine Welle von Leichengeruch mit sich schleppte.
Blitzschnell beugte die missgeformte, dämonische Kreatur sich über die Tote, zog ihr die Haut aus und schlüpfte selbst hinein. Ebenso blitzschnell war sie wieder verschwunden, und als die Wächter am Bett der Toten aus ihrem narkotischen Schlaf erwachten, bot sich ihnen ein so grauenvoller Anblick, dass zwei von ihnen sofort wieder in Ohnmacht versanken ...
†
Die unglückselige Theresia wurde in einem geschlossenen Sarg begraben, und die Familie tat ihr Bestes, den Mantel des Schweigens über das entsetzliche Ereignis zu breiten.
Aber solche Dinge ließen sich nicht verschweigen. Bald munkelte man in ganz Georgetown darüber, in all den zierlichen, bunten Häusern der Stadt, in den schneeweißen Villen der Kolonialherren und den jämmerlichen Wellblechhütten der Sklaven.
Theresias Mutter hatte beim Anblick des so grausam geschändeten Leichnams den Verstand verloren, sie rannte in zerrissener Kleidung und mit verwirrtem Haar durch die Stadt und schrie die Untat heraus, bis man sie wenige Stunden später ertrunken im Hafenbecken treibend fand.
Daraufhin verließen die restlichen Tylers Hals über Kopf die tropische Insel mit ihren Palmen, den weißen Sandstränden und dem klaren saphir-blauen Wasser und kehrten zurück in ihre Heimat, ins rußige, rauchende, stinkende London, das ihnen nach dem Horror der Tropen als ein wahres Paradies erschien.
Die einheimischen Schwarzen beschäftigten sich natürlich noch monatelang mit dem Thema, und ebenso die kleinen spiritistischen Zirkel der Weißen, die sich mehr oder minder heimlich zusammenfanden, da die Gebildeten alles, was an Aberglauben erinnerte, als »Sklavendummheit« abtaten.
Die beiden Gruppen kommunizierten nicht miteinander, aber sie kamen zu demselben Ergebnis. Die Leichenschänderin war eine Kreatur gewesen, die man eine Zomblesse oder Zumbivie nannte – ein Wesen, erzeugt von einem Zauberer, halb Frau, halb Dämon, das über Fähigkeiten beider Spezies verfügte.
Solche Zomblessen waren in ihrem eigentlichen Äußeren abstoßend hässlich, deshalb pflegten sie einer schönen, noch ganz frischen Leiche die Haut abzuziehen und sich selbst darein zu hüllen. War die Haut abgenutzt, so besorgten sie sich eine neue. Sie konnten diese Haut auch nach Belieben wieder ausziehen wie ein Gewand und hängten sie dann oft an einen Nagel an der Wand, wobei sie nicht schwerer als ein Wollfaden wog. Wer sie fand und mit Salz bestreute, hatte das Ungeheuer erfolgreich vertrieben. Wehe aber, wenn es vorzeitig zurückkam und ihn ertappte!
Nun war in der Karibik ein solches Ereignis zwar ein Anlass zu Kummer und Zorn, aber man fand, vor allem in der schwarzen Bevölkerung, keineswegs etwas Besonderes daran. Die wunderschönen kleinen Inseln waren mit Dämonenglauben getränkt wie ein Badeschwamm mit Wasser.
Nachts musste man alle Fenster fest schließen, auch wenn man in den dumpf-heißen Tropennächten beinahe erstickte, denn die Nachtluft brachte Fieber und Tod. Auch war es ratsam, Sand auf das Dach des Hauses zu streuen, um den Werwolf fernzuhalten. Der musste nämlich erst alle Sandkörner zählen, ehe er versuchen konnte, ins Haus einzudringen.
Man fürchtete eine Unzahl der verschiedensten Dämonen, einer scheußlicher als der andere, und mehr als alles andere fürchtete man die schwarze Kunst der Bokor, der einheimischen Zauberer, denn sie waren Diener und Vertraute des obersten Schlangengottes, Damballa.
Die Weißen, vor allem die reichen und gebildeten Weißen, taten so, als kümmerten sie sich gar nicht um dieses dumme Geschwätz. Offiziell waren diese Nachfahren holländischer, dänischer, deutscher, irischer und englischer Kolonialherren alle Mitglieder der verschiedenen, traditionellen christlichen Kirchen, ja sogar Diakone, Presbyter und Geistliche. Aber sie hüteten sich sehr, den Groll der Zauberer zu erwecken, und oft umschmeichelten sie einen von dieser Sorte mit Privilegien und Geschenken, damit er ihnen die anderen vom Leib hielt – und mit ihnen zugleich auch die zahllosen Unholde, die die Nacht unsicher machten.
Einer, der das teuflische Verbrechen nicht kommentarlos hinnahm, war Jan-Henrik Tyler, Theresias Zwillingsbruder. Er sprach zwar mit niemand darüber, denn in Georgetown hatten alle Wände Ohren und alle Worte Flügel, aber er war überzeugt, genau zu wissen, wer dahinter steckte.
Es gab nämlich in der Stadt drei eng miteinander verschwägerte Familien reicher Kolonialherren, die Holländer van Bruyn und die Engländer Hockett und Lloyds, die genau diesen Ausweg vor den Belästigungen und Bedrohungen durch die Bokor gewählt hatten.
Über die Großmutter der van Bruyns, Delfine, ging das Gerede, sie hätte einen solchen Zauberer dazu bewegt, ihr eine Zomblesse zu erschaffen – auf welche Weise und mit welchen Zutaten, davor schauderte schon der bloße Gedanke zurück. Mit dieser Kreatur hatte sie einen Pakt geschlossen und dafür ein Geschenk erhalten, von dem man nur wusste, dass es ein Kästchen aus Ebenholz mit kunstvollen Verzierungen aus Kupfer und Gold war.
Es enthielt etwas Teuflisches, aber niemand außer Delfine hatte jemals gesehen, was es war. Eine Art Flaschenteufel, sagten die einen, ein Talisman die anderen. Sicher war nur, dass es sieben Wünsche erfüllte. Sechs davon gingen ganz nach dem Willen des Besitzers oder der Besitzerin in Erfüllung, aber mit dem siebenten, der auf jeden Fall auch getan werden musste, hatte es eine eigene Bewandtnis.
Bei dem hatte nämlich die Zomblesse ihre Finger im Spiel, und was immer der Wunsch auch sein mochte, er fuhr als Fluch ins Angesicht des Beschwörers zurück. Es nützte nichts, gute, ja heilige Dinge zu wünschen, sie kehrten sich noch im Mund, der sie aussprach, um und wurden zu ausgesuchten Teufeleien. Zumeist bedeutete dieser siebente Wunsch auch den Tod des Besitzers, dann sorgte die Zomblesse dafür, dass das Zauberkästchen in neue Hände überging. Es durfte aber nur an jemanden aus der Familie weitergegeben werden, der es freiwillig annahm.
Die drei Familien sorgten auch noch aus einem anderen Grund für Gerede. Sie heirateten nämlich immer nur untereinander. Gewiss, sie waren besonders reich und angesehen, man behandelte sie beinahe wie ein königliches Geschlecht, aber schließlich gab es in Georgetown noch genug andere schöne Töchter und Söhne reicher Familien.
Sie wurden auch alle in derselben Gruft begraben. Darüber wurde viel gemunkelt, denn solche Enge und Nähe erschien manchen Leuten abartig, ja es hieß, in Wirklichkeit seien die van Bruyns, die Lloyds und Hocketts überhaupt nur eine einzige Familie, die sich nur hinter verschiedenen Namen versteckte, damit das köchelnde Geschwätz nicht überbrodelte.
Jan-Henrik Tyler, der Zwillingsbruder der geschändeten Toten, rächte sich auf seine Weise, ehe auch er von der fluchbeladenen Insel floh: Er war ein geschickter Zeichner und Holzschneider, und so kursierte in Georgetown – allerdings nur im Geheimen und mit äußerster Vorsicht – bald ein Holzschnitt, der den Pakt darstellte.
Er zeigte eine merkwürdige Szene in einem Innenraum. Das Interieur bestand aus wenigen, dunklen und kargen Möbeln. Auf einem Stuhl saß eine weiße Frau, geschmackvoll gekleidet und selbst in fortgeschrittenen Jahren noch von ganz außergewöhnlicher Schönheit.
Die Angst um den Verlust ihrer Jugend und Schönheit war es nämlich gewesen, die Delfine dazu bewegte hatte, sich auf den Handel einzulassen, und so sah sie, die gut Fünfzigjährige, immer noch wie ein Weib von zwanzig Jahren aus. Ihr blondes Haar war gescheitelt und aufgesteckt, im pompösen Stil der reichen Damen in den europäischen Städten, denen sie voller Eitelkeit nacheiferte. Ihr Gesicht, das auf den ersten Blick bezauberte, verriet rasch ihren wahren Charakter: Jeder Zug darin sprach von Grausamkeit, Habgier und Niedertracht. Aber wie überall auf der Welt verzieh man auch in Georgetown den Reichen und Mächtigen ihre Sünden leichter als den Armen und Hilflosen.
Sie war, was dem Holzschnitt eine seltsame Ironie verlieh, mit einer Stickerei beschäftigt und schien nur beiläufig den Kopf zu heben, um das in hauchzarte schwarze Schleier gehüllte, geflügelte Ding zu betrachten, das mit ausgebreiteten Armen waagrecht unter der getäfelten Zimmerdecke schwebte.
Ihr Gesicht blieb dabei unbewegt, obwohl jede andere Frau (und so mancher Mann) bei dem Anblick kreischend aus dem Raum gestürzt wären. Ebenfalls weiblich, glich diese zweite Person einer Leiche, der man die Haut abgezogen hatte, und zwar einer seit Stunden in der Gluthitze Westindiens gärenden Leiche.
Das von der Fäulnis aufgedunsene Gesicht glänzte blauschwarz unter dem grotesk kunstvoll frisierten Haar. Die Augen waren weiß und ohne Pupillen wie die von griechischen Statuen, dennoch wirkten sie nicht blind, sondern beängstigend aufmerksam. Eine lange weiße Flamme schoss aus dem weit geöffneten Mund. In einer Hand hielt sie ein kunstvoll verziertes Kästchen, das sie eben im Begriff war auszuleeren, aber es flatterten nur kleine, unleserlich beschriftete Zettelchen heraus.
Auf dem Rand des Bildes stand die Aufschrift: »Das ist die Hexe Delfine van Bruyn und ihr Weibs-Teufel.«
Es gab nicht viele Leute, die einen Abzug dieses Holzschnitts besaßen, denn die Zomblesse fand rasch heraus, wer einen in Händen hatte, und machte diesen Leuten dann Ärger. Freilich, groß war ihre Macht nicht, aber sie reichte aus, dass die Frevler ihre Hühner wie von Schlangen erwürgt vorfanden, der Schimmelpilz ihre Ernte vergiftete oder sogar ihre Kinder krank wurden. Deshalb warfen es die meisten weg, aber die in solchen Dingen Erfahrenen legten es in ihre Bibel oder ließen es vom Pfarrer mit Weihwasser bespritzen, dann konnte das Teufelsweib an den Besitzern keine Rache mehr nehmen.
Natürlich erwähnte kein Mensch den Herrschaften van Bruyn, Hockett und Lloyds gegenüber den bösen Ruf, der ihnen anhaftete. Man sprach auch nicht offen darüber, als Delfine eines Tages tot in ihrem Schaukelstuhl auf der Dachveranda des weißen Herrenhauses aufgefunden wurde. Sie saß dort mitten in der grellen Tropensonne, aber ihr Körper samt den Kleidern war stocksteif gefroren, sodass die Brüsseler Spitzen ihrer Haube wie Eisblumen ihr Gesicht umrahmten und Eispartikel auf ihrem schwarzen Seidenkleid glitzerten, als sei es mit Diamanten bestickt.
Ihr Gesicht und ihre Hände waren so blau verfärbt und so verschrumpelt vom Frost, dass ihre eigene Familie sie kaum wiedererkannte. Es war eine schwarze Sklavin gewesen, die die Tote aufgefunden hatte, und da gab es natürlich kein Verschweigen mehr. Das Mädchen floh auf der Stelle aus dem Haus und zu ihrer Familie, der sie bis in die kleinsten Einzelheiten das schreckliche Erlebnis erzählte. Es dauerte keine Stunde, bis alle Schwarzen und die Hälfte der Weißen von Georgetown Bescheid wussten.
†
Wie es allgemein üblich war, wurde die Verstorbene in ihrem Schlafzimmer auf ihrem eigenen Bett aufgebahrt, damit Freunde und Verwandte Abschied nehmen konnten. Aber kaum jemand nutzte das Angebot.
Die van Bruyns und ihre verschwägerten Clans waren recht froh darüber, denn trotz der weißen, spitzen-gesäumten Kissen, auf denen ihr Kopf mit der großen Haube ruhte, der zahlreichen Blumen und Palmzweige bot die Leiche der Alten einen so grässlichen Anblick, dass man ihr das Laken bis zum Kinn hochgezogen hatte und einen Spitzenschleier über das Gesicht breitete, das jetzt überhaupt nicht mehr jugendlich wirkte, sondern einer Jahrtausende alten ägyptischen Mumie glich.
Außerdem tropfte ständig Wasser auf den Boden, obwohl das Bett und das Laken ganz trocken blieben, und wo das Wasser auf die Dielenbretter fiel, da tanzte es wie auf einer glühenden Herdplatte, zischte und fauchte!
Die van Bruyns waren herzlich froh, dass sie Calvinisten waren und ihre Religion ihnen Dinge wie Totenmessen, ja selbst das Segnen des Leichnams und Gebete für die Dahingeschiedenen verbot. Sie wagten sich kaum vorzustellen, was geschehen mochte, wenn man den verwitterten alten Teufelsbraten auch noch weihte und segnete!
Und ebenso froh waren sie über die niemals nachlassende Tropenhitze der Insel, die es notwendig machte, den Sarg ohne lange Zeremonien in die Erde zu senken. Der Geruch, den die Tote ausströmte, war jetzt schon grauenhaft genug, obwohl es nicht eigentlich Fäulnisgeruch war, denn abgesehen von den zischenden Tröpfchen war und blieb der Körper gefroren, als liege er im ewigen Eis der Antarktis. Man beeilte sich sehr mit dem Einsargen, lud den Sarg in eine geschlossene Totenkutsche und fuhr in ungebührlich flottem Tempo zum Friedhof nahe der Küste.
Für gewöhnlich bot dieser von Palmen und tropischen Gehölzen umrahmte Friedhof mit seinen eng nebeneinander liegenden, schneeweißen Gruftdeckeln und dem überreichlichen Blumenschmuck einen idyllischen Anblick.
Aber als die Kutsche mit Madame Delfines Leichnam sich näherte, begannen die Pferde, die schon den ganzen Weg über Schwierigkeiten gemacht hatten, zu scheuen. Der Kutscher konnte sie nicht beruhigen, er musste sie schließlich ausspannen und an einen Baum binden, während die nächsten Verwandten den Sarg auf ihre Schultern luden und zur Gruft trugen.
Die Aufgabe wurde ihnen sauer, denn obwohl der innere Sarg aus Blei gefertigt und verlötet war, wurden sie das Gefühl nicht los, dass andauernd eine übel riechende Brühe auf ihre Schultern und Arme tröpfelte.
Sie atmeten auf, als sie die Gruft erreicht hatten, deren massiven Deckel die Totengräber bereits beiseitegeschoben hatten. Die Arbeiter sahen mürrisch und bedrückt aus, man merkte ihnen auch an, dass sie getrunken hatten, aber niemand machte ihnen einen Vorwurf daraus.
Die Familiengrüfte auf der Insel ähnelten ausgemauerten Kellern von geringer Tiefe, denn da die See immer wieder das Land unterwühlte, begrub man die Toten nicht unmittelbar in der Erde. Oberhalb der Gruft war ein mächtiger Grabstein mit den Daten der bislang Begrabenen aufgestellt worden, aber der Name Delfine van Bruyn war nicht darauf verzeichnet.
Der Steinmetz hatte sich darauf ausgeredet, er habe zu viel zu tun und zu wenig Gehilfen. In Wirklichkeit aber hatte er zu seiner Frau gesagt: »Und wenn sie mir einen Goldbarren so groß wie der Gruftdeckel als Lohn gäben, würde ich das Grab der Hexe nicht anrühren!«
Die vielen Trauergäste beim Begräbnis der Alten hatten mit Trauer nichts im Sinn. Ihre Anverwandten und die Prominenz der Stadt mussten aus Gründen der Höflichkeit kommen, ob sie wollten oder nicht, und der Rest strömte aus Neugier herbei.
Wie alle reichen, weißen Leute von Georgetown hatte Delfine van Bruyn offiziell einer christlichen Kirche angehört, aber der Pfarrer vollzog das Begräbnis mit geradezu unziemlicher Hast und Eile, er hielt nicht einmal eine Leichenpredigt, sondern murmelte nur ein paar unverständliche Worte und bedeutete den Totengräbern, den Sarg hinabzulassen. Die gehorchten, so schnell sie konnten.
Nun hatte die alte Frau, wohl in der Hoffnung, den himmlischen Richter mit einem winzigen Teil ihres Reichtums bestechen zu können, kurz vor ihrem Tod einen Boten in die Kirche geschickt, der einen Brief seiner Herrin und einen dicken Lederbeutel mit Goldstücken brachte – als Spende für die Kirche. Dies, so stand in dem Brief, sollte bei ihrem Begräbnis öffentlich gemacht werden.
Das tat der Pfarrer auch. Als der neue Sarg unten in der Höhlung der Gruft aufsetzte und die Totengräber die Stricke hochzogen, las er den Versammelten den Brief vor, dann öffnete er den Beutel, leerte den Inhalt über den Sarg aus und rief: »Da nimm dein Gold mit in die Ewigkeit, möge es mit dir verdammt sein!«
In dem Augenblick erhob sich ein so mächtiger Wirbelwind, dass er die Kerzen auslöschte, dem Pfarrer den Talar in einer ausgesprochen unwürdigen Weise über den Kopf stülpte und die Blumen davonschleuderte.
Erstaunlicherweise konzentrierte dieser gewaltige Wirbel sich auf Madame van Bruyns Grab. An den umliegenden Ruhestätten schwankten weder die geschmeidigen Hibiskuszweige, noch erzitterten die Blüten der purpurroten Bougainvillea, die so zart wie Schmetterlingsflügel waren! Der Wind brachte überdies einen gräulichen Geruch mit sich, eine Mischung aus Fäulnis und beißenden Chemikalien, wie er in einem Sektionssaal die empfindliche Nase malträtiert.
Die Trauergäste verliefen sich in aller Eile, und die Totengräber waren nur durch ein zusätzliches Taschengeld und eine Flasche Rum pro Person zu bewegen, den steinernen Deckel wieder über die Höhlung zu schieben und die eisernen Klammern einzuschlagen, die ihn am Fundament festhielten.
†
Als der Friedhof längst verlassen im abendlichen Zwielicht lag, kehrte ein Mann in weißer Tropenuniform noch einmal zu dem Grab zurück. Das war Madame van Bruyns Enkel David, ein eleganter junger Bursche, aber aus demselben Teig gebacken wie seine Großmutter.
Diejenigen, die ihn näher kannten, zeigten sich beeindruckt von seiner Intelligenz und Persönlichkeit, aber angewidert von seinem Zynismus, dem nichts heilig war, seinem schrankenlosen Egoismus und seiner schon ans Wahnhafte grenzenden Selbstüberschätzung. Er war nicht gekommen, um seiner Ahnfrau die letzte Ehre zu erweisen. Er suchte das Kästchen.
Unter den persönlichen Habseligkeiten der Verstorbenen war es nicht zu finden gewesen, sodass er fast fürchtete, sie hätte es sich mit ins Grab geben lassen. Ohne recht zu wissen, warum, hoffte er, an ihrer letzten Ruhestätte einen Hinweis zu finden.
Er saß schon eine ganze Weile auf der Grabplatte, eingehüllt von der rasch sinkenden tropischen Dämmerung, und hatte vergeblich auf eine Eingebung gewartet, da überkam ihn aus dem Nichts heraus eine jähe Empfindung, als ob sich über ihm etwas Unheimliches befinde.
Etwas schien in der Luft zu hängen, sehr ähnlich dem Gefühl, das einen überkommt, wenn man sich aus einem dunklen Raum heraus von bösen Augen beobachtet weiß. Er wusste, dass da nichts war (jedenfalls nichts Körperliches) und dennoch ertappte er sich dabei, wie er ein ums andre Mal hinter sich und dann in dem Labyrinth der weißen Gruftdeckel umherblickte. Und noch bevor er sich irgendeine Erklärung zurechtlegen konnte für diese unvermutete Beunruhigung, spürte er, ganz körperlich und ganz unmissverständlich, einen leisen, kalten Hauch über seinen Körper hingleiten.
Es kroch ihm fröstelnd über Kopf und Nacken, als kitzelte ihn jemand unter dem Haar. Er spürte, dass seine Stirn feucht war und sich seine Handflächen mit kaltem Schweiß bedeckten.
Eisiger Schrecken durchfuhr ihn wie ein Blitz, als er unversehens aus dem Schatten heraus angesprochen wurde.





























