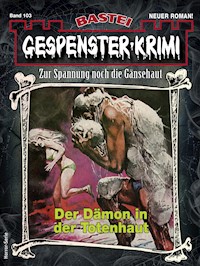1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1692, in der Stadt Salem in Neu-England
"Beschwöre mir Lilith, die Königin der Dämonen, tausendmal schöner als alle irdischen Frauen, dass sie mir zur Lust diene! Dann will ich dir dein elendes Leben schenken."
Leichter gesagt als getan!, dachte der alte Zauberer Ebenezer Whateley, während er in den Seiten des "Höllenzwangs" herumblätterte - dem Buch, das die finstersten aller nekromantischen Beschwörungen enthielt.
Die Seiten aus blutrot gefärbtem Pergament waren teils beschrieben, teils mit grotesken und widerwärtigen Zeichnungen bedeckt, wobei Schrift und Zeichnungen erst sichtbar wurden, wenn der Leser sie anhauchte.
Dann entrollten sich die verschnörkelten Buchstaben wie Schlangen, die aus ihrem Nest herausfahren, und huschten als feurige Linien über das Pergament ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Im Palast der Pestkönigin
Vorschau
Impressum
Im Palast der Pestkönigin
von Camilla Brandner
Im Jahr 1692, in der Stadt Salem in Neu-England
»Beschwöre mir Lilith, die Königin der Dämonen, tausendmal schöner als alle irdischen Frauen, dass sie mir zur Lust diene! Dann will ich dir dein elendes Leben schenken.«
Leichter gesagt als getan!, dachte der alte Zauberer Ebenezer Whateley, während er in den Seiten des »Höllenzwangs« herumblätterte – dem Buch, das die finstersten aller nekromantischen Beschwörungen enthielt.
Die Seiten aus blutrot gefärbtem Pergament waren teils beschrieben, teils mit grotesken und widerwärtigen Zeichnungen bedeckt, wobei Schrift und Zeichnungen erst sichtbar wurden, wenn der Leser sie anhauchte.
Dann entrollten sich die verschnörkelten Buchstaben wie Schlangen, die aus ihrem Nest herausfahren, und huschten als feurige Linien über das Pergament ...
Ebenezer verfluchte im Stillen den gefürchteten Hexenjäger, Reverend Miller-Parson, der diesen Wunsch geäußert – nein, diesen Befehl erteilt! – hatte und gleichzeitig klargemacht hatte, dass er ihm damit die einzige Chance bot, sich von einem Todesurteil wegen Hexerei freizukaufen. Als könnte man Lilith herbeipfeifen wie eine herumlungernde Dirne!
Stirnrunzelnd wandte er sich wieder seiner Lektüre zu. Das Buch war schwer zu lesen und noch schwerer zu verstehen, selbst für ihn. Die bloße Lektüre schien seine Gedanken mit einer purpurschwarzen, schleimigen Schicht zu beflecken, als quelle das niedergeschriebene Böse aus den Seiten in sein Gehirn.
Seine Augen waren müde vom Lesen, sein Kopf brummte von den verschlungenen Diagrammen und abgründigen Geheimnissen, die auf den vergilbten Seiten in Tinte festgebannt standen.
Stundenlang kämpfte Ebenezer Whateley sich durch den pfeffrig riechenden, von Bücherläusen befallenen Wälzer, dessen Schrift häufig bis zur Unleserlichkeit verblasst war und dessen Inhalt so verworren war, dass er kaum einen Sinn darin zu finden vermochte. Es ging schon gegen Morgen, und er hatte nicht einmal gemerkt, dass er seit Stunden las. Dann, ganz unerwartet, stieß er auf das Gesuchte.
Der Hexenmeister beugte sich vor und las jedes einzelne Wort noch einmal, während er mit dem langen, elfenbeingelben Fingernagel die krummen Zeilen nachfuhr. Sein Gesicht verzerrte sich in wölfischem Vergnügen. Tatsächlich, es war eine Anrufung der Dämonenkönigin!
Ebenezer Whateley vergewisserte sich, dass er allein und unbelauscht war, dann traf er alle Vorbereitungen für die Beschwörung.
Er löschte alle Lampen und Kerzen und zündete an ihrer Stelle sieben schwarze Kerzen an. Die stellte er auf die Spitzen des Heptagons, eines siebenzackigen Sterns, den er auf den Boden gezeichnet hatte. Mit magisch kräftiger Kreide, aus Menschenknochen gemahlen, zeichnete er ein Symbol auf den Boden. Leuchtend, sein eigenes irrwischartiges Licht ausstrahlend, prangte in dem fast völlig verdunkelten Raum das Zeichen der Dämonenkönigin, die kein anderer als ein so verderbter Magier wie Whateley zu beschwören gewagt hätte.
Giftige Dämpfe stiegen davon in die Höhe und umwaberten mit dem Geruch verrottender Pilze den Hexenmeister, als er in die Mitte des Siebenecks trat. Mit zitternden Händen legte er das Buch vor sich hin und las im flackernden Kerzenschein die Begrüßung, die das Ritual einleitete. Er streute Räucherwerk auf das Dämonenzeichen, und in den Geruch der fauligen Dämpfe mischte sich der Qualm von Fieberphantasmen erzeugenden Kräutern.
Langsam, mit stockender Stimme intonierte er die Anrufung, die in zackigen, purpurnen Runen in dem Büchlein geschrieben stand.
Der Rauch wurde dichter, immer dichter. Bald stieg er wie armlange, grauweiße Säulen von dem höllischen Symbol auf. Dann teilte sich die Säulen nach allen Richtungen, wanden und verschlangen sich, wurden zusehends höher und dünner und nahmen allmählich die Gestalt eines Leichentuchs an, auf dem sich drei Flecken abzeichneten. Es schwebte und wallte über dem Feuer, wobei es zusehends dichter wurde.
Darunter kauerte, ebenfalls nur undeutlich sichtbar, ein zwergenhaftes Wesen in einem roten Kapuzenmantel. Auf einem zerbrechlichen Körperchen saß ein ungemein dicker und hässlicher Kopf, gelb und runzlig, mit einer hängenden Nase und einem scharf eingekniffenen Mund. Die Augen, erst unter dick geschwollenen Lidern verborgen, öffneten sich mit einem bösartig funkelnden Blick.
Ebenezer Whateley hielt den Atem an – nicht nur wegen des Gestanks, der ihm die Nase verstopfte und seine Lunge zu lähmen drohte, sondern auch vor Verblüffung und Schrecken.
Der Zwerg interessierte ihn nicht, der war nur ein niedriger dienstbarer Geist, wie sie sich stets an die Rockzipfel höherer Dämonen hängten. Aber dieses schwebende Leichentuch? Das war nicht das Wesen, das er zu rufen versucht hatte! Was war es dann?
Er räusperte sich zwei Mal, ehe er die Frage stellte: »Woher kommst du? Du bist nicht Lilith! Wer hat dir geboten, hier zu erscheinen?«
Die weibliche Stimme, die ihm antwortete, klang schleimig und undeutlich, als bahnte sie sich durch schwere Nebel hindurch einen Weg zu ihm. Das Unwesen wandte ihm den Kopf zu, und zum ersten Mal schien es dem Beschwörer, dass er über dem angeschwollenen Mund zwei Augen sah – nein, zwei schwarze Augenhöhlen ohne Augen. Sie waren jedoch so verwischt, dass es auch bloße Flecken oder Schatten auf den missfarbenen Falten der Tücher sein mochten.
Das Ding lachte höhnisch. »Meintest du denn, die majestätische Lilith würde auf dein jämmerliches Gewinsel hin erscheinen? Aber sei unbesorgt. Ich bin gut genug für dich, Ebenezer Whateley, und für den brünstigen alten Narren, der meine Glieder liebkosen will!«
Ebenezer war noch zu verblüfft und erschrocken, als dass er eine Antwort über die Lippen gebracht hätte, aber das Scheusal konnte offenbar seine Gedanken lesen, denn die schleimige Stimme fuhr fort: »Wir wollen einen Pakt schließen, der dich vor dem Scheiterhaufen rettet und mir die Gelegenheit gibt, meinen heißesten Wunsch zu erfüllen. Du musst nur das Opfer bringen, das die finsteren Mächte dafür verlangen, dann werde ich die Gestalt einer schönen Frau annehmen, und du wirst nicht nur mit dem Leben davonkommen, du wirst auch leben und nicht älter werden, als du jetzt bist, solange ich in menschlicher Gestalt existiere. Das kann eine lange Zeit sein, Ebenezer, eine sehr lange Zeit! Und niemals soll es dir an Gold mangeln.«
Jetzt war es eindeutig eine nackte Frau, aber sie erschien verzerrt wie der Anblick einer Ertrunkenen unter einer Eisschicht.
»Und welches Opfer«, fragte der Zauberer heiser, »verlangen diese Mächte?«
»Lies selbst nach.« Die aufgeschlagenen Seiten des Buches begannen sich von selbst umzublättern, bis sie an einer Stelle zur Ruhe kamen.
Ebenezer Whateley las – und erschauerte.
»Das? Nein, nur das nicht!«, ächzte er. »Wer könnte etwas so Ungeheuerliches tun?«
»Du wirst es tun«, antwortete die gespenstische Erscheinung. »Oder willst du lieber lebendig verbrennen?«
Ebenezer rann der kalte Schweiß am ganzen Körper herab, seine Zunge klebte am Gaumen, seine Hände und Füße schienen zu Eisklumpen erstarrt. Aber welche Wahl blieb ihm denn? Der Hexenjäger hatte ihm drei Tage Zeit gegeben, aber der lüsterne alte Schurke war ungeduldig, die Wollust trieb ihn wie mit heißen Stacheln an! Wer wusste denn, ob er nicht schon morgen erschien und die durch Hexenkunst erschaffene Geliebte forderte?
Seine Stimme versagte beinahe, als er hervorstieß: »Wenn du deinen Teil des Paktes einhältst ...«
»Gewiss werde ich das. Und nun lass uns die Einzelheiten besprechen.«
Es wurde ein schauerliches Gespräch zu nächtlicher Stunde, aber zuletzt besiegelten beide den Pakt, und das Wesen, das an Liliths Stelle erschienen war, verabschiedete sich mitsamt seinem dienstbaren Zwerg, der die ganze Zeit stumm und grinsend zu ihren Füßen gehockt hatte.
Das verschwommene Bild, das sich über dem Rauch der Kerzen aufgebaut hatte, fiel in sich zusammen, wirbelte und verschwand. Nur der schweißige Gestank war noch da und umhüllte den Hexenmeister, der mit schmalen Augen und finster gerunzelter Stirn vor sich hin starrte und die Worte des Wesens in sich nachhallen ließ.
Dann rief er seinen Diener und befahl ihm, dem Hexenjäger, Reverend Miller-Parson, nur diese Worte zu sagen: »Was Ihr gefordert habt, sollt Ihr heute Nacht noch bekommen.«
†
Am nächsten Morgen war der Hexenjäger wie üblich auf seinem Weg zum Gebetshaus, das gleichzeitig als Gerichtssaal diente. Seine Gedanken waren jedoch nicht bei den bevorstehenden Verhören, sondern bei der schier unglaublichen Nacht, die er soeben in den Armen eines wundervollen Wesens verbracht hatte.
Eigentlich hatte er ja gar nicht geglaubt, dass diese garstige alte Kröte, Ebenezer Whateley, das Wunder tatsächlich vollbringen könnte, er hatte ihn nur mit einem unerfüllbaren Wunsch herausfordern wollen. Aber zum Teufel, der Alte hatte es geschafft!
Das Weib, das er ihm geschickt hatte, war nicht nur über alle Maßen schön gewesen, es hatte ihm auch Ekstasen verschafft, dass er mehr als einmal geglaubt hatte, er müsste, vom Rausch überwältigt, ohnmächtig werden.
Er schreckte aus seinen Gedanken auf, als ein heftiges Jucken unterm Ellbogen ihn ablenkte. Stirnrunzelnd zog er den Ärmel hoch und besah den rötlich braunen Knoten auf seinem Arm, der offenbar eben erst aus dem Fleisch entsprosst war. Hatte ihn etwas gestochen?
Nein, da war keine Wunde. Der Knoten war glatt, die Haut darüber unversehrt, kein Insektenstachel war hier ins Fleisch gedrungen. Nur oben auf der nussgroßen Erhöhung zeichnete sich wie ein Hühnerauge ein runder, dunkler Fleck ab, der härter war als die umliegende Schwellung.
Er kratzte mit dem Nagel des kleinen Fingers daran. In dem schwarzen Auge des Knotens zeichneten sich Sprünge ab, winzig und fein. Reverend Miller-Parson kniff die Augen zusammen.
Im nächsten Augenblick brach das Unheil über ihn herein. Die Pustel schwoll zu Faustgröße an und platzte. Sein Unterarm nahm eine wächsern dunkelgelbe Farbe an und bedeckte sich mit braunen Fleckchen, das Fleisch weichte auf und rutschte da und dort wie Schlamm von den Knochen. Ein entsetzliches Geheul entrang sich seiner Kehle, als er an der von juckenden Flecken übersäten Haut rieb und plötzlich einen zähen, breiigen Klumpen seines eigenen Fleisches in der Hand hielt.
Was danach geschah, ist nirgends niedergeschrieben. Es wurde nur immer weiter und weiter erzählt, von den Großeltern zu den Eltern und von diesen den Kindern und Kindeskindern, immer mit gedämpfter Stimme und hinter vorgehaltener Hand: Wie seinerzeit, im Jahr 1692, dem Jahr der großen Hexenverfolgung in Salem, von einem Unbekannten ein unaussprechlich gotteslästerliches Verbrechen begangen worden war, wie kurz danach ein berüchtigter Hexenjäger ein grausames Ende genommen hatte, wie der alte Ebenezer Whateley spurlos verschwunden war, sodass man schon dachte, er hätte mit eigener Hand sein sündenbeladenes Leben beendet – wie man aber viele Jahre später einen Ebenezer Whateley in New Orleans gesehen hatte, wo er als reicher Mann lebte und zuweilen in Gesellschaft zweier ungewöhnlicher Personen gesehen wurde.
Die eine war eine hochgewachsene, sehr schöne Dame, die andere ein zwergenhaftes Wesen mit dickem Kopf, das die rote Livree eines Dieners trug und nie von ihrer Seite wich. Fragte man diesen Ebenezer, so antwortete er stets, er sei nur ein entfernter Nachfahre der Whateleys, die einst in Salem gewohnt hatten, und hätte sie niemals persönlich kennengelernt, auch hätte er nichts mit ihrem Hexentreiben zu tun.
Wie denn auch? Er sei zwar kein junger Mann mehr, aber jener Ebenezer, über den so viele schreckliche Geschichten im Umlauf waren, müsste inzwischen weit über hundertfünfzig Jahre alt sein! Nein, er sei nur durch den Namen mit den Whateleys verbunden und im Übrigen ein stiller Gelehrter, der für seine Wissenschaft lebte. Und das, so sagten die Bürger von New Orleans, mochte ja durchaus stimmen – man fragte sich nur, welche Wissenschaft das sein mochte!
†
Im Jahre 1773
Auf dem Höhepunkt des Unabhängigkeitskrieges der dreizehn amerikanischen Kolonien gegen Großbritannien schlich ein Häuflein Männer durch eine einsame Gegend an der Ostküste. Ihre Blicke schweiften furchtsam nach allen Seiten. Sie waren Deserteure der britischen Armee und ihrer Verbündeten, was bedeutete, dass sie Freiwild für beide Seiten waren – sowohl die Engländer wie die Aufständischen hätten sie auf der Stelle erschossen.
Und außerdem versorgten sie sich schon seit einer ganzen Weile damit, dass sie einsame Bauernhöfe überfielen, dort alle Bewohner niedermetzelten und sich mit allem Essbaren aus dem Staub machten, wofür man sie bei erster Gelegenheit gelyncht hätte.
Kurz vor der Abenddämmerung waren sie wieder in einen Waldpfad abgebogen, um im Schutz der Nacht zu kampieren. Sie stellten freilich bald fest, dass sie ihren Weg nicht günstig gewählt hatten. Der Pfad führte geradewegs auf eine Begräbnisstätte.
Bei Nacht wären sie zweifellos auf der Stelle umgekehrt, aber bei Tageslicht und in einer ganzen Gruppe von Menschen wollte keiner sich als Feigling erweisen, und so trotteten sie voran, dicht aneinander gedrängt und ängstlich nach allen Seiten spähend.
Schaudernd sahen sie zwischen verwilderten Farnen die uralten schwarze Grüfte, die schon so lange unbelegt waren, dass man durch die zersprungenen Deckel in ihre Tiefen hinunterblicken und unten die Bleisärge stehen sehen konnte. Ihre Schritte blieben lautlos auf den unregelmäßigen Bodenplatten des dick bemoosten Weges, den schon lange kein menschlicher Fuß mehr betreten hatte.
Die Ruinen altertümlicher Gruftgebäude und Mausoleen, schwarz und grau und mit gemeißelten Inschriften versehen, ragten stumm in die diesige Luft.
Captain Randolph, ihr Anführer, schob den beängstigenden Gedanken beiseite, dass ein so ausgedehnter und protziger Friedhof in eine so wilde Gegend nicht hineinpasste, und außerdem sah er nirgends ein Kreuz auf einem Grab, nur geflügelte Gestalten, deren Gesichter ihm nicht so recht gefielen. Harpyien waren es, Monster, die die Flügel, die Klauen und den langen Schnabel von Raubvögeln hatten, aber Kopf und Brüste von Frauen. Sie waren mit orange-grünen Flechten bewachsen, was ihnen ein erstaunlich lebendiges Aussehen verlieh.
Er wurde den Eindruck nicht los, dass diese Gestalten die Köpfe wandten, wenn sie vorbeigingen, und ihnen mit bösen Augen nachsahen. Auch die Inschriften auf den Steinen und Gruftdeckeln waren so eigenartig, als dienten sie nicht der Erinnerung an die Verstorbenen oder dem Lobpreis ihrer Tugenden, sondern seien samt und sonders zauberische Siegel, die die Toten in ihre Gräber bannen und die Lebenden davor warnen sollten, ihnen nahe zu kommen.
Und Randolph fürchtete, dass diese Siegel ihre Kraft verloren hatten, denn als er in das Gräberfeld hinein schritt, schien ihn ein Chor wispernder Stimmen zu umflüstern, ja es war, als fassten nebelgleiche Hände die seinen und zögen ihn am Gewand weiter. Er schritt, wie von unsichtbaren Helfern geführt, einen der breiten, mit schwarzem Stein gepflasterten Hauptwege entlang, vorbei an den Grabhäuschen reicher Familien und weiter in die Grabreihen.
Die wenigsten dieser Grabmäler waren noch völlig erhalten, sie mussten seit ewigen Zeiten hier stehen und waren zerfressen von Grünspan, Rost und Steinfäule. Endlich jedoch gelangten sie an ein noch völlig erhaltenes Mausoleum aus schwarzgrauem Stein, dessen bronzenes Tor geschlossen war. Auf dem Torbogen war ein Wappen befestigt, das keiner von ihnen jemals gesehen hatte. Zwei steinerne Harpyien bewachten den Eingang.
»Verflucht!«, murmelte einer der Männer in seinen Bart. »Harpyien! Bei uns zu Hause sagt man, sie seien die Mägde der Pestkönigin, und wo man sie finde, sei ihre Herrin nicht weit!«
Randolph jedoch atmete auf. Hier waren sie sicher, niemand würde den Schein des Feuers sehen, auf dem sie die gestohlenen Hühner und Hasen brieten. Und das tiefe Torgewölbe war ihnen sehr willkommen, denn zu alle dem war auch noch schlechtes Wetter aufgezogen.
Die Sonne zeigte sich nicht mehr. Der Himmel war schwarz, die glühend gerändelten Wolken aufgetürmt wie ein Meer im Sturm, ein koboldartig springender Wind pfiff fauchend durch die Büsche.
Auch die anderen Männer sahen zufrieden aus, und ein Halbindianer namens Cantalet jauchzte angesichts dieses unbeschädigten Gebäudes laut und freudig auf. »Ei, das gefällt mir!«, rief er. »Das sind die Grüfte reicher Leute! Eine Schatzkammer, meine Freunde! Die Toten decken sich mit Silber und kostbaren Steinen zu!«