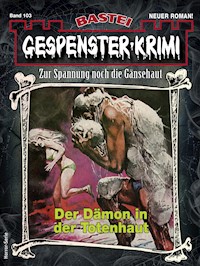1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Kapitän Thomas Wynfield setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. So oft er nach Nemmerwejnrike - das die Engländer St. Nimmerlein nannten - kam, musste er sich erst daran gewöhnen, dass hier alles anders war als "oben" - oder "draußen" oder "drüben", wie man es nahm.
Alles war von derselben sepiabraunen Farbe, die Erde, die Häuser und der Himmel, an dem keine Sterne standen, auch kein Mond und keine Sonne. Alles verzerrte ein dünner Nebel, als betrachtete er das verfluchte Dorf durch eine zu starke Brille. Kein Laut war zu hören, obwohl Wynfield wusste, dass in allen Häusern Leute in ihrem Festtagsputz ungeduldig und aufgeregt warteten. Sie würden erst herauskommen, wenn das Zeichen gegeben wurde und der Hohepriester bereitstand, das Opfer zu bringen.
Wynfield kam jedes Jahr zum Opferfest, aber diesmal brachte er außer reichen Geschenken auch eine erfreuliche Neuigkeit mit: Seine Tochter Isobel würde bald einen Sohn empfangen - einen Sohn vom reinem Blut der Familie Wynfield, denn kein anderer war würdig, die Zeremonien des großen Gottes DAGON zu vollziehen. Der alte Kult würde weiterleben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Im Zeichen des Zyklopenauges
Vorschau
Impressum
Im Zeichen des Zyklopenauges
von Camilla Brandner
Kapitän Thomas Wynfield setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. So oft er nach Nemmerwejnrike – das die Engländer St. Nimmerlein nannten – kam, musste er sich erst daran gewöhnen, dass hier alles anders war als »oben« – oder »draußen« oder »drüben«, wie man es nahm.
Alles war von derselben sepiabraunen Farbe, die Erde, die Häuser und der Himmel, an dem keine Sterne standen, auch kein Mond und keine Sonne. Alles verzerrte ein dünner Nebel, als betrachtete er das verfluchte Dorf durch eine zu starke Brille. Kein Laut war zu hören, obwohl Wynfield wusste, dass in allen Häusern Leute in ihrem Festtagsputz ungeduldig und aufgeregt warteten. Sie würden erst herauskommen, wenn das Zeichen gegeben wurde und der Hohepriester bereitstand, das Opfer zu bringen.
Wynfield kam jedes Jahr zum Opferfest, aber diesmal brachte er außer reichen Geschenken auch eine erfreuliche Neuigkeit mit: Seine Tochter Isobel würde bald einen Sohn empfangen – einen Sohn vom reinem Blut der Familie Wynfield, denn kein anderer war würdig, die Zeremonien des großen Gottes DAGON zu vollziehen. Der alte Kult würde weiterleben ...
Die Umrisse der Häuser verschwammen in den braunen Schwaden, die wie Tabakrauch durch das Dorf zogen – bäuerliche, altväterliche Häuser, aber unverkennbar die Wohnstätten reicher Leute.
Von anderen unterschied sich Nemmerwejnrike auch dadurch, dass man hier keine Ställe und Viehweiden sah, nicht einmal eine Hundehütte oder ein Taubenhaus, denn die Leute gewannen ihre Nahrung allein aus dem nahen Meer.
Eine Kirche hatten sie, sogar eine erstaunlich große und prächtige Kirche, die man schon fast eine Kathedrale nennen konnte, aus schwarzem Stein erbaut, mit einer kunstvoll gemeißelten Fassade und vorspringenden Pfeilern. Sie waren mit vielen Figuren geschmückt, aber es waren keine Heiligen, sondern allerlei Getier aus den Tiefen des Meeres, Kraken, Aale, Krabben, Fische, und im Giebel über dem Eingang wand sich eine gewaltige Seeschlange, mit vier Hörnern auf dem Kopf, aber nur einem einzigen Auge, groß wie ein Bierfass, das aus der Stirn heraus starrte.
Wynfield beugte das Knie, dann betrat er das seltsame Heiligtum, das kaum Ähnlichkeit mit irgendeiner anderen Kirche hatte. Es war nämlich zum Meer hin in einem gewaltigen, gemauerten Bogen offen, und vor diesem Bogen stand ein pyramidenförmiges Gestell, an dem drei in Fischernetze gewickelte Menschen hingen. Zwei brüllten sich die Seele aus dem Leib, aber der Dritte war wohl vor Angst ohnmächtig geworden, denn er hing schlaff und reglos in seinem Netz. Die anderen beiden, dachte der Kapitän, würden wohl ebenfalls ohnmächtig werden, wenn sie sahen, was aus dem Meer auftauchte und sein rundum mit dolchspitzen Zähnen besetztes Maul aufriss, um sie zu verschlingen!
In der Kirche brannten keine Kerzen, nur eine schwache, faulige Helligkeit umgab die Opferstelle, während der braune Nebel den Rest des Gebäudes fast unsichtbar machte. Wynfield setzte sich in die erste Bank – seine Familie hatte, ihrer Verdienste wegen, seit Jahrhunderten ihr eigenes Kirchengestühl, prächtig verziert mit denselben Wasserwesen, die draußen in viel größerem Maßstab das Eingangstor schmückten.
Hinter sich hörte er gedämpfte Schritte in den Schatten. Das waren die Schritte von Leuten, die, wie er selbst, von »draußen« oder »oben« zu Besuch kamen. Die Bewohner von Nemmerwejnrike selbst machten kein Geräusch, wenn sie die Füße auf den Boden setzten. Der Kapitän wandte sich nicht um. Er wusste, dass er Bekannte sehen würde, und genau deshalb galt es als höchst unhöflich, sich für andere zu interessieren.
Ein Klang wie ein dumpfes Nebelhorn ertönte – das Zeichen, dass die feierlichen Zeremonien zu Ehren Dagons begannen. Die Opfer verstanden das auch, sie strampelten und kreischten verzweifelt, aber die Fischernetze hielten fest, was sie gefangen hatten. Aus einem Raum, den man wohl die Sakristei nennen konnte, traten einige Ministranten und Kirchendiener in grau-grün schillernden Roben, und schließlich wurde in einer offenen Sänfte der Hohepriester hereingetragen.
Er war so uralt, dass er – obwohl die Diener Dagons alle ein sehr hohes Alter erreichten – wohl demnächst aus dieser Welt scheiden und in den Tiefen des Meeres verschwinden würde. Seine Arme und Hände waren so flach und schlaff, dass sie eher verschrumpelten Flossen ähnelten, sein großer Kopf war unbehaart und von farblosen Schuppen bedeckt.
Wynfield dachte: 21 Jahre lang musst du noch durchhalten, Alterchen, dann ist dein Nachfolger erwachsen und kann dein Amt übernehmen.
Er rieb sich die Hände. Die Wynfields hatten immer schon hohe Positionen innegehabt, aber der Jüngste ihres Stammes würde etwas Besonderes sein, gezeugt aus dem reinen Blut seiner Familie und dem Samen der gewaltigen grauen Seeschlange. Nach dem Opferfest würde er dem Hohepriester seinen Plan mitteilen und – gewissermaßen als Vorschuss – die Geldtruhe erhalten, die niemals leer wurde. Welche Geschenke warteten erst auf ihn, wenn das noch ungeborene, ja noch nicht einmal empfangene Kind zum Mann herangewachsen war!
Er selbst würde den Jungen lehren und erziehen, einen Meister aller bösen Künste aus ihm machen, einen Feind des Lichts, der Menschen und ihrer im Himmel wohnenden Götter. Halb Schlange, halb Mann würde er ein Monstrum sein, das seiner Vorgänger und seiner Familie würdig war.
Rund um sich hörte Wynfield ein Rauschen, als die Anwesenden sich ehrfürchtig erhoben, und in aller Eile sprang er hoch, um dem Ding, das nun durch den Mauerbogen hereinkroch, die Ehre zu erweisen.
Das Gejammer der Opfer steigerte sich zu einem wahnwitzigen Höhepunkt, als der graue, glänzende Riesenschädel mit den vier Hörnern sich hereinschob und das Maul aufriss ...
Die Leute von Nemmerwejnrike jubelten ihrem Gott zu.
†
London, im Jahr 1854
»Kommen Sie nur herein, liebes Fräulein! Keine Angst!« Der Zahnarzt reichte Isobel eine schwammige, kalt-feuchte Hand. »Wie Ihr Herr Vater Ihnen sicher bestätigen wird – nicht wahr, Herr Kapitän? –, ist mit unserem modernen Narkoseapparat das Zahnziehen so schmerzlos wie Nägel schneiden. Sie werden gar nicht spüren, was mit Ihnen geschieht ...«
Als hätte der vereiterte Backenzahn gemerkt, dass von ihm die Rede war, schoss der Schmerz von Neuem aus seiner Wurzel bis in Isobel Wynfields geschwollene Wange. Sie konnte an nichts anderes mehr denken als daran, von diesem Schmerz befreit zu werden. Sie vergaß den Widerwillen, den der feiste, unappetitliche Zahnarzt in ihr erweckte, vergaß die Angst vor alle den spitzen und scharfen Instrumenten in den elfenbeingelb lackierten Metallkästen und Vitrinen, vergaß sogar die Angst vor dem hohen, metallglänzenden Zylinder des Narkoseapparats mit seinen Schläuchen und dem daran hängenden Trichter, der am Kopfende der Behandlungsliege stand. Aufstöhnend ließ sie sich auf die Liege sinken.
Ihr Vater blieb im Hintergrund stehen, die Hände in den Taschen. Für gewöhnlich fürchtete Isobel – eine magere, blasse Jungfer von neunzehn Jahren – nichts auf der Welt mehr als diesen Kerl mit seinem Backenbart, dem rot geäderten Gesicht und seinen stechend fahl-grünen Augen, aber jetzt war sie froh über seine Gegenwart. Allein in Anwesenheit eines fremden Mannes das Bewusstsein zu verlieren, das hätte sie nicht gewagt.
Zu ihrem Schrecken zog der Arzt zwei Gurte an der Seite der Liege hervor und machte Anstalten, den einen über ihren Bauch, den anderen über die Schultern und Oberarme zu schnallen, aber er beruhigte sie eilfertig: Sie wolle doch nicht am Ende von der Liege fallen, wenn sie in ihrem Narkoseschlaf eine unwillkürliche Bewegung machte?
Nein, das wollte sie nicht. Und jetzt tat der vereiterte Backenzahn so weh, dass ihr Augenlid und ihr Mundwinkel auf dieser Seite wie gelähmt herabhingen und sie an nichts anderes denken konnte, als diesem Schmerz zu entkommen. Ohne Widerstand ließ sie zu, dass der Arzt den wie rote, wulstige Lippen geformten Gummitrichter auf ihren Mund und ihre Nase setzte.
Im nächsten Augenblick strömte ein unangenehm riechendes Gas in ihre Atemwege. Instinktiv wollte sie es aushusten, aber schon breitete sich eine schwere Lähmung über ihren Körper aus. Ihr schien, dass sie wie Blei in die Liege sank. Aber wenigstens ließ zugleich auch der Schmerz nach, war jetzt nicht mehr scharf und sengend, sondern dumpf, als schlüge jemand mit der geballten Faust an ihre Wange, und dann verschwand er völlig. Nacht senkte sich auf ihre Augen, Stille auf ihre Ohren. Nach den vielen Stunden, in denen sie sich vor Schmerz verkrampft hatte, entspannte sie sich jetzt völlig.
Sie hatte gedacht, der Narkoseapparat würde eine Art Scheintod in ihr bewirken, aber sie träumte. Statt auf der weißen Behandlungsliege lag sie in einem altväterischen Himmelbett, dessen Vorhänge ihr den Blick auf die Stube verwehrten. Statt des kleinen Doktors mit seinem Käsegesicht hielt eine alte Frau den Gummitrichter fest.
Was für eine garstige, gelbe, verschrumpelte Alte das war, und auf den Handrücken hatte sie lange, borstige graue Haare wie ein Affe! Unter ihrer Haube blinzelten fahl-grüne Augen hervor.
Isobel hörte sie in einem kuriosen, halb englischen, halb holländischen Dialekt flüstern: »Still, still, gleich kommt das Kindlein in die Welt ...«
Aber sie war doch nicht hier, um ein Kind zu gebären, sondern um sich einen Zahn ziehen zu lassen? Dennoch, die widerliche Greisin hatte recht, etwas regte sich schmerzhaft in ihrem jungfräulichen Schoß, drängte heraus – oder hinein? Immer wieder wurden die muffig riechenden Bettvorhänge beiseite gezogen, und schattenhafte Gestalten blickten herein, Männer und Frauen in einer Kleidung, wie man sie in vergangenen Zeiten getragen hatte.
Sie alle schienen ungemein neugierig und von einer wilden, freudigen Erregung erfüllt, der jedoch etwas Böses anhaftete. Sie erwarteten etwas, aber nichts Gutes.
Ab da wurde der Traum vollends absurd, denn Isobel träumte, dass eine armdicke, glänzende weiße Schlange sich zwischen ihre Beine zwängte, in sie hineinkroch und weiter durch ihr Inneres, bis sie endlich, mit Blut und Schleim bedeckt, sich durch die Kehle und zum Mund wieder hinauswälzte.
Sie empfand kaum Schmerzen dabei, aber ein Gefühl unendlichen Widerwillens. Dann ein scharfer Schmerz, als reiße jemand ihr den Unterkiefer herab, ein Ziehen und Knacken – war diese Schlange denn nicht viel zu dick, um sich durch den Mund ins Freie zu zwängen?
»Das Kind ist da!«, jubelte eine heisere Stimme.
Der Trichter wurde von ihrem Gesicht genommen. Sie hörte ein Lachen, hörte etwas klirren und sah aus verschwollenen Augen, wie der Zahnarzt ihr ein verschraubtes Gläschen vors Gesicht hielt. Darin schwebte in einer wasserklaren Flüssigkeit ein abscheuliches Ding, riesengroß, graugelb verfärbt, mit scharfen, gekrümmten Zacken ...
»Da haben wir Ihren bösen Zahn, liebes Fräulein«, rief der Arzt vergnügt. »Hei, der hat sich gewehrt bis zum Letzten, aber meiner Zange hat er nicht widerstehen können! Ich habe ihn herausgekriegt!« Damit löste er die Riemen, die sie festhielten.
»Nun, Madame Zimperlich, haben wir überlebt?« Das war die raue Stimme ihres Vaters. »Erst all das Geheule und Gezeter, welche Angst du vor dem Narkoseapparat hast, und jetzt hast du geschlafen wie ein Säugling, während der Doktor an deinem Zahn werkte!«
Nein, habe ich nicht, dachte Isobel, während sie sich mühselig aufsetzte. Ich habe etwas ganz Entsetzliches geträumt, und jetzt ist mir totenübel, ich bin schwindlig ... Sie krümmte sich zur Seite und erbrach Blut, Eiter und Schleim in eine Porzellanschale, die der Arzt ihr eilfertig vors Gesicht hielt.
»Spülen Sie jetzt den Mund aus. Vorsicht, das brennt ein bisschen, muss aber sein, damit Sie keine Entzündung bekommen.«
Die Tülle einer Schnabeltasse wurde zwischen ihre Zähne geschoben, und ein Schwall von etwas, das glühend heiß und eisig kalt zugleich zu sein schien, ergoss sich in ihren Mund. Dann erkannte sie den Geruch: Hochprozentiger Wacholderschnaps, wie ihr Vater ihn zu trinken pflegte. Sie schluckte, würgte, spuckte aus und musste sich gleich darauf gegen einen weiteren Schwall wehren, aber so gräulich der Schnaps roch und schmeckte, er reinigte und betäubte die Wunde in ihrem Kiefer, also leistete sie keinen Widerstand.
Als sie aufstehen wollte, stellte sie entsetzt fest, dass sie während der Narkose ihre Blase nicht hatte beherrschen können. Ihre Unterwäsche war nass. Nicht auszudenken, wenn ihr Vater das merkte!
Das wenigstens blieb ihr erspart – wahrscheinlich übertönte der Gestank des Narkosemittels den Uringeruch. Der Kapitän wickelte sie, ohne noch viele Worte zu machen, in eine Decke, hob sie auf seine Arme und trug sie zu der wartenden Kutsche hinunter, wo er sie auf die Rückbank legte.
Die Hufe der Pferde klapperten, das Fahrzeug ruckelte. Isobel wusste nicht, ob sie einschlief oder in Ohnmacht fiel. Sie bekam überhaupt nichts mit von der Rückfahrt. Zu vollem Bewusstsein gelangte sie erst wieder, als sie im Haus ihres Vaters in ihrem eigenen Bett erwachte, sauber gewaschen, in einem frischen Nachthemd und Nachthäubchen. Alles war wieder gut. Der Zahn war draußen, und an der Stelle, wo er gesessen hatte, klopfte nur noch ein dumpfer Schmerz.
In ihrem Unterleib auch.
†
Zwei Monate später merkte sie, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Erst hatte sie sich gefreut, als die verhasste monatliche Blutung ausblieb, bei der sie sich immer so schmutzig vorkam, aber dann wurde ihr morgens schon vor dem Aufstehen übel, und sie spürte genau, dass sich in ihrem Körper etwas verändert hatte.
Nur wusste sie nicht, was, denn wie fast alle viktorianischen Mädchen hatte Isobel – die obendrein ein sehr scheues und prüdes Geschöpf war – keine Ahnung, dass das Anzeichen einer Schwangerschaft waren.
Es war ihr Vater selbst, der sie in einer gewohnt derben Art darauf ansprach, als er eines Abends mit ihr allein in seinem Studierzimmer war. »Na, Mädel, hast ein Brot im Ofen?«, fragte er mit einem Blick auf ihr Bäuchlein, das sich kaum merklich zu wölben begann. Sie blickte ihn verständnislos an, worauf er deutlicher wurde: »Du kriegst ein Kind.«
Sie begriff nicht. Kinder bekam man doch nur, wenn man verheiratet war. Und wenn unverheiratete Frauen ein Kind bekamen, wie es einem ihrer Dienstmädchen widerfahren war, dann beschimpfte man sie und jagte sie aus dem Haus, und sie konnten nichts anderes tun, als »ins Wasser zu gehen«. Am Themseufer, unter der London Bridge, gab es sogar eine bestimmte Stelle, das »Totenloch«, wo die Fischer fast jeden Morgen die aufgequollenen Leichen von Ertrunkenen fanden.
Sie war nahe daran, vor Entsetzen in Ohnmacht zu sinken, denn Schwangerschaft bedeutete Schuld und Schande, und sie war sich keiner Schuld bewusst. Zu ihrem Erstaunen machte ihr Vater allerdings keine Anstalten, sie zu verfluchen und aus dem Haus zu jagen. Im Gegenteil, er schien recht vergnügt zu sein.
Er füllte holländischen Genever aus der immer bereitstehenden Flasche in ein Glas, und nachdem er den starken Wacholderschnaps in einem Schluck hinuntergekippt hatte, sagte er: »Tja, nun müssen wir zusehen, dass es niemand bemerkt, sonst haben wir das Gerede am Hals. Ich bringe dich morgen in ein stilles Dorf zu einer Bäuerin, wo du in aller Ruhe bleiben kannst, bis das Kind geboren ist. Danach brauchst du dich nicht mehr darum zu kümmern, wir lassen es in St. Nimmerlein, dort wird man schon dafür sorgen. Dann kannst du wieder nach London zurückkommen, und ich besorge dir einen Ehemann, damit ist die Sache aus der Welt.«
Wenn es etwas gab, das Isobel noch weniger wollte als ein Kind, so war es ein Ehemann. Sie schauderte bei dem bloßen Gedanken an einen Mann in ihrem Bett. Ihre Mutter war gestorben, kaum dass sie sich an sie erinnern konnte, und da der Vater so häufig auf See war, hatten zwei altjüngferliche Tanten in Northumberland sich um sie gekümmert – das heißt, sie hatten sie versorgt und im Übrigen klargemacht, dass sie so wenig wie möglich von ihr sehen wollten.
Isobel war zufrieden gewesen, dass sie ein Dach über dem Kopf und genug zu essen hatte und vor allem ihren Vater nicht sehen musste. Obwohl der Aufenthalt bei den Tanten hauptsächlich aus Gartenarbeit, Handarbeiten und langen, einsamen Spaziergängen im Park bestanden hatte, hatte Isobel bitterlich geweint, als der alte Schurke dem Meer Adieu sagte und sich im prächtigen Haus der Familie auf dem Loftus Square in London auf Dauer niederließ. Was für eine Art Mann er ihr aufdrängen wollte, das konnte sie sich vorstellen!
†
Selten war ein Mädchen so verzweifelt und verstört zu Bett gegangen wie Isobel an diesem Abend, und vielleicht war das der Grund, warum sie einen so außergewöhnlich seltsamen Traum hatte.
Sie wandelte jenseits der Grenzen des Schlafes durch eine Einöde, die sie im Leben nie gesehen hatte und die ihr doch ganz erstaunlich vertraut erschien. Geradeaus blickend, sah sie über kahle rostrote Hügel hinweg auf eine Landschaft zerklüfteter Berge am Horizont, über deren bizarren Felsformationen eben die Dämmerung anbrach. Stellenweise streckte ein Dornenstrauch seine ineinander verworrenen Ranken zu Himmel, und an einigen Stellen wuchs ein mannshohes, von Dornen starrendes Gewächs, das wie ein Zwitter aus einem knorrigen Baum und einem Kaktus aussah.
Inmitten dieser öden und düsteren Landschaft erhob sich im kränklichen Zwielicht auf dem Grund eines trichterförmigen Tals eine wunderlich gestaltete Zitadelle. Sie schien aus dem nackten Felsgrund emporgewachsen zu sein und aus nichts anderem zu bestehen als diesem Fels. Kein Ziegel, kein Quader war zu ihrem Bau verwendet worden, kein Löffel Mörtel, kein Splitter Holz.
In ihrem Traum schritt Isobel auf diesen Turm zu. Eine halb zerfallene steinerne Treppe führte hinauf. Sie wollte schon den Fuß auf die erste Stufe setzen, als sie, von einem schwachen Geräusch alarmiert, nach oben blickte.