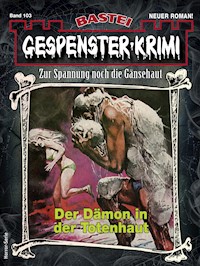1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Du bist drauf und dran, etwas sehr Böses zu tun, Iain Dhub, aber besser böse und reich als fromm und jedermanns Stiefelknecht!" Der greise Baron Cornelis de Rochay lachte, zog die Schublade einer Rokoko-Kommode auf und entnahm ihr eine Maske aus rotem Samt, die er dem Jüngling reichte. "Zieh sie an und nimm sie unter keinen Umständen ab. Vergiss den alten Spruch nicht: Wer mit dem Teufel speisen will, muss einen langen Löffel haben." Während er redete, wählte er für sich selbst eine ähnliche Maske. "Iain Dhub, von deinem Mut und deiner Härte allein hängt es ab, ob du mein Erbe und Nachfolger wirst. Mach keine Fehler - du würdest teuer dafür bezahlen!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Pakt der Blutsäufer
Vorschau
Impressum
Pakt der Blutsäufer
von Camilla Brandner
In der Mittsommernacht im Herrenhaus Woolgrate Mansion, nahe ›The Borders‹, der Grenze von Schottland und England
»Du bist drauf und dran, etwas sehr Böses zu tun, Iain Dhub, aber besser böse und reich als fromm und jedermanns Stiefelknecht.«
Der greise Baron Cornelis de Rochay lachte, was sich anhörte wie das Bollern eines uralten Truthahns. Er zog die Schublade einer Rokoko-Kommode auf und entnahm ihr eine Maske aus rotem Samt, die er dem Jüngling reichte.
»Zieh sie an und nimm sie unter keinen Umständen ab. Denk an den alten Spruch: Wer mit dem Teufel speisen will, muss einen langen Löffel haben.«
Während er redete, wählte er für sich selbst eine ähnliche Maske. Die zog er sich über den Kopf und ergriff den Jungen am Arm. Seine unnatürlich langen, dürren Finger krampften sich schmerzhaft in das feste Fleisch.
»Iain Dhub, vergiss nicht: Von deinem Mut und deiner Härte allein hängt es ab, ob du mein Erbe und Nachfolger wirst – oder ein Bettelknabe, der die Brocken fressen muss, die bei seiner Familie unter den Tisch fallen. Mach keine Fehler. Du würdest teuer dafür bezahlen.«
Mit diesen Worten zog er sich einen langen Kapuzenmantel über, der wie die Kutte eines Mönchs aussah, und reichte dem Jungen einen zweiten in dessen Größe.
»Warum, was würde geschehen?«, fragte der Dreizehnjährige neugierig.
»Das möchtest du lieber nicht wissen.«
Der Baron verzog das Gesicht unter der Maske zu einer hässlichen Grimasse. Hätte Iain Dhub sie gesehen, hätte er es sich vielleicht noch einmal überlegt. Aber da war sein verletzter Stolz, dass die Familie Cunningham ihn zwar ernährte und kleidete, ihn aber nie wirklich akzeptiert hatte – als wäre er nicht der Sohn von Arthur und Georgina Cunningham, sondern irgendein in der Gosse aufgelesener Straßenjunge! Er hatte sich vorgenommen, in drei Jahren – wenn sein Aufenthalt im Internat abgelaufen war – möglichst rasch zu möglichst viel Geld zu kommen. Zu mehr Geld, als sein Onkel mit seinen Fabriken verdiente, sodass er ihm einmal so richtig ins Gesicht spucken konnte.
Und da war Umna, das schöne Mündel des Barons, die ihn wie Luft behandelte, obwohl sie selbst nichts Besseres war als eine arme Verwandte. Wenn die Rotmützen ihm erst geschenkt hatten, was er begehrte, dann mochte kommen, was wollte ...
Sein normalerweise ernstes, ja, düsteres Gesicht verzog sich zu einem selbstzufriedenen Lächeln.
Und mit diesem Lächeln unter der Maske tat er entschlossen den Schritt in den Abgrund.
†
Drei Jahre später in der Praxis von Dr. Löwelyn in Edinburgh
Dr. Baruch Löwelyn, Nervenarzt in Edinburgh, saß in seinem Studierzimmer, ein hagerer älterer Herr, dessen Gesicht eine Wildnis von aschblondem Haar, Schnauzbart und Bart umrahmte, mit einer Stahlbrille auf der langen, knochigen Nase und Augen, mit denen er bis in die Seelen der Menschen sah. Er war mehr als nur ein exzellenter Psychiater und Pädagoge, er war auch hellsichtig, was er allerdings vor den meisten Menschen verborgen hielt.
Soeben schlug er eine neue Krankenakte auf, tauchte die Feder in die Tinte und schrieb unter dem Datum:
Da diese Niederschrift weder zu seinen noch zu meinen Lebzeiten allgemein bekannt werden soll, wage ich hier zu Beginn den vollen Namen und Stand meines Patienten zu nennen: Johannis Baptista Cunningham, ehelicher Sohn des Fabrikanten-Ehepaares Cunningham, das bei einem Felssturz am Arthurs Seat gleichzeitig zu Tode kam und den Jungen im Alter von drei Jahren als Waise zurücklassen musste. Er wurde in der Folge seinen Verwandten zur Versorgung übergeben, die ihn auch tatsächlich wie ihre eigenen Kinder aufzogen.
Von seiner Krankengeschichte – der seltsamsten, die mir je unterkam – könnte ich bis heute nicht sagen, ob es sich um einen Kriminalfall, eine bislang unbekannte medizinische Extravaganz oder eine tatsächliche Begegnung mit den Mächten der Finsternis handelte. Sie schockierte mich derart, dass ich nahe daran war, die Konsultation abzulehnen. Aber dann reizte es mich, ein brennendes Scheit aus dem Feuer zu reißen, wie die Bibel sagt. Doch wie ich mir dabei die Finger verbrannte!
Da seine spießbürgerliche Familie gänzlich unfähig war, ihn richtig zu behandeln, wurde ich sehr bald sein Vormund und ärztlicher Betreuer.
Als ich ihn kennenlernte, war er sechzehn Jahre alt und bereits so verdorben, wie man in diesem Alter nur sein kann. Äußerlich war er eine angenehme Erscheinung. Er hatte die normale Größe und Statur seines Alters, war seinem großbürgerlichen Stand gemäß gekleidet und leistete sich an Exzentrik nur einen üppigen lockigen Haarschopf, ungezähmt und schwarzbraun wie die schottischen Hochmoore. Die glatten, noch bartlosen Züge waren wohlgeformt, ja, perfekt, wie ein Puppenmacher ein Gesicht entwerfen würde, die Augen wie schwarze Kirschen, groß und ausdrucksstark unter markanten Brauen. Seine Verwandten nannten ihn sowohl wegen seines Aussehens wie seines düsteren Wesens Black Jack; er selbst bestand auf den Namen Iain Dhub – die gälische Form von Black Jack.
Merkwürdig war seine Stimme, die den Stimmbruch noch nicht durchgemacht hatte. Sie wechselte zuweilen wie die Pfeifen einer Orgel von einem hellen, noch knabenhaften Ton zu einem tieferen, der jedoch viel mehr Ähnlichkeit mit der rauen, lasziven und gleichzeitig unwiderstehlich lockenden Stimme eines in allen Lastern erfahrenen Weibes hatte als der eines jungen Mannes. So sprechen die Damen der Gesellschaft, die in ihrem Leben keine Sünde ausgelassen haben: kultiviert, gewählt und gleichzeitig schmierig.
Die Cunninghams, so reich sie waren, machten kein Hehl daraus, dass sie den Jungen als Kuckucksei betrachteten. Bekannt als strenge Katholiken, hatten sie ihn aus christlicher Nächstenliebe und der Familienehre halber aufnehmen müssen – einen Cunningham steckte man nicht ins Waisenhaus –, aber sie hatten ihn mit sechs Jahren in ein Internat an der englisch-schottischen Grenze geschickt. Er war kein liebenswürdiges Kind, sondern eines, das jeden wegstieß, der freundlich die Hand nach ihm ausstreckte. Dass seine Eltern gestorben waren, hatte er nie als Unfall verstehen können, sondern als eine von Gott gegen ihn persönlich gerichtete Gemeinheit, für die er den Herrn hasste. Und seine Eltern hasste er ebenfalls, weil sie einfach so zu Tode gestürzt waren, obwohl er sie doch gebraucht hätte. Und auch die Cunninghams hasste er zutiefst, ließen sie ihn doch deutlich spüren, dass sie keinen Wert auf ihn legten.
Gefallen an ihm gefunden hatte nur der greise Baron Clemens Cornelis de Rochay, ein schwerreicher Sonderling, der auf einem abgelegenen Gut namens Woolgrate im näheren Umkreis der Schule wohnte. Der pflegte ihn ab seinem dreizehnten Lebensjahr jeden Sommer in den langen Ferien einzuladen, oft auch zu Weihnachten (oder Yuletide, wie er es nannte).
Nun bin ich schon von Berufs wegen misstrauisch, wenn alte Männer attraktive junge Burschen so offensichtlich ans Herz drücken, aber ich muss gestehen, ich habe beiden Unrecht getan. Was sie verband, war das Dunkle, das Geheimnisvolle an Schottland, seine grause Mythologie mit ihren Wäsche waschenden Totenfeen, ihren hinterlistigen Kelpies und Mädchen entführenden Faeries und der ganzen verschrobenen Unterwelt, in die das Christentum noch kaum einen Lichtstrahl hineingesandt hatte.
Cornelis hatte eine Bibliothek voll ›ghostly tales und sinister stories of old Scotland‹, und das schien in den Ferien Iains einzige Lektüre zu sein.
Wollte Gott, er hätte sich mit dem Lesen begnügt!
†
Meine Leser mögen verzeihen, wenn ich nicht der chronischen Reihenfolge nach berichte, sondern eher nach einem inneren Zusammenhang. Daher schiebe ich hier den Brief ein, den der Rektor von Iains Internat mir auf mein Ersuchen hin zuschickte. Dem Rektor war mein Name ein Begriff, und er hatte keine Bedenken, einem angesehenen Arzt seinen eigenen Eindruck zu schildern, solange der Name des Verdächtigen nicht genannt wurde.
Er schrieb unter anderem:
»Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war der junge Herr X widerwärtig. Ich gestehe sogar ein, auch wenn es lächerlich klingen mag, dass er mir etwa ab seinem dreizehnten Lebensjahr, als er anfing, regelmäßig diesen sinisteren alten Bastard Cornelis de Rochay zu besuchen, unheimlich wurde. Wenn an meiner vieljährigen Erfahrung etwas dran ist, möchte ich ihn mit einer Schlange vergleichen, die Menschengestalt angenommen hat. Dabei schien er, flüchtig betrachtet, ein Glanzstück von einem Jungen zu sein. Sein Benehmen war weitgehend untadelig, und doch schien mir, dass er auf kleine Vergehen nur deshalb leichten Herzens verzichtete, weil er weitaus größere im Sinn hatte.
Seine Kommilitonen mochten ihn nicht, wagten aber nicht, dieser Abneigung Ausdruck zu geben. Dabei war er alles anderes als ein gewalttätiger ›Bully‹. Die ganze Zeit, während der ich ihn persönlich kannte, zeigte er sich als ein kultivierter, glatter, geschmeidiger, undurchsichtiger junger Mann, der jeglichen offenen Anstoß so geschickt vermied, wie ein gewiefter Verbrecher schon von weitem einem Polizeiagenten ausweicht.
Seine schulischen Leistungen waren immer beachtlich, seine Intelligenz höher als der Durchschnitt. Körperliche Strafen ertrug er mit der Härte eines abgebrühten Zuchthäuslers, obwohl ich zugeben muss, dass ich mich bei ihm mit dem Rohrstock mehr ins Zeug legte als bei so manchem Rabauken. Verbale Zurechtweisungen akzeptierte er mit einer Art feiner, eleganter Höflichkeit, die mich zum Zorn reizte, weil ein unerträglicher Unterton von Spott darin mitschwang. Übrigens log er bei jeder Gelegenheit, und zwar nicht etwa, um eine Strafe abzuwenden oder sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern offenbar nur, um nicht aus der Übung zu kommen! Wenn man ihn dann zur Rede stellte, gab er die Lüge meist unumwunden zu, aber in einer Art, als sei er eben aus einem Traum erwacht und wüsste nicht recht, was er getan hatte.
Ich beneide Sie nicht um die Aufgabe, ihn zum Patienten zu haben, worum immer es sich handeln mag bei seinen Beschwerden.«
Natürlich tat ich meiner Schweigepflicht als Arzt Genüge und ließ den Grund meiner Behandlung dem Schulleiter gegenüber unerwähnt. Im späten 19. Jahrhundert war ein Nervenarzt verantwortlich für alle möglichen, teils sehr verschwommenen medizinischen Arbeitsbereiche. Allgemein war mein Institut Sitwell Park bekannt als eine diskrete Sonderschule, in die man Jungen aus den höheren Ständen schickte, wenn sie stotterten, nicht lesen lernten oder sich als so ungeschlachte Tölpel erwiesen, dass man sie der Gesellschaft nicht vorstellen mochte. Die meisten waren geistig eher minderbegabt, zuweilen war Schwachsinn ihr einziger »Wahnsinn«.
Ich hatte insgesamt neunzehn Patienten, alles Jungen aus guter Familie, die an Sprachfehlern und Ticks litten, entweder nicht allein bleiben wollten oder sich vor jedem Kontakt fürchteten, und andere, die von brutalen Erziehern oder Eltern in eine solche Schockstarre hineingeprügelt worden waren, dass sie zu weinen begannen, wenn man sie nur anfassen wollte. Sie waren nicht gewalttätig und wurden höchstens sich selbst gefährlich durch ihr Ungeschick; etwa erwischte ich einen dabei, wie er Karamel-Brocken von der Spitze eines Rasiermessers ablutschte.
Iain Dhub Cunningham würde auf jeden Fall eine interessante Zutat zu dieser eher gleichförmigen Suppe sein.
Aber ich sollte doch lieber beim Anfang beginnen.
†
Der Anfang der Geschichte – ein paar Tage zuvor
»Man sagte uns, Sie seien ein Nervenarzt, der auch ungewöhnliche Fälle annimmt, selbst wenn es um schändliche und erschreckende Dinge geht.«
Die korpulente ältere Dame, die Dr. Baruch Löwelyn in seinem Edinburgher Sprechzimmer gegenübersaß, hatte eine groteske Ähnlichkeit mit einem Bukett leicht verstaubter künstlicher Rosen. Ihre Schneiderin hatte keine Gelegenheit ausgelassen, noch und noch ein paar seidene Rüschen an ihrem Kleid anzunähen, ob sie dorthin gehörten oder nicht. Sie roch aufdringlich nach einem aus der Mode gekommenen Parfüm. Ihr Gesicht war bleich wie roher Teig, ihre Mundwinkel waren herabgezogen – eine auf Dauer eingegrabene Grimasse von Jammer und Not.
Man sah ihr an, dass sie all ihre Kräfte zusammennehmen musste, um die Worte hervorzustoßen: »Wir waren immer eine fromme und anständige Familie. Der bloße Gedanke, dass sich Jack wirklich mit dem bösen Feind eingelassen hat ...«
Ihre Schwester, die eine ganz ähnliche Erscheinung war, allerdings viel schlanker und in Veilchenblau, wedelte ärgerlich mit dem Taschentuch, als könnte sie auf diese Weise die Worte vertreiben. »Nun lass einmal den Teufel aus dem Spiel, Maggie, du musst nicht immer blindlings nachplappern, was Pfarrer Jenkins von der Kanzel schwatzt. Der Mann hat mehr Aberglauben als Gottvertrauen, und obendrein trinkt er, das weißt du doch! Zwei Damen von der Armenfürsorge haben ihn erst kürzlich in einem sehr bedenklichen Zustand gesehen. Außerdem hat er ...«
Dr. Löwelyn räusperte sich diskret. Miss Victoria verstand. Sie wandte sich direkt an den Arzt.
»Lassen Sie mich erklären, von Margaret bekommen Sie doch nur Unsinn zu hören.«
Mit scharfer, kratzender Stimme, aber immerhin in verständlichen Sätzen, entwarf sie eine Skizze der Familie Cunningham, alteingesessene Edinburgher, die in den letzten drei Generationen durch eine Porzellanmanufaktur reich geworden waren. Margaret und Victoria waren Schwestern, Margaret verheiratet mit einem schweigsamen, in sich gekehrten Mann, der nach Victorias Schilderung mehr zum Inventar zählte, als dass er die Rolle eines Ehemanns einnahm. Arthur Cunningham, der zusammen mit seiner Frau Georgina zu Tode gekommen war, war ihr beider Bruder gewesen. Es gab noch einen zweiten Bruder, Jacks Onkel Howard, der ältere der Geschwister. Er leitete die Manufaktur und wurde offenbar allgemein als Oberhaupt der Familie anerkannt, die ein vornehmes Patrizierhaus nahe der Royal Mile bewohnte, gesellschaftlich angesehen war und als sittenstreng galt.
Von Jack/Iain, der erst vor Kurzem seine Ausbildung abgeschlossen hatte und in den Familienverband zurückgekehrt war, hatte der entferntere Bekanntenkreis der Familie noch keine Meinung, da man ihn selten sah. Er lebte sehr zurückgezogen in seinem Zimmer, las viel und machte keine Anstalten, einen Beruf zu erlernen oder sich zur Mitarbeit im Familienbetrieb anzubieten. Er wartete darauf, zu Geld zu kommen – durch eine Erbschaft.
Die Cunninghams hatten bereits gehofft, der Baron Cornelis würde den Jungen nach seinem Abgang aus dem Internat auf Dauer bei sich behalten, da er ihn bereits als seinen Erben eingesetzt hatte. Da versank dieser Adelige ganz plötzlich aufgrund eines Schocks oder Schlaganfalls in senile Demenz und wusste nicht einmal mehr, wer er war, geschweige denn dass er seinen zukünftigen Erben erkannte. Das war um die Sommersonnenwende des Jahres geschehen, und Jack, der zu alt fürs Internat geworden war, musste umgehend zurück in das Patrizierhaus in Edinburgh.
Aber mit jedem Tag wurde deutlicher, dass er ein unerwünschter Gast war, und schließlich hatte er der Familie echten Anlass zur Panik gegeben.
Dr. Löwelyn sondierte vorsichtig. »Und welche Schwierigkeiten macht Ihnen Jack nun?«
Zu seiner Überraschung platzte Margaret Pembroke, geborene Cunningham, heraus: »Er stinkt!«
Der Arzt verkniff sich ein Lächeln. Mit der Scharfsicht seines Berufes hatte er sofort bemerkt, dass hier etwas anderes gemeint war als mangelnde Sauberkeit – bei jungen Burschen kam es nun einmal häufig vor, dass sie in ihrer überbordenden Männlichkeit wie Böcke stanken. Er fragte daher in möglichst gleichmütigem Ton: »Stinkt? Wonach?«
Victoria mischte sich ein. »Das ist es, werter Herr Doktor, woraus wir nicht klug werden. In unserer Familie wird sehr auf Reinlichkeit und Sittsamkeit geachtet. Wir würden es niemals zulassen, dass er uns ungewaschen unter die Augen tritt. Ich weiß natürlich ...«, sie errötete und wandte den Blick ab, »dass bei Halbwüchsigen eine Neigung zu ... zu gewissen heimlichen Unanständigkeiten vorkommt, die dann einen Geruch hinterlassen, aber auch das ist es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll ... Es ist auch nicht direkt ein Geruch, den man mit der Nase wahrnimmt, sondern eine Aura der Widerwärtigkeit, wie man sie angesichts gewisser Tiere empfindet.« Erst zuletzt fand Victoria ganz unerwartet die richtigen Worte. »Es ist mehr ein Grauen als ein Grausen, der einem bei seinem Anblick befällt – verstehen Sie?«