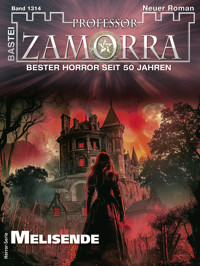1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
"Hörst du sie, Agenor, hörst du die Schreie, die vom Meer herüberwehen? Er hatte recht, und ihr hättet ihn nicht fortschicken dürfen. Ich habe dich immer gewarnt. Sie werden kommen, Agenor, sie werden kommen. Um uns zu holen."
Agenor presste die Lippen aufeinander. Trotz der milden Abendluft glänzte Schweiß auf seiner Stirn. Die Schreie waren nicht zu überhören. Sie überlagerten das Tosen der Wellen, das unaufhörliche Klatschen, mit dem sie sich am flachen Sandstrand brachen, und selbst das Heulen des Windes. Es waren Schreie, die von Verzweiflung kündeten, von unvorstellbarem Leid ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Schreie der Toten
Vorschau
Impressum
Die Schreie der Toten
von Michael Schauer
»Hörst du sie, Agenor, hörst du die Schreie, die vom Meer herüberwehen? Er hatte recht, und ihr hättet ihn nicht fortschicken dürfen. Ich habe dich immer gewarnt. Sie werden kommen, Agenor, sie werden kommen. Um uns zu holen.«
Agenor presste die Lippen aufeinander. Trotz der milden Abendluft glänzte Schweiß auf seiner Stirn. Die Schreie waren nicht zu überhören. Sie überlagerten das Tosen der Wellen, das unaufhörliche Klatschen, mit dem sie sich am flachen Sandstrand brachen, und selbst das Heulen des Windes. Es waren Schreie, die von Verzweiflung kündeten, von unvorstellbarem Leid ...
Eine Gänsehaut kroch über seine Arme, die feinen Härchen stellten sich auf. Doch er weigerte sich, seinen Fehler einzugestehen. Schon gar nicht vor der alten Frau. Wer hätte denn ahnen können, dass dieser Verrückte die Wahrheit gesprochen hatte?
Vielleicht waren die Schreie nur Einbildung. Ja, das musste es sein. Eine Sinnestäuschung, entstanden aus der Kakofonie des Sturms, des Meeresrauschens und des Regens, der bereits am Nachmittag eingesetzt hatte und seitdem keine Anstalten machte, auch nur ein wenig nachzulassen.
»Es ist eine Sinnestäuschung«, knurrte er und bedachte Despina mit einem herablassenden Blick, wie um zu bekräftigen, dass sie eine Närrin war, die sich alles nur einbildete. »Der Wind ist dafür verantwortlich. Der Wind und das Meer. Es ist wild heute Abend.«
Despina schüttelte den Kopf. Eine Träne glitzerte in ihrem Augenwinkel.
»Du irrst dich«, sagte sie leise. »Es sind die Schreie der Toten.«
†
Die Sonne hatte den Sand aufgeheizt, unter den nackten Füßen des Jungen schien er beinahe zu glühen. Er rannte, so schnell ihn seine Beine trugen, damit seine Sohlen so wenig wie möglich mit dem Sand und den Kieseln in Berührung kamen. Als er endlich das Meer erreichte, atmete er erleichtert auf. Das kühle Wasser umspielte seine Knöchel, unter seinem Gewicht sanken seine Füße ein Stück weit in den nassen Sand ein. Wie angenehm das war.
Eine Weile blieb er stehen und sah den sanften Wellen zu. Wind und See konnten an den Stränden von Kreta rau sein. So rau, dass die Rettungsschwimmer an den Hotelstränden die roten Flaggen hissten, das Zeichen für die Touristen, nicht ins Wasser zu gehen. Aber an diesem heißen Augusttag war es nahezu windstill, und das Meer blieb ruhig.
Der Junge setzte die Taucherbrille auf, die ihm seine Mutter Eleni vor zwei Wochen zu seinem neunten Geburtstag geschenkt hatte. Wie eigentlich alle Kreter liebte er das Meer. Mindestens einmal am Tag stürzte er sich in die Fluten und nahm ein ausgiebiges Bad, selbst im Winter, wenn die Wassertemperatur auf unter zwanzig Grad sank.
Und er liebte es zu tauchen, auch wenn es an dem schmalen Strandabschnitt, der an sein Heimatdorf Selaka grenzte, nicht allzu viel im Meer zu sehen gab. Da waren die ebenso mächtigen wie glitschigen Steinplatten, auf denen man leicht ausrutschen konnte, wenn man im flachen Wasser auf sie trat. Außerdem waren oft kleine Fische unterwegs, die in Ufernähe nach Nahrung suchten. Manchmal trieben Plastiktüten oder anderer Unrat vorbei, unerfreuliche Zeichen der Anwesenheit menschlicher Zivilisation. Er sammelte den Müll dann immer ein und brachte ihn an Land.
Die Welt unter Wasser faszinierte ihn, und die Brille, deren Gummifassung im Sonnenlicht blau leuchtete, würde ihm eine große Hilfe dabei sein, sie zu erkunden. Vielleicht würde er eines Tages Meeresbiologe werden. Er wusste, dass es diesen Beruf gab. Sein Vater hatte ihm davon erzählt. Doch dafür würde er sein Heimatdorf verlassen müssen, um an einer Universität zu studieren. Der Gedanke daran ließ ihm das Herz schwer werden, denn er liebte sein Dorf. Aber eben auch das Meer.
Bis dahin war noch viel Zeit, pflegte er sich in solchen Momenten zu trösten.
Der Junge machte fünf schnelle Schritte. Als er bis zur Hüfte im Wasser stand, stieß er sich ab und begann zu schwimmen. Wenn seine Arme eintauchten, spritzte Wasser auf, und er spürte den salzigen Geschmack auf seinen Lippen, während er immer weiter hinausschwamm.
Kurz hielt er inne, um einen Blick Richtung Strand zu werfen. Seine Mutter war nirgends zu sehen. Wenn sie hier auftauchte und bemerkte, wie weit draußen er war, würde sie ihn mit Sicherheit zurückrufen. Sie war stets so besorgt, wie es eine Mutter um ihr einziges Kind nur sein konnte. Sie beäugte seine Leidenschaft für das Meer mit einer gewissen Skepsis, obwohl es doch zum Leben eines Kreters gehörte wie die Olivenbäume, von denen es etwa zwanzig Millionen auf der Insel gab.
Der Junge wusste, dass es ihr nicht leichtgefallen war, ihm die Taucherbrille zu schenken, weil sie sich natürlich denken konnte, dass das seine Leidenschaft nur noch befeuern würde. Aber sie wollte auch, dass er glücklich war. Seit sein Vater im vergangenen Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen war, hatten sie nur noch einander.
Er war jetzt gut vierzig Meter vom Ufer entfernt. Das Meer, wusste er, hatte hier eine Tiefe von etwa drei Metern.
Weit genug für heute, dachte er, holte tief Luft und tauchte.
Sofort wurde die Welt um ihn herum stumm. Er ließ seine Blicke durch die grünblaue Unterwasserwelt schweifen. Links von ihm schwamm ein einzelner kleiner Fisch vorbei, musterte ihn kurz und setzte dann mit hektisch zuckender Schwanzflosse seinen Weg fort.
Wie er es genoss, eins mit dem Meer zu sein.
Was war das?
Aus dem Augenwinkel hatte er etwas erhascht. Etwas Großes. Er wandte den Kopf, und dann sah er es. Da war ein Schiff. Ein Schiff auf dem Meeresgrund. Der schlanke Rumpf mochte etwa zwanzig Meter lang sein. Der Mast war gebrochen, lag halb über der Reling und halb auf dem Meeresboden. Das Segel hatte er unter sich begraben. Der weiße Stoff wogte in der Strömung hin und her. Um das Schiff herum lagen einige längliche Gegenstände, die wie Ruder aussahen.
Die Luft wurde ihm knapp, und er tauchte auf. Gierig sog er den Sauerstoff in seine Lungen und dachte gleichzeitig nach. Das Schiff sah alt aus, sehr alt. Wie lange mochte es wohl schon dort unten liegen? Und wieso hatte es noch nie jemand entdeckt? Es gab in Selaka zwei Fischer, die jeden Tag rausfuhren. Hätte ihnen das Wrack nicht auffallen müssen? In dem klaren Wasser hätten sie zumindest die Umrisse sehen können.
Offenbar nicht.
Also war er der offizielle Entdecker.
Aufregung erfasste ihn. Er musste zurückschwimmen und es seiner Mutter erzählen.
Ob es da unten einen Schatz gab? Vielleicht handelte es sich um ein Piratenschiff.
Er hatte mal einen Film gesehen, in dem eine Gruppe Kinder beim Tauchen auf ein Schiffswrack gestoßen war, genau wie er jetzt. Der Laderaum war voll mit Münzen und Juwelen gewesen.
Der Wind strich über sein Haar, das nass an seinem Schädel klebte. Er war stärker geworden, und der Junge spürte, wie das Meer zunehmend in Bewegung geriet. Er musste zurück ans Ufer, bevor die Wellen zu hoch wurden. Zwar war er ein geübter Schwimmer, aber er wusste seine Kräfte einzuschätzen. Bei zu starkem Seegang würde das Meer ihn irgendwann an sich reißen und ihn immer weiter hinaustreiben.
Aber zuerst musste er nach dem Schatz sehen. Wenn er etwas fand, vielleicht eine Kette oder auch nur eine einzelne Münze, konnte er sie seiner Mutter zeigen und ihr beweisen, dass er sich seine Entdeckung nicht ausgedacht hatte. Neben seiner Leidenschaft für das Meer war seine ausgeprägte Fantasie etwas, das sie zunehmend zu beunruhigen schien, je älter er wurde. Sie sprach es nie aus, aber er ahnte, dass sie es lieber gesehen hätte, wenn er sich für ein Handwerk oder die Landwirtschaft begeistern würde.
Er holte noch einmal tief Luft und verschwand im nächsten Moment unter Wasser. Mit kräftigen Zügen schwamm er auf das Wrack zu. Als er direkt darüber schwebte, hielt er inne. Durch das Glas der Taucherbrille konnte er die Ruderbänke und das große Ruderblatt am Heck erkennen. Ein Fischschwarm schwamm an der Reling entlang. An einigen Stellen hatten sich Algen auf dem dunklen Holz abgesetzt. Wie lange ist es wohl her, dass Menschen über dieses Deck gelaufen sind, dachte er. Wer waren sie gewesen? Wohin hatten sie gewollt?
Das ist jetzt nicht wichtig, mahnte er sich. Er musste den Schatz finden. Tief in seinem Inneren hatte er beschlossen, dass sich einer an Bord befand. Es musste einfach so sein.
Er überlegte, ob er noch einmal Luft holen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Seine Lungen waren kräftig und geübt. Mit der verbliebenen Luft würde er auf jeden Fall näher heranschwimmen können, in der Hoffnung, irgendwo ein verräterisches Glitzern zu entdecken.
Da bemerkte er die Bewegung.
Unwillkürlich kniff er die Augen zusammen.
Ja, da war etwas. An der Stelle, an der sich der abgebrochene Mast befand. Eine Gestalt. Ein anderer Taucher? Jetzt trat sie einen Schritt zur Seite, sodass der Junge sie genau sehen konnte.
Eine eiskalte Hand schien sich um sein Herz zu legen.
Die Gestalt war so groß wie ein erwachsener Mann und trug ein zerschlissenes Gewand, das ihr bis knapp über die Knie reichte. Ihre Haut glänzte pechschwarz und hing teilweise in Fetzen von den Knochen. Auch das Gesicht hatte diese schwarze Farbe. Der Schädel war völlig kahl, die Augen waren weiß glühende Punkte.
Punkte, die sich direkt auf ihn gerichtet hatten.
Die Gestalt hob die Hand und zog dabei grauschwarze Schlieren hinter sich her. Kleine dunkle Partikel lösten sich von den Fingern und trudelten langsam dem Boden entgegen.
War das Asche?
Jetzt winkte ihm die Gestalt zu. Schaudernd bemerkte der Junge die Fingernägel, die sich zu langen Krallen ausgewachsen hatten. Sie öffnete den Mund und entblößte gelbliche Zähne. Es wirkte wie ein Lächeln, doch es lag keine Fröhlichkeit darin, eher eine Art erwartungsvolle Grausamkeit. Würde ein Hai lächeln, kurz bevor er sich auf seine Beute stürzte, dann würde es ein solches Lächeln sein.
Der Junge spürte förmlich den Hass, der ihm aus den weißen Augen entgegenströmte.
Nach oben. Er musste nach oben.
Er schwamm so schnell wie nie zuvor. Wie ein Pfeil durchstieß sein Kopf die Wasseroberfläche. Er nahm sich keine Zeit, tief Luft zu holen, sondern kraulte sofort los, dem Strand entgegen. Sein Herz hämmerte wie wild in seiner Brust. Bestimmt würde ihn jeden Augenblick eine kalte Hand am Knöchel packen und in die Tiefe zerren.
Endlich berührten seine Füße festen Grund. Die letzten drei Meter überwand er mit schnellen Schritten, wobei er um ein Haar auf den glitschigen Felsplatten ausgerutscht wäre. Als er den Strand erreicht hatte, rannte er los. Beinahe flog er über den Sand, die Hitze unter seinen Fußsohlen spürte er gar nicht mehr. Und während er dem Haus seiner Mutter entgegeneilte, breitete sich langsam ein schützender Mantel über seinem Bewusstsein aus.
†
»Komm herein, Despina, komm herein.«
Despina nickte Eleni aufmunternd zu. Der Blick der jungen Mutter flackerte. Furcht und Sorge lagen darin. Die geröteten Augen verrieten, dass sie geweint hatte. Ihr sonst so sorgfältig frisiertes, schulterlanges Haar war zerzaust, das Gesicht blass.
Eleni gab den Weg frei und ließ sie eintreten.
Sie war noch nie in Elenis Haus gewesen. Das Wohnzimmer war schlicht, aber sauber und ordentlich. Der Geruch von frischen Zitronen hing in der Luft. Eine kleine Burg aus Holz, vor deren Tor zwei bunt bemalte Ritter aus Zinn aufgestellt worden waren, erinnerte daran, dass hier ein neunjähriger Junge lebte.
»Wo ist er?«, fragte sie.
»In seinem Zimmer. Ich zeige es dir.«
Eleni ging voran. Despina verstärkte den Griff um das längliche Paket, das sie unter dem Arm trug, und folgte ihr. Sie traten durch eine blau gestrichene Tür und standen im Kinderzimmer. Despina sah als Erstes einen Schrank ohne Türen, in dem mit erkennbarer Sorgfalt Kleidung gestapelt worden war. Daneben stand ein einfaches Bett. Auf der mit einem weißen Laken bezogenen Matratze hockte ein nur mit einer kurzen Hose bekleideter Junge, der sie mit großen Augen ansah. Schweiß stand auf seiner Stirn. Als er sie erblickte, schlug er die Hände vors Gesicht.
Despina lächelte nachsichtig. Sie wusste, dass sie einen beunruhigenden Anblick für einen kleinen Jungen bot. Eine alte Frau, weit über die achtzig, der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, die Nase groß und knorpelig, die Augen wässrig, mit einem schwarzen Kopftuch, das sie mit einem dicken Knoten unter ihrem vorspringenden Kinn zusammengebunden hatte. Auf Janis musste sie wie eine Hexe aus dem Märchenbuch wirken.
Dabei hatte er heute sicher weit Schlimmeres gesehen.
Behutsam nahm sie auf dem Bett Platz, das Paket legte sie neben sich auf das Laken.
»Janis?«, sprach sie ihn leise an. »Janis, sieh mich an.«
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Janis, bitte«, schaltete sich Eleni ein. »Despina ist gekommen, um dir zu helfen.«
»Kann sie die Bilder wegnehmen?«, fragte der Junge mit dünner Stimme, ohne die Hände von den Augen zu nehmen.
»Was für Bilder siehst du, Janis?« Despinas Stimme klang sanft.
Jetzt zog er doch die Hände weg, aber nur ein Stück weit, bereit, seine Augen sofort wieder zu bedecken.
Als könnte dir das helfen, armer Junge, dachte Despina bedauernd.
»Der schwarze Mann«, antwortete er. Es war kaum ein Flüstern. Er sah Despina direkt an, doch seine Blicke waren auf etwas anderes gerichtet. Etwas, das sich nicht in diesem Zimmer befand. Sondern draußen im Meer.
Despina beugte sich vor. Er wich nicht zurück.
»Wie sah er aus, der schwarze Mann?«
Er beschrieb es ihr, und eine Gänsehaut lief ihr über den Körper. Sie kannte die Geschichte, oh ja, sie kannte sie gut. Sie wusste genau, was dort draußen lauerte. Aber sie hatte noch nie einen von ihnen gesehen, und sie war froh darüber.
Als Janis mit seinem Bericht geendet hatte, schweifte sein Blick wieder in die Unendlichkeit ab. Despina bemerkte aus den Augenwinkeln, dass Eleni ihre Hände so fest ineinander verknotet hatte, dass ihre Knöchel weiß zwischen ihren Fingern hervortraten.
»Janis, ich möchte dir noch eine Frage stellen«, wandte sie sich erneut an den Jungen. »War da irgendwo ein Ring? Und hast du ihn an dich genommen?«
Der Junge antwortete nicht, stattdessen begann er zu flüstern. Despina spitzte die Ohren, aber es waren zusammenhanglose Worte, die keinen Sinn ergaben. Schweißtropfen liefen von seiner Stirn herab, sein Oberkörper glänzte vor Schweiß. Despina legte ihm eine Hand auf die Stirn. Sie erwartete, glühendes Fieber zu spüren, doch seine Haut war eiskalt.
»So geht das, seit er nach Hause gekommen ist«, schluchzte Eleni. »Manchmal ist er klar, dann wiederum murmelt er sinnloses Zeug vor sich hin und schwitzt dabei.«
Als ob ihn von innen ein Feuer verzehren würde, dachte Despina. Und etwas in dieser Art war es wahrscheinlich auch. Ein Feuer, das in seiner Seele brannte und nie wieder erlöschen würde.
Sie packte sein Handgelenk und drückte schmerzhaft zu. »Janis«, rief sie in scharfem Ton.
Er verstummte und sah sie erstaunt an, als wäre er gerade aus einem Traum erwacht. Sie musste sich beeilen. Jeden Moment konnte er erneut in diese schreckliche Welt abdriften. Vielleicht würde sie ihn nicht noch einmal zurückholen können. Zumindest nicht heute.
»Janis, war da ein Ring?«
Wieder schüttelte er den Kopf. »Nein«, hauchte er.
»Das ist gut«, versicherte sie ihm. »Das ist sehr gut. Dann werden sie nicht kommen. Du bist in Sicherheit. Wir alle sind in Sicherheit.«
Der Junge ließ seinen Oberkörper nach vorne kippen, stützte sich auf den Händen ab, schob sein Gesicht ganz nah an ihr Ohr. Sie konnte den trocknenden Schweiß auf seiner Haut riechen. »Aber irgendwann werden sie kommen, oder?«, flüsterte er.
»Vielleicht«, flüsterte sie zurück. »Über der Zukunft liegt ein Nebel, den niemand durchdringen kann. Aber ich habe etwas für dich, womit du dich wehren kannst, wenn es so weit sein wird.«
Sie griff nach dem Paket, öffnete den Knoten der Schnur, die das Ölpapier zusammenhielt, und zog einen länglichen Gegenstand hervor. Es war ein Schwert, eine Kopis. Sie war etwas länger als der Arm eines erwachsenen Mannes. Die Klinge war leicht gekrümmt und wurde zu ihrem Ende hin breiter. Einst war sie eine gefürchtete Hiebwaffe gewesen, dazu geeignet, den Schild eines Feindes mit einem einzigen Schlag zu zerschmettern. Dieses Schwert war alt, sehr alt. Unzählige Furchen und Scharten verunzierten den matt gewordenen Stahl. Einst mochte Holz oder Horn den Griff umschlossen haben, doch nun war da nur noch blankes Metall.
Eleni stieß einen erstickten Aufschrei aus. »Despina, was ist das?«
»Schweig«, zischte sie, schärfer, als sie es beabsichtigt hatte. Dann wandte sie sich wieder an Janis. »Dies ist das Schwert eines Mannes, der sich Zenon nannte. Fass es ruhig an.«
Mit zwei Fingern berührte Janis vorsichtig die Waffe, fuhr an der Kante entlang, die rissig, aber immer noch scharf war. Seine Züge entspannten sich etwas, und für eine Sekunde umspielte ein Lächeln seine Lippen. Dann wurde sein Blick wieder stumpf, und er begann erneut vor sich hin zu murmeln. Er kroch von Despina zurück, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand und starrte ins Leere.
Despina erhob sich. Das Schwert ließ sie neben dem Jungen auf dem Bett liegen.
Eleni trat einen Schritt auf sie zu. »Was ist mit ihm? Kannst du ihn heilen?«
Traurig schüttelte sie den Kopf. »Nein. Er hat etwas gesehen, was ein Kind niemals sehen sollte. Dieses Bild hat von seinem Geist Besitz ergriffen und schließt ihn von der Außenwelt ab wie ein Mantel, der sich nur ab und an lüftet.«
»Aber was hat er gesehen?«
»Du hast doch gehört, wie er es mir beschrieben hat. Ein Wesen aus einer anderen Welt. Es war Illias. Oder einer seiner Männer.«
»Aber das sind doch nur Geschichten. Das ...«
Despina legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Sieh dir deinen Sohn an, Eleni, und sag mir, ob es nur Geschichten sind. Ich glaube, mit den Jahren wird sich sein Zustand bessern, aber er wird nie wieder ganz der Alte sein.«
»Mit den Jahren?« Elenis Augen wurden feucht.