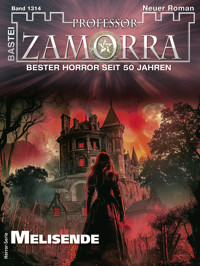1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der alte Mann packte die Hand des Jungen fester. "Rowan", sagte er mit brüchiger Stimme. "Hörst du die Hufschläge?"
"Ja, Großvater", antwortete der Junge.
"Sag mir, was du siehst."
"Ich sehe Nebel. Plötzlich ist er zwischen den Bäumen aufgezogen. Ein seltsamer Nebel ist das, er ist ganz rot"
"Aber die Hufschläge. Irgendwo müssen Reiter unterwegs sein."
"Ja, da sind sie."
Wie vom Blitz gefällt ging der Alte in die Hocke und zog den Jungen mit sich. Seine Knochen schmerzten protestierend bei der schnellen Bewegung. "Haben sie uns entdeckt?", flüsterte er.
"Nein, Großvater. Sie reiten an uns vorbei."
"Wie sehen sie aus? Beschreib sie mir."
"Sie tragen lange, schwarze Umhänge mit Kapuzen, die ihre Gesichter verdecken."
"Bei den Göttern", murmelte der Alte. "Die Nebelreiter sind zurückgekehrt!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Angriff der Nebelreiter
Vorschau
Impressum
Angriff der Nebelreiter
von Michael Schauer
Der alte Mann packte die Hand des Jungen fester. »Rowan«, sagte er mit brüchiger Stimme. »Hörst du die Hufschläge? Sag mir, was du siehst.«
»Ich sehe Nebel, Großvater. Plötzlich ist er zwischen den Bäumen aufgezogen. Ein seltsamer Nebel ist das, er ist ganz rot.«
Der Alte erschauerte und kniff die Augen zusammen. Sein Blick war getrübt. Seit drei Sommern sah er in der Ferne alles nur noch verschwommen. »Aber die Hufschläge. Irgendwo müssen Reiter unterwegs sein.«
»Ja, da sind sie.«
Wie vom Blitz gefällt ging der Alte in die Hocke und zog den Jungen mit sich. Seine Knochen schmerzten protestierend bei der schnellen Bewegung. »Haben sie uns entdeckt?«, flüsterte er.
»Nein, Großvater. Sie reiten an uns vorbei.«
»Wie sehen sie aus? Beschreib sie mir.«
»Sie tragen lange, schwarze Umhänge mit Kapuzen, die ihre Gesichter verdecken.«
»Bei den Göttern«, murmelte der Alte. »Die Nebelreiter sind zurückgekehrt!«
Britannien, 63 n. Chr.
Missmutig kauerte Kellan im Unterholz. In der rechten Hand hielt er seinen Jagdspeer, mit der linken drückte er das Blattwerk beiseite, um einen besseren Blick auf die Lichtung zu haben.
Wo steckte dieser verfluchte Hirsch?
Wie lange war es her, dass er das Tier das erste Mal gesichtet hatte? Kellan kam es wie eine Ewigkeit vor. Anfangs hatte er es mit der Geduld eines Jägers verfolgt, doch allmählich beschlich ihn das Gefühl, dass der Hirsch ihn zum Narren halten wollte.
Kaum hatte er sich in eine günstige Position gebracht und sich zum Wurf bereit gemacht, da sprengte er mit weiten Sätzen davon. Dreimal war das jetzt passiert, und Kellan war schon kurz davor gewesen, aufzugeben. Der Hirsch war groß und stark. Ihn zu erlegen bedeutete, den Leuten in Dumriga, seinem Dorf, einen großen Vorrat an Fleisch zu sichern.
Während er regungslos auf die Lichtung starrte, als könne er das Tier allein dadurch zum Auftauchen bewegen, schweiften seine Gedanken zurück zur großen Schlacht. Die Erinnerungen quälten ihn stets aufs Neue, trotzdem konnte er nicht verhindern, dass sie Tag für Tag wiederkehrten.
Zwei Jahre war es nun her, seit er sich mit seinen drei besten Freunden und seinem Onkel der Herrscherin Boudicca angeschlossen hatte. Sie waren jung gewesen, er mit seinen damals einundzwanzig Jahren war der Jüngste unter den Fünfen. Mit Zehntausenden Kriegern waren sie losmarschiert, um die verhassten Römer ein für alle Mal aus ihrem Land zu vertreiben. Sie alle waren dazu bereit gewesen, für die Freiheit ihres Volkes ihr Leben zu geben.
Anfangs war alles nach Plan gelaufen. Zuerst hatten sie die römische Stadt Camulodunum bis auf die Grundmauern niedergebrannt, danach waren sie über Londinium und Verulamium hergefallen. Nichts und niemand hatte sie aufhalten können.
So hatten sie jedenfalls geglaubt.
Bis sie nordwestlich von Verulamium auf die Legionen gestoßen waren. Eine gewaltige Schlacht hatte begonnen, und zunächst hatte es so ausgesehen, als seien sie den Legionären überlegen. Eine Täuschung. Am Ende hatten die Römer sie vernichtend geschlagen. Über achtzigtausend Britannier waren an diesem Tag gestorben, und über dem Schlachtfeld hatte sich ein Meer aus Blut ergossen. Es war das Ende von Boudiccas Aufstand gewesen.
Als er mit den anderen Männern geflohen war, hatte er sie kurz aus der Nähe gesehen. Für eine Frau war sie sehr groß gewesen, das blonde Haar hatte ihr bis zu den Hüften gereicht, um ihre Schultern hatte ein dicker brauner Mantel gelegen. Ihr Blick war auf die anstürmenden Römer gerichtet gewesen. Verzweiflung und Traurigkeit, aber auch Trotz hatte er darin gesehen. Kurz darauf, so wurde ihm später erzählt, hatte Boudicca sich mit Gift das Leben genommen.
Als Einziger aus ihrer kleinen Schar war er einige Tage danach nach Dumriga zurückgekehrt. Seine Freunde und sein Onkel hatten bei dem Kampf ihr Leben gelassen. Die vier Menschen, die ihm so viel bedeuteten, waren von den Kurzschwertern der Invasoren niedergemetzelt worden.
Als sie an jenem Tag bemerkt hatten, dass die Legionäre die Oberhand gewannen, hatte Angst und Schrecken die Britannier erfasst. Kellan und seine Gefährten waren von dem Strom der Fliehenden mitgerissen worden. Er hatte gesehen, wie ein Römer seinem Onkel ein Schwert in den Hals gerammt hatte, dann hatte er sie aus den Augen verloren.
Er hatte die Toten nicht einmal mit nach Hause nehmen können. Vermutlich lagen ihre Gebeine immer noch dort.
Seitdem war sein Hass auf die Römer noch stärker geworden.
Das Militärlager Deva Victrix lag nur eine Meile von Dumriga entfernt. In seinen Tagträumen drang Kellan in das Lager ein, schwang eine riesige Kriegsaxt und tötete einen Legionär nach dem anderen, schlug ihnen die Köpfe ab, trieb ihnen die scharfe Klinge in die Brust, dass das Blut nur so spritzte. Am Ende hatte er sie alle ausgelöscht.
Das war eben nur ein Traum. Wie viele würde er in Wahrheit töten können, bevor sie ihn niedermachten? Zwei? Drei? Damit wäre nichts gewonnen. Nein, er würde warten. Irgendwann würde bestimmt ein anderer Anführer kommen und sie erneut zu den Waffen rufen. Dann würde er folgen.
Zum Leidwesen seines Vaters.
Kellan schürzte die Lippen. Pirmin war in ihrem Dorf der Mann, auf den alle hörten, die Bewohner schätzten seine Weisheit und sein besonnenes Handeln. Er hatte es nicht gutgeheißen, dass sein Sohn mit den anderen in den Krieg gezogen war.
Tatsächlich hatte Pirmin sich mit den Römern arrangiert. Ja, er pflegte Beziehungen zu ihnen, die man beinahe freundschaftlich nennen konnte. Auf der Insel gab es einige Stämme, die prorömisch eingestellt waren.
Die Ordovicer, denen sie angehörten, zählten nicht dazu. Pirmin scherte das nicht. Für ihn waren einzig und allein die Menschen in Dumriga wichtig, und er war davon überzeugt, dass sein Weg für alle der beste war.
Kellan liebte seinen Vater. Gleichzeitig verachtete er ihn dafür, dass er mit den Besatzern paktierte.
Das knackende Geräusch eines brechenden Zweigs riss ihn aus seinen Gedanken. Blätter raschelten. Im Unterholz entdeckte er einen Schatten.
Der Hirsch!
Gemächlich trabte er auf die Lichtung. Dann senkte er den Kopf mit dem mächtigen Geweih und tat sich an ein paar auf dem Waldboden zerstreuten Eicheln gütlich.
Kellan wagte kaum zu atmen. Noch einmal durfte er ihm nicht entwischen. Langsam und vorsichtig kam er auf die Beine, achtete darauf, nicht das Unterholz zu berühren. Das leiseste Geräusch würde das Tier vertreiben.
Als er aufrecht stand, hob er den Speer.
Langsam.
Der Hirsch blickte auf, starrte in seine Richtung.
Kellan holte aus.
Schnell wie ein Pfeil schoss das Tier ins Unterholz und war im nächsten Augenblick verschwunden.
Ein stummer Fluch kam über seine Lippen. So nahe dran, und schon wieder entwischt. Mit vor Enttäuschung gesenktem Haupt überlegte er, ob er die Verfolgung abbrechen sollte. Die Sonne schickte sich bereits an, hinter den Bäumen zu verschwinden, bald würde es dunkel werden. In der Finsternis konnte er die Jagd unmöglich fortsetzen. Das Moor war nicht weit entfernt. Ein Fehltritt, und er würde buchstäblich vom Erdboden verschluckt werden.
Er musste sich wohl damit abfinden, ohne Beute ins Dorf zurückzukehren. Der Gedanke schmerzte beinahe körperlich.
Gerade wollte er sich abwenden, als erneut das Knacken eines Zweigs an seine Ohren drang. Unwillkürlich packte er den Speer fester. Kehrte der Hirsch zurück? Nein, das war natürlich Unsinn, wieso sollte er das tun? Mit seinen Blicken versuchte Kellan das Unterholz zu durchdringen.
Eine Gestalt löste sich aus den Schatten und trat auf die Lichtung. Augenblicklich lief es ihm kalt den Rücken hinunter.
Der Mann war groß und von hagerer Gestalt. Über einem schlichten schwarzen Gewand trug er einen Mantel in derselben Farbe, der ihm bis zu den Knöcheln reichte. Lange, eisgraue Haare fielen ihm über die knöchernen Schultern. Seine Fingernägel waren so lang wie Pfeilspitzen. Das Gesicht war schmal, und trotz der vielen Falten waren die scharf geschnittenen Züge erkennbar. Die Augen, die wie kleine Kohlestücke in ihren Höhlen lagen, bildeten einen starken Kontrast zu der unnatürlichen Blässe seiner Haut. Als er ihn anlächelte, bemerkte Kellan zwei Reihen spitz gefeilter Zähne.
Er wusste sofort, wen er da vor sich hatte. Einen Druiden.
Wie jeder Britannier hatte er schon viel über die Druiden gehört. Kaum eine Meile von Dumriga entfernt und nur durch einen schmalen Kanal von der Küste getrennt, lebten sie auf einer Insel namens Mona. Sie standen in dem Ruf, mit dunklen Mächten zu paktieren und schreckliche Rituale durchzuführen. Dennoch hätte niemand es gewagt, ihren Status als spirituelle Führer der Stämme infrage zu stellen. Die Druiden galten als Priester und Astrologen, Gelehrte und Magier – und sie waren unerbittliche Gegner der Römer, von denen sie ebenso gefürchtet wurden wie von vielen Britanniern. In der Schlacht verstanden sie es, die Krieger anzustacheln und ihnen Mut einzuflößen.
Noch nie hatte Kellan einem von ihnen gegenübergestanden. Bei Boudiccas verheerender Niederlage waren sie dabei gewesen, er hatte aus der Ferne kleine Gruppen von ihnen beobachtet. An diesem Tag hatten jedoch selbst sie nichts ausrichten können.
»Ich grüße dich, Kellan«, ergriff der Druide das Wort. Seine Stimme klang, als würde jemand mit einer Handvoll Kieselsteine über einen Felsen kratzen.
Seine Augen weiteten sich vor Überraschung. Woher kannte er seinen Namen?
Als hätte der Druide seine Gedanken gelesen, wurde sein Lächeln breiter. Kellan glaubte, in das Maul eines Wolfs zu blicken.
»Weißt du nicht, wer ich bin?«
»Du ... du bist ein Druide«, stotterte er. Eigentlich hatte er eine kräftige und volltönende Stimme. Jetzt kam kaum mehr als ein Flüstern über seine Lippen.
»So ist es, ich bin ein Druide. Und wir Druiden wissen alles, nicht wahr?«
Kellan nickte hastig.
»Mein Name ist Marton. Ich bin gekommen, weil ich dir etwas anzubieten habe.«
Er wagte sich kaum zu rühren. Die unnatürlich schwarzen Augen des Druiden schienen sich direkt in seine Seele zu brennen. Was für ein Angebot konnte das sein? Und welche Gegenleistung wurde von ihm erwartet?
Marton trat einen Schritt auf ihn zu. Blätter und Reisig raschelten unter seinen Stiefelsohlen.
»In deinem Herzen lodert wilder Hass wie ein riesiges Feuer, mein Freund. Ich kann ihn beinahe mit Händen greifen, diesen Hass. Dich dürstet es danach, Römer zu töten, nicht wahr? Du möchtest Rache nehmen für deine Freunde und für deinen Onkel.«
Kellan fragte nicht nach, woher Marton von seinen früheren Gefährten wusste. Wie er selbst gesagt hatte, Druiden wussten alles.
»Ja, es stimmt«, antwortete er mit diesmal festerer Stimme. »Aber ich möchte sie nicht nur töten. Ich will sie für immer aus unserem Land vertreiben, sie mit Feuer und Schwert ins Meer zurückdrängen, auf dass sie niemals zurückkehren.«
Der Druide lachte leise. »Ja, das möchtest du tun, und das gefällt mir. Leider gibt es nicht mehr viele Männer wie dich. Seit Boudicca gefallen ist, verharren die meisten Stämme in Angst. Rom hat ihnen ihre Macht gezeigt, und nun verbringen sie die Zeit damit, ihre Wunden zu lecken, statt ein neues Heer aufzustellen. Selbst einige meiner Brüder beginnen am Sinn ihres Kampfs zu zweifeln. Fraglos sind dies dunkle Zeiten für unser Land.«
»Wir dürfen niemals aufgeben«, platzte es aus ihm heraus.
Marton nickte und sah dabei sehr zufrieden aus. »So spricht ein wahrer Krieger. Wer weiß, vielleicht bist du es, der die Stämme eines Tages hinter sich vereinen wird.«
Ein plötzliches Schwindelgefühl erfasste ihn. Diese Vorstellung wäre ihm noch vor wenigen Herzschlägen vollkommen abwegig vorgekommen. Er war nur ein unbedeutender junger Mann aus einem abgelegenen kleinen Dorf. Nachdem der Druide es ausgesprochen hatte, schien es ihm plötzlich vorstellbar. Vor seinem geistigen Auge erschien ein Bild, wie er Boudicca gleich in einem prächtigen Streitwagen eine Armee aus zu allem entschlossenen Britanniern anführte.
»Bis dahin ist es noch ein weiter Weg«, fuhr der Druide fort, was seine Tagträume zerplatzen ließ. »Ich aber kann dir helfen, den ersten Schritt zu tun. Sag mir, junger Freund, kennst du die Legende von Nara und ihren Nebelreitern?«
Kellan runzelte die Stirn. Davon hatte er noch nie gehört. »Nein«, antwortete er.
Der Druide legte den Kopf schief. »Man redet in deinem Dorf wohl nicht gerne über die alten Geschichten. Am heutigen Tag ist es genau hundert Jahre her, seit sie im Moor verschwanden, in einem Gefängnis aus Dunkelheit. Seitdem warten sie darauf, zurückgeholt zu werden. Dazu braucht es einen Mann, der großen Mut in seinem Herzen trägt und sich durch nichts und niemanden von seinem Pfad abbringen lässt, wenn er ihn einmal eingeschlagen hat. Ich glaube, du bist dieser Mann. Deshalb biete ich dir diese Chance. Ergreife sie und lasse sie nicht zwischen deinen Fingern zerrinnen, denn sonst müssen erneut hundert Jahre vergehen, bevor das Tor sich öffnet und Nara und die Reiter entkommen können.«
»Aber ... was sind sie? Und was werden sie tun?«
In den Augen des Druiden glommen zwei helle Punkte auf. Ein gespenstischer Anblick, der Kellan frösteln ließ. »Die Nebelreiter sind es, die dir dabei helfen werden, die Römer zu erschlagen und die Überlebenden fortzujagen, so wie du es dir ersehnst. Es sind sechs an der Zahl, und sie reiten auf mächtigen Rössern, aus deren Nüstern Flammen schlagen. Sie werden niemals müde und kennen keine Furcht. Nara befiehlt ihnen. Sie ist eine Hexe.«
Unwillkürlich trat Kellan einen Schritt zurück. Eine Hexe? Er hatte von diesen Wesen gehört. Angeblich verfügten sie über außergewöhnliche Kräfte und waren das personifizierte Böse.
»Ich sehe, dass du Angst hast«, stellte Marton in einem gelassenen Tonfall fest. »Dafür gibt es keinen Grund. Vertraue mir.«
»Verzeih, Marton, aber wieso kannst du sie nicht selbst aus dem Moor befreien?«
Die Miene des Druiden verfinsterte sich, und Kellan bereute seine Worte augenblicklich. Dann lächelte er wieder. »Du hast recht, wir sollten offen miteinander sein. Ich habe Nara einst zu dem gemacht, was sie jetzt ist, doch meine Macht ist begrenzt, deshalb brauche ich für mein Vorhaben einen Verbündeten. Ich bin nur ein demütiger Diener der Finsteren, der auf Erden wandelt.«
»Der Finsteren?«
»Mächtige Wesen aus einer anderen, fernen Welt. Eines Tages werde ich dir alles über sie erzählen und dich in ihre Geheimnisse einweihen. Aber nicht heute, denn wir haben nicht mehr viel Zeit, der Tag neigt sich bereits seinem Ende zu. Etwas musst du noch wissen, Kellan. Damit die Nebelreiter zurückkehren können, wird Dumriga ein Opfer bringen müssen.«
Kellan hörte zu, als Marton ihm das Opfer beschrieb. In seinem Inneren begann ein heftiger Kampf zu toben. Erst widerstrebte es ihm, sich darauf einzulassen, Dann dachte er an seine Freunde und an seinen Onkel. An die achtzigtausend Britannier, die gefallen waren. Und an sein Volk, das unter dem Joch der Römer geknechtet wurde.
Er traf seine Entscheidung.
Kurz darauf folgte er Marton in Richtung Moor.
†
Tullius Malfus brummte unwillig. Der Regen prasselte so heftig auf seinen Helm, dass es ihm vorkam, als würde jemand unaufhörlich mit Stöcken gegen das Metall schlagen. Obwohl er ihn gut eingefettet hatte, war sein roter Mantel durchnässt und klebte ihm förmlich am Körper.
Wenn er in eine Pfütze trat, spritzte unter den genagelten Sohlen seiner Legionärsstiefel schlammbraunes Wasser auf. Das platschende Geräusch verfolgte ihn, denn auf diesem von den Göttern verlassenen Pfad gab es inzwischen so viele Pfützen, dass es ihm beinahe vorkam, als wate er durch einen Bach.
Hinter sich hörte er die Schritte der sechs Legionäre, die ihm im Gänsemarsch folgten. Von ihren sonst üblichen Frotzeleien war nichts zu hören, sie marschierten schweigend. Vermutlich war ihre Laune ebenso auf dem Tiefpunkt wie die seine.
Zum vielleicht tausendsten Mal fragte er sich, womit er es verdient hatte, ausgerechnet in Britannien zu landen. Es gab weitaus angenehmere Orte im Reich, an denen er mit Freuden seine Knochen für Rom hingehalten hätte. Zu den vielerorts feindseligen Einwohnern kam das ewig schlechte Wetter hinzu, was ihn zunehmend zermürbte. Bald würde es Herbst werden, wobei das eigentlich kaum einen Unterschied machte. Im Sommer war der Regen lediglich ein wenig wärmer.
Er konnte es kaum erwarten, die Patrouille zu beenden und nach Deva Victrix zurückzukehren. Im Lager würde er sich trocknen und aufwärmen, danach hatte er dienstfrei. Den Abend würde er in der allseits beliebten Taverne »Zum geschlachteten Eber« vor den Toren des Legionärslagers verbringen. Wie er gehört hatte, gab es dort eine neue Hure, die auf den Namen Briana hörte. Man erzählte sich, sie würde ihrem Beruf mit außergewöhnlicher Leidenschaft nachgehen. Das wollte er ausprobieren.
»Herr!«, sprach ihn jemand in seinem Rücken an. An der näselnden Stimme erkannte er Otho.
Tullius wandte den Kopf, ohne sein Tempo zu verlangsamen. »Was gibt es, Otho?«
»Da ist Nebel, Herr.«
Tullius zog seine buschigen Brauen zusammen. Was war los mit dem Mann? Nebel schien wie der Regen allgegenwärtig auf der Insel zu sein, auch wenn in der Regel nicht beides gemeinsam auftrat.
Er blieb stehen, drehte sich um und stemmte die Hände in die Hüften. Die Männer stoppten augenblicklich, nur Otho, der hinter ihm an der Spitze der Kolonne schritt, wäre beinahe in ihn hineingerannt.
»Nebel, ha?«, blaffte er. »Das ist mal eine außergewöhnliche Entdeckung, Otho, natürlich musst du darüber Meldung machen. Denk daran, mich darauf aufmerksam zu machen, wenn du die Sonne am Himmel siehst. Beim Jupiter, hast du heute schon zu tief in den Weinbecher geschaut?«
Otho verzog keine Miene. »Der Nebel ist rot, Herr.«
Sein ausgestreckter Arm zeigte nach rechts. Tullius' Blick folgte seinem Zeigefinger. Einige Schritte von dem Pfad entfernt erstreckte sich ein Hain. Zwischen den Bäumen quoll dichter Nebel hervor. Und er war tatsächlich rot. Blutrot.
Stirnrunzelnd machte Tullius einen Schritt auf den Hain zu. Abgesehen von der Farbe kam ihm dieser Nebel auch ansonsten ungewöhnlich vor. Die Schwaden reichten bis knapp zu den Baumwipfeln, darüber wurde die Sicht wieder klar, wenn man von dem Regen absah, der einen feuchten Schleier bildete. Außerdem schien er sich trotz der Windstille zu bewegen.
Ja, kein Zweifel, der Nebel kam auf sie zu.
Er sah zu seinen Männern. Alle sechs starrten in Richtung Hain. Auf ihren Gesichtern lag ein ebenso misstrauischer wie angespannter Ausdruck.