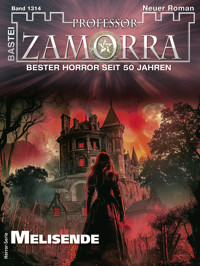1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Seit Jahren hatte niemand diesen Platz betreten.
Er lag irgendwo in einem vergessenen Teil der Stadt, umsäumt von mannshohen Mauern und nur durch ein schmales Tor zugänglich. Eine unheimliche Stille lag über dem Hof. Nicht einmal die Vögel wagten es, hier zu landen, um eine Rast einzulegen oder nach Futter zu suchen.
Bis auf die Statue war er leer.
Sie stand vor der Mauer gegenüber dem Tor, sodass jeder, der durch die Öffnung ging, sie sogleich sehen musste. Sie bestand aus schwarz glänzendem Stein und stellte einen jungen Mann dar. Er war durchschnittlich groß und von schlanker Gestalt, das Gesicht ebenmäßig, mit scharf geschnittenen Zügen, die Augen waren auf einen Punkt in der Unendlichkeit gerichtet. Er trug ein schlichtes Gewand, das ihm bis knapp über die Knie reichte, und einfache Sandalen. Seine Arme hatte er erhoben, die Finger waren zu Klauen gespreizt.
Er war das Böse ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Medusas Sohn
Special
Vorschau
Impressum
Medusas Sohn
von Michael Schauer
Seit Jahren hatte niemand diesen Platz betreten.
Er lag irgendwo in einem vergessenen Teil der Stadt, umsäumt von mannshohen Mauern und nur durch ein schmales Tor zugänglich. Seine Form war viereckig, und an jeder Seite maß er kaum zwanzig Fuß. Auf der trockenen Erde sprossen nur hier und da einige Büschel Grashalme. Eine unheimliche Stille lag über dem Hof. Nicht einmal die Vögel wagten es, hier zu landen, um eine Rast einzulegen oder nach Futter zu suchen.
Bis auf die Statue war er leer.
Sie stand vor der Mauer gegenüber dem Tor, sodass jeder, der durch die Öffnung ging, sie sogleich sehen musste. Sie bestand aus schwarz glänzendem Stein und stellte einen jungen Mann dar. Er war durchschnittlich groß und von schlanker Gestalt, das Gesicht ebenmäßig, mit scharf geschnittenen Zügen, die Augen waren auf einen Punkt in der Unendlichkeit gerichtet. Er trug ein schlichtes Gewand, das ihm bis knapp über die Knie reichte, und einfache Sandalen. Seine Arme hatte er erhoben, die Finger waren zu Klauen gespreizt.
Er war das Böse ...
Rom, 63 n. Chr.
Von ihren Ordensschwestern abgesehen, war Eunika auf ihrer langen Reise meist allein gewesen. Vielleicht machten sie die Hunderten von Menschen, die in Richtung des Stadttors strömten, deshalb so nervös.
Stimmengewirr lag in der Luft, Wortfetzen aus verschiedenen Sprachen, die sie allesamt nicht kannte, drangen an ihre Ohren. Ein Mann rempelte sie an, als er sie mit schnellen Schritten überholte. Ohne sie auch nur zu beachten, hastete er davon. Sie verzichtete darauf, ihm eine Verwünschung hinterherzuschicken. Mit einem empörten Schnauben schlug sie die Kapuze ihres dunkelbraunen Mantels zurück, um besser sehen zu können.
Vor ihr erhob sich Rom. Die Stadt, die als das Zentrum der Welt galt. Die Heimat der mächtigen Römer, die über alles und jeden zu herrschen schienen und die so viele Völker unterworfen hatten – auch das griechische, dem sie angehörte.
Sie hatte viel von Rom gehört, doch nichts davon hatte sie darauf vorbereiten können, es in der Wirklichkeit zu sehen. Schon die mächtigen Stadtmauern wirkten einzigartig und waren mit nichts zu vergleichen, was sie kannte. Beinahe verspürte sie einen Anflug von Demut gegenüber diesen Römern, die dazu imstande waren, etwas Derartiges zu erschaffen.
Mit einem Blick über die Schulter stellte sie fest, dass es ihren Schwestern ähnlich ging. Wie gebannt starrten sie auf die Mauern und schienen gar nicht zu merken, dass ihre Anführerin sie musterte.
Sie waren zu fünft, und Eunika als ihre Anführerin war mit ihren beinahe vierzig Jahren die Älteste von ihnen. In den Augen von Zoe, keine zwanzig Sommer alt und damit die Jüngste, lag ein aufgeregter Glanz, was ihr irgendwie missfiel. Zum wiederholten Male fragte sie sich, ob es richtig gewesen war, die junge Frau mitzunehmen. Sie hatte sich flatterhaft und launisch gegeben, was ein typischer Wesenszug der Jugend war. An einem Tag war sie voller Inbrunst und Leidenschaft für ihre Mission gewesen, am nächsten hatte sie sich unablässig über die Strapazen der Reise beschwert.
Mit ihren schwarzen Locken, die ihr beinahe bis zur Hüfte reichten, und ihrer schlanken Gestalt hatte Zoe auf dem langen Weg von Griechenland nach Italien ein ums andere Mal die begehrlichen Blicke von Männern auf sich gezogen, was ihr offenkundig gefallen hatte. Dies zu Eunikas Unmut, denn Ablenkung jeglicher Art konnte sie nicht dulden. Bei ihrer Reise durfte es einzig und allein um das große Ziel gehen.
Einmal hatte sie Zoe mit einem jungen Phönizier erwischt, der gerade seine Hand unter ihr Gewand hatte schieben wollen. Ihn hatte sie davongejagt, ihr hatte sie eine tüchtige Tracht Prügel versetzt. Nach diesem Vorkommnis hatte Zoe einige Tage lang kein Wort gesprochen, und Eunika hatte sich schon gefragt, ob sie den Orden verlassen würde, doch sie war geblieben. Das Veilchen unter ihrem Auge war inzwischen verschwunden.
Eunika sah wieder nach vorn. Am Stadttor hatte sich eine Handvoll römischer Soldaten postiert. Misstrauisch beäugten sie die Menge, die sich lärmend an ihnen vorbei ins Innere schob. Einer von ihnen, ein junger Mann mit wachen, grünen Augen, blieb mit seinem Blick an ihrer kleinen Gruppe hängen. Seine Stirn legte sich in Falten.
Unruhe stieg in ihr auf. Der Legionär sah fünf Frauen unterschiedlichen Alters vor sich, die alle die gleichen blauen Gewänder und die gleichen braunen Mäntel trugen. Damit hatten sie seine Aufmerksamkeit geweckt.
Sie schalt sich eine Närrin, weil sie sich nicht für eine unauffälligere Kleidung entschieden hatte. Zu Hause demonstrierten sie mit ihrem einheitlichen Aussehen ihren Dienst für den Orden, so wie auch Soldaten dieselben Uniformen trugen. Jeder, der ihnen begegnete, wusste, mit wem er es zu tun hatte.
Aber nicht hier in Rom.
Als sie gerade an ihm vorbeigehen wollte, trat er ihr in den Weg. Er fragte etwas in seiner Sprache, die sie nicht verstand. Für sein Alter klang seine Stimme ungewöhnlich tief. Eine Hand ruhte auf dem Griff seines Schwerts, das er an einem Gurt an seiner linken Hüfte trug. Eunika wusste, dass die Römer ihre Schwerter Gladius nannten. Eine furchtbare Waffe, die schreckliche Wunden reißen konnte, wie ihr erzählt worden war.
»Bitte, sprichst du Griechisch?«, erwiderte sie in ihrer Muttersprache.
Der Soldat nickte.
»Wo wollt ihr hin?«, wiederholte er seine Frage.
»In die Stadt«, antwortete sie.
Seine Brauen zogen sich zusammen. »Halte mich nicht zum Narren, Weib, das kann ich mir denken, dass ihr in die Stadt wollt. Aber was genau habt ihr dort vor?«
Zum Glück hatte sie sich für den Fall, dass sie jemand danach fragte, eine Geschichte zurechtgelegt.
»Wir möchten eine Weinhandlung eröffnen«, erklärte sie ihm, ohne zu zögern. »Wir haben gehört, ihr Römer liebt gute Weine.«
Ein verblüffter Ausdruck erschien auf seinem Gesicht.
»Eine Weinhandlung? Und wo sind eure Weine? In die Bündel, die ihr bei euch tragt, passen kaum zwei Amphoren hinein.«
»Wir suchen zunächst nach geeigneten Räumen. Die Weine werden erst in zwei Wochen geliefert. Sobald wir eröffnet haben, komme ich gerne zurück und bringe dir etwas zum Probieren.«
»Und warum tragt ihr alle dieselbe Kleidung?«
Sie lächelte höflich und zuckte mit den Schultern. Darauf wusste sie keine Antwort, die seine Neugier nicht noch weiter angefacht hätte.
Hinter der Stirn des Legionärs arbeitete es. Entweder lag es an der Aussicht auf einen kostenlosen Wein, oder er war zu dem Schluss gekommen, dass von fünf Griechinnen keine Gefahr für Rom ausging, ganz gleich, was sie anhatten und was sie in der Stadt zu suchen haben mochten. Jedenfalls gab er den Weg frei.
»Ihr könnt passieren«, sagte er, ohne sie dabei anzusehen. Sein Blick war jetzt auf etwas hinter ihr gerichtet, und ein Grinsen hatte sich auf seinem Gesicht ausgebreitet.
Wahrscheinlich hatte er Zoe entdeckt, und sie hätte schwören können, dass diese ihn in diesem Moment anlächelte. Sie drehte sich jedoch nicht um, um die junge Frau zu maßregeln. In diesem Moment kam ihr ihre Schönheit gerade recht.
»Danke«, sagte sie stattdessen nur und setzte sich wieder in Bewegung.
Von innen war Rom noch beeindruckender als von außen. Staunend betrachtete Eunika die mehrstöckigen Gebäude, die sich überall erhoben. Wie, in aller Welt, war es möglich, dass Menschen solche Bauwerke errichteten? In ihrem Dorf gab es nur Hütten, die gegen diese Häuser ebenso winzig wie schäbig wirkten. Auf ihrer Reise hatten sie viel Erstaunliches gesehen, aber nichts reichte an diesen Anblick heran.
Rechts von ihnen befand sich ein Markt, auf dem Händler Einheimischen und Neuankömmlingen ihre Waren feilboten. Auf kleinen Feuern brutzelten Fleischspießchen, und es wurde Brot geröstet, woanders wurden Wasser und Wein in großen Bechern aus Ton angeboten. Ein köstlicher Duft nach Gebratenem und frischen Backwaren lag in der Luft. Eunika beobachtete drei römische Frauen, die zwischen den Ständen hindurch schlenderten und sich dabei angeregt unterhielten. Sie waren großgewachsen und strahlten eine natürliche Eleganz aus.
Auf der linken Seite führten mehrere Straßen und Gassen tiefer in die Stadt hinein. Und überall waren Menschen, die in alle Richtungen gleichzeitig zu strömen schienen.
»Was tun wir jetzt, Eunika?«
Sie löste sich aus ihrer staunenden Erstarrung. Sofia, ihre engste Vertraute, war an sie herangetreten.
»Als Erstes suchen wir uns eine Unterkunft«, entschied sie. »Wir brauchen Lebensmittel, unsere Vorräte sind fast erschöpft. Und dann warten wir.«
»Ob er uns zwischen diesen Massen finden wird? Ich habe noch nie so viele Menschen auf so engem Raum gesehen.«
Eunika lächelte. »Er wird uns finden, da bin ich mir sicher. Ich hatte während unserer Reise einige Male das Gefühl, dass er über uns wacht. Vermutlich weiß er bereits, dass wir Rom erreicht haben.«
»Hast du wieder von ihm geträumt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nicht mehr, nachdem wir aufgebrochen sind.«
Wenn sie ehrlich war, hatte das Zweifel in ihr geweckt, doch das würde sie Sofia gegenüber niemals zugeben. War sie vielleicht einem Trugbild aufgesessen? Hatte ihr Geist ihr etwas vorgegaukelt, um auf diese Weise ihre brennende Sehnsucht zu stillen?
Nein, dazu war alles zu real gewesen. Sie konnte sein Gesicht deutlich vor sich sehen. Die langen, eisgrauen Haare, die schwarzen Augen, die spitz gefeilten Zähne.
Sein Name sei Marton, hatte er ihr im Traum gesagt. Und er wisse, wo Er sich befinde. Die Zeit sei reif, und dies sei die letzte Chance, ihn aus den Schatten zurückzuholen.
Eunika wusste, dass er recht hatte. Der stolze Orden der Medusen war Jahrhunderte alt, und einst sollte er über dreihundert Anhängerinnen gehabt haben. So hatte es Nephele, ihre Vorgängerin, ihr erzählt, bevor sie vor sechs Jahren gestorben war. Ihre kleine Gruppe war der kümmerliche Rest.
Wahrscheinlich war einfach alles zu lange her. Die Frauen in ihrem Dorf wollten nichts mit ihnen zu tun haben, sie fanden sie unheimlich. Zoe zu rekrutieren war ein Erfolg gewesen, das erste neue Mitglied des Ordens seit langer Zeit. Allerdings hatte sich Eunika schon vor ihrer Reise immer häufiger gefragt, ob das Mädchen tatsächlich mit dem Herzen dabei war. Oder ob der Orden für sie nur eine Gelegenheit dargestellt hatte, der erdrückenden Enge des väterlichen Hofs zu entfliehen.
So oder so, in nicht allzu ferner Zeit würde der Orden ausgestorben sein, da gab sie sich keinen Illusionen hin. Was bedeuten würde, dass sie versagt hätten, wenn es ihnen bis dahin nicht gelungen war, ihre Mission zu erfüllen.
Eunika griff nach dem Anhänger, den sie an einer Schnur um ihren Hals trug. Der schwarze, glänzende Stein fühlte sich kühl an. Er war etwa so groß wie ihr Daumen und stellte den Kopf einer Schlange dar. Ein zufälliger Betrachter wäre zu dem Schluss gekommen, dass es sich um ein besonders kunstvoll gearbeitetes Schmuckstück handelte, doch sie wusste es besser. Das einzige und deshalb so unermesslich wertvolle Relikt war von Generation zu Generation und von Anführerin zu Anführerin weitergegeben worden. Vielleicht war sie die Letzte, die es tragen würde.
Sie durften nicht scheitern.
»Komm«, wandte sie sich an Sofia. »Es wird bald dunkel.«
Schweigend marschierten sie in die Stadt.
†
Barus riss den Kopf zurück. Zu spät, sein Gegner war verflucht schnell. Die Keule streifte ihn zwar nur an der Schläfe, aber die Wucht reichte aus, um ihn zu Boden zu schicken. Sein Schwert entglitt ihm. Sterne tanzten vor seinen Augen, Übelkeit stieg in ihm auf. Er drängte sie zurück. Keine Zeit zum Ausruhen.
Schon war der Gegner wieder heran. Barus handelte rein instinktiv, rollte sich zur Seite. Mit einem dumpfen Laut knallte die Keule neben ihm auf den gestampften Lehmboden.
Er sprang auf die Beine und versuchte den Schwindel in seinem Kopf zu ignorieren. Mit der rechten Hand tastete er nach dem Dolch in seinem Gürtel. Sein Widersacher, ein bulliger Mann, der ihn um einen halben Kopf überragte, startete bereits den nächsten Angriff. Diesmal konnte er ausweichen, er spürte den Luftzug der Keule, die dicht vor seiner Nase vorbeizischte.
In einer fließenden Bewegung riss er den Dolch heraus, sprang vor und stach aufs Geratewohl zu. Er spürte leichten Widerstand, und ein erstickter Aufschrei im Halbdunkel bestätigte ihm, dass er getroffen hatte. Vermutlich hatte er dem Kerl nur die Haut angeritzt, aber das würde reichen, um ihn wenigstens für einen kurzen Moment aus dem Rhythmus zu bringen. Sofort machte er einen Satz zurück. Gerade noch rechtzeitig, um einem weiteren, allerdings nur nachlässig geführten Keulenhieb zu entgehen.
Keuchend verharrte er, erwartete die nächste Attacke. Sein Gegner rührte sich nicht. Im fahlen Mondlicht konnte er das Weiß seiner Augen sehen. Der Bursche fixierte ihn mit seinen Blicken, schien über seinen nächsten Schritt nachzudenken. Dann war ein Stöhnen zu hören.
Vielleicht hatte er ihn schwerer erwischt, als er gedacht hatte.
Um sich herum nahm er schnelle Bewegungen wahr, ein Ächzen und Keuchen drang an seine Ohren. Seine Männer verteidigten sich tapfer. Er konnte nur hoffen, dass die Götter auf ihrer Seite standen.
Der Schwindel ließ allmählich nach. Sein Gegenüber machte einen Schritt nach vorn, aber der Ausfall war nur angetäuscht, als wolle er seine Reaktion testen. Barus glaubte zu sehen, dass seine Hüfte feucht glänzte. Dort musste er ihn getroffen haben. Wie es aussah, blutete die Wunde heftig.
Ein bösartiges Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. Die Zeit lief für ihn. Je mehr Blut der Mann verlor, desto schwächer wurde er. Früher oder später würde er sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Da er keinen ernsthaften Angriff mehr wagte, schien er bereits geschwächt zu sein.
Neben ihm fiel etwas schwer zu Boden und hätte ihn beinahe umgerissen. Mit einem raschen Blick erkannte er Antonius. Aus einer großen Halswunde sprudelte das Blut in Strömen, quer über seinen muskelbepackten Brustkorb zog sich ein klaffender Schnitt. Er sah zu ihm auf, sein Gesicht verzerrte sich, dann kippte sein Kopf zur Seite.
Barus presste die Lippen zusammen. Antonius war sein bester Kämpfer gewesen.
Er hörte das schwere Atmen seines Gegners. Wie lange würde es dauern, bis ihn der Blutverlust in die Knie zwang?
Ein Schrei in der Dunkelheit. Die Stimme gehörte Benignus.
Kein Zweifel, sie wurden aufgerieben. Die Götter hatten anscheinend Besseres zu tun, als sich mit ihnen abzugeben. Er konnte nicht länger warten. Was nützte ihm ein Sieg gegen seinen Gegner, wenn er als Einziger übrig bleiben würde? Dann würden sich die anderen auf ihn stürzen, und er wäre sowieso verloren.
»Rückzug!«, brüllte er in die Dunkelheit und warf sich bereits herum, huschte in die schmale Gasse, durch die sie erst vor wenigen Minuten den Hinterhof betreten hatten.
»Lasst sie laufen, die kleinen Kläffer, die haben genug. Die kriegen wir noch«, donnerte eine ihm wohlvertraute Stimme. Gyrom. Dröhnendes Gelächter und Jubelgeschrei waren die Antwort.
Barus hörte hastige Schritte hinter sich und hoffte, dass es seine eigenen Männer waren und keine übermotivierten Gegner, die den Befehl ihres Anführers missachtet hatten. Vor ihm gabelte sich der Weg. Er bog nach rechts ab, und als er weitere hundert Schritte in vollem Tempo zurückgelegt hatte, wurde er langsamer und blieb schließlich stehen.
Kurz darauf holten ihn die anderen ein. Erleichtert stellte er fest, dass Amatus, seine rechte Hand, sich unter den Überlebenden befand. Gleich darauf verwandelte sich seine Freude in Bestürzung. Außer Amatus standen nur noch Junius und Six vor ihm. Als der Kampf begonnen hatte, waren sie zu acht gewesen. Also war in dieser kurzen Zeit die Hälfte seiner Leute aufgerieben worden.
Sein Gesicht begann vor Wut und Scham zu brennen. Was war er nur für ein Narr gewesen! Er hatte gewusst, dass er mit diesem direkten Angriff auf seinen Konkurrenten ein großes Risiko eingegangen war. Ein zu großes, wie ihm in diesem Moment schmerzhaft bewusst wurde.
Amatus schien seine Gedanken lesen zu können. »Hätten wir gesiegt, wäre es das wert gewesen«, sagte er.
Seine beiden Kameraden nickten zustimmend.
Barus fuhr sich durch sein kurz geschnittenes Haar. Seine Schläfe schmerzte. Ihm fiel auf, dass er noch immer den blutbefleckten Dolch in der Hand hielt. Er bückte sich, wischte die Klinge an der Erde sauber und steckte sie weg.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Amatus.
»Etwas trinken, schlage ich vor«, brummte er. »Wie ich Gyrom kenne, wird er seinen Sieg feiern und uns in Ruhe lassen.«
Zumindest heute Nacht, fügte er im Stillen hinzu.
»Schätze, das ist ein guter Einfall«, meinte Six und entblößte dabei sein zahnlückiges Gebiss.
Schweigend marschierten sie durch die spätabendlichen Gassen. Die Luft war kalt, und Barus wünschte sich, er hätte seinen Mantel dabeigehabt, doch der hätte ihn im Kampf nur behindert, deshalb hatte er ihn in seiner kleinen Kammer in dem vierstöckigen Haus am Rande der Subura zurückgelassen.
Als sie um die nächste Ecke bogen, erblickten sie in etwa fünfzig Schritten Entfernung ein windschiefes Gebäude, aus dessen Fenstern Licht auf die Straße fiel. Eine Taverne.
»Diese da?«, schlug Amatus vor.
»Eine ist so gut wie die andere«, antwortete Barus.
Als er die Tür öffnete, schlugen ihm warme Luft und Stimmengewirr entgegen. Trotz dieser späten Stunde waren beinahe alle Tische besetzt, doch sie fanden einen freien Platz, erfreulicherweise dicht neben einem Kohlebecken. Als er sich auf dem wackeligen Stuhl niederließ, spürte Barus die wohlige Wärme, die von der Glut ausging.
Ein gedrungener Mann, dessen rechtes Auge von einer Lederklappe verdeckt wurde, trat an ihren Tisch und warf ihnen wortlos einen fragenden Blick zu.
»Einen Krug Wein und vier Becher«, bestellte Amatus.
»Und einen Kanten Brot«, ergänzte Junius. »Aber ohne Schimmel, wenn's geht.«
Der Mann brummte eine unverständliche Antwort, wandte sich ab und verschwand hinter dem Tresen. Kurz darauf kehrte er mit einem Tablett zurück, auf dem sich ein Krug, vier Becher und ein großes Stück Brot befanden. Er stellte es ab und hielt Amatus seine ausgestreckte Hand unter die Nase.
»Hier wird im Voraus bezahlt«, knurrte er und funkelte ihn mit seinem verbliebenen Auge an.
Barus tastete nach seinem Geldbeutel, zog einige Münzen hervor und gab sie dem Wirt. Dieser begutachtete das Geld, nickte zufrieden und ließ sie allein.
Amatus schenkte ihnen Wein ein, dann erhob er seinen Becher. »Auf unsere gefallenen Kameraden«, proklamierte er.