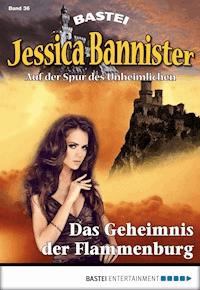0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die unheimlichen Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Eine alte, düstere Burg und gleich in der Nähe das unheimliche, nebelverhangene Moor. Hier liegt das Sanatorium der Schönheitsspezialistin Sue Shattner. Frauen und Männer besuchen dieses Sanatorium, und Sue Shattner scheint ihnen tatsächlich ihre Jugend zurückzugeben. Was ist das Geheimnis ihres phänomenalen Erfolgs? Und warum verschwinden auf einmal junge Frauen auf ihrer Burg?
Rätsel, die Jessica Bannister lösen will, deshalb hat sie sich unter falschem Namen eingeschlichen. Und die Rätsel werden immer größer, als plötzlich eine geisterhafte Erscheinung mitten in der Nacht an Jessicas Bett auftaucht. Mit ihrem hypnotischen Klagegesang lockt die Geistererscheinung Jessica aus der düsteren Burg hinaus, hinein in die tiefschwarze Nacht - und in das gefährliche, glucksende Moor ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Die Hauptpersonen
Die Burg der verlorenen Frauen
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: shutterstock / Evgeniia Litovchenko
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-4111-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die Hauptpersonen:
Jessica Bannister
Sie ist Reporterin beim London City Observer und auf mysteriöse Fälle spezialisiert. Sie hat übersinnliche Fähigkeiten, kann in Visionen und Träumen in die Vergangenheit reisen und die Zukunft voraussehen. So sah sie als Zwölfjährige auch den Tod ihrer Eltern voraus. Sie wuchs danach bei ihrer Großtante Beverly Gormic auf, bei der sie noch heute lebt.
Jim Brodie
Er ist Fotograf beim London City Observer. Als Jessica ihren Job bei der Zeitung antritt, steht er ihr sogleich mit Rat und Tat zur Seite, und es entwickelt sich schon bald eine enge Freundschaft zwischen den beiden. Wenn Jessica an einem Auftrag arbeitet, ist er fast immer als Fotograf an ihrer Seite.
Beverley Gormic
»Tante Bell« ist Jessicas Großtante. Nach dem Tod von Jessicas Eltern hat sie ihre Nichte bei sich aufgenommen und großgezogen. Jessica hat auch heute noch ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Ziehmutter. Beverly weiß über Jessicas übersinnliche Fähigkeiten Bescheid, sie selbst befasst sich intensiv mit Spiritismus und Okkultismus.
Martin T. Stone
Der Chefredakteur des London City Observer
Die Burg der verlorenen Frauen
von Janet Farell
Die Sonne war schon halb hinter dem Horizont versunken.
Eben noch hatten ihre warmen, goldenen Strahlen das Moor mit honigfarbenem Licht übergossen. Nun aber glühten das Schilf, die Gräser und das Heidekraut in einem dunklen Rot. Nebelschwaden stiegen aus dem Boden und waberten vor dem immer kleiner werdenden Sonnenbuckel, der wie ein feuriger Hügel aus dem Moor ragte.
Unwillkürlich verlangsamte ich die Geschwindigkeit meines kirschroten Mercedes 190. Dunst hüllte die frisch asphaltierte Straße vor mir ein. Verlassen und einsam lag sie da und schlängelte sich wie ein Fremdkörper durch das hügelige, wilde Moor.
Das Verdeck meines Oldtimers war zurückgeklappt, denn es war ein sonniger, warmer Tag gewesen. Doch jetzt wehte eine kühle Brise, die mich frösteln ließ. Unheimlich und schaurig wirkte die Umgebung. Und unheimlich und schaurig war auch das, was mich hier erwartete …
Ich stoppte am Straßenrand.
Das graue Asphaltband war nur so breit, dass gerade zwei Autos nebeneinander Platz hatten. Schilf und Heidekraut säumten den Rand. Dahinter begann das tückische Moor.
Aber ich brauchte nicht zu befürchten, dass mir ein Wagen entgegenkam, denn seit ich die kleine Ortschaft Totnes hinter mir gelassen hatte, war ich keinem Menschen mehr begegnet. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn die neue Straße führte lediglich zu einer alten Burg, die mitten im Moor am Ufer des Dart lag.
Diese Burg war mein Ziel.
Vor einem halben Jahr war das alte Gemäuer für einen Spottpreis in den Besitz einer gewissen Sue Shattner übergegangen, die das mittelalterliche Bauwerk renovieren ließ. Sie hatte darin ein Sanatorium eingerichtet, das sich unter der Prominenz der ganzen Welt rasch einen Namen gemacht hatte. Verjüngungskuren standen dort ebenso auf dem Programm wie Entspannung für Körper, Geist und Seele.
Ich konnte mir gut vorstellen, dass man in dieser einsamen Gegend seinen stressigen Alltag rasch vergessen konnte. Ich für meinen Teil jedoch hätte mir zur Erholung einen weniger unheimlichen und gefährlichen Ort ausgesucht als dieses nebelverhangene Moor. Aber über Geschmack und Vorlieben lässt sich ja bekanntlich streiten.
Steine knirschten unter meinen Schuhen, als ich das Auto verließ, und ein kalter Windstoß erfasste mich und zerzauste mein Haar. Der faulige Geruch von Morast wehte mir aus dem Moor entgegen.
Fröstelnd rieb ich mir mit den Händen über die Oberarme. Dann machte ich mich an dem Verdeck meines Wagens zu schaffen.
Meinen Aufenthalt in dieser unwirtlichen Gegend hatte ich Martin T. Stone zu verdanken. Stone war der Chefredakteur des London City Observer, einer auflagenstarken Londoner Boulevard-Zeitung, für die ich als Journalistin arbeitete.
Einen unerbittlicheren Chef als ihn konnte ich mir kaum vorstellen. Stone verlangte von seinen Mitarbeitern stets das Äußerste – und seinen Entscheidungen musste man sich beugen, ob man wollte oder nicht.
Doch im Grunde war Stone ein herzensguter Mensch, was er unter seiner rauen Schale jedoch hervorragend zu verbergen wusste.
Ich seufzte und musste unwillkürlich daran denken, welchen Umständen ich es zu verdanken hatte, dass ich mich jetzt in diesem einsamen Moor befand. Als ich heute Morgen zum Redaktionsgebäude des London City Observer fuhr, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich mich am Abend zweihundert Kilometer von London entfernt in einem nebeligen Moor irgendwo zwischen Totnes und Dartmouth wiederfinden würde.
Dabei hatte der Tag so vielversprechend angefangen. Zusammen mit Jim Brodie, dem Starfotografen des London City Observer, arbeitete ich seit einem Tag an einer brandheißen Reportage. In einem Londoner Gefängnis war es zu einer Revolte gekommen. Die Häftlinge hatten drei Wärter in ihre Gewalt gebracht und das übrige Personal gezwungen, das Gefängnis zu verlassen. Die Inhaftierten drohten, die Geiseln sofort zu töten, sollte die Polizei etwas gegen sie unternehmen.
Seitdem herrschte in dem Gefängnis das reinste Chaos. Feuer wurden auf den Dächern entzündet, und die Häftlinge, die sich alle aus ihren Zellen hatten befreien können, verwüsteten die ganze Anlage.
Die Polizei war ziemlich ratlos, und man wartete auf einen geeigneten Zeitpunkt, die Revolte niederzuschlagen.
Aber eine solche Gelegenheit schien sich nicht zu bieten, und da die Polizei die Geiseln nicht in Gefahr bringen wollte, wurde davon abgesehen, das Gefängnis einfach zu stürmen und zurückzuerobern.
Die gesamte Gefängnisanlage war umlagert von Reportern und Journalisten. Ein ganzer Wald von Kameras und Mikrofonen war aufgestellt worden, und in den Seitenstraßen standen die Übertragungswagen der verschiedenen Hörfunk- und Fernsehstationen.
Die Zugänge und Zäune des Gefängnisses wurden jedoch von Polizisten gesichert, um allzu eifrige Reporter daran zu hindern, einzudringen. Die Gebäude im näheren Umkreis waren ebenfalls von der Polizei besetzt, um sich bessere Einsicht in die Vorgänge innerhalb der Strafanstalt zu verschaffen.
Von der Straße aus konnten aus diesem Grund weder gute Fotos geschossen werden, noch bestand die Möglichkeit, einem Gefangenen ein Statement zu entlocken.
Um diesem Missstand abzuhelfen, war Jim auf die Idee verfallen, mit mir zusammen in einem schäbigen Fabrikgebäude in der Nachbarschaft Stellung zu beziehen.
Jim hatte wohlweislich Spezialobjektive mitgenommen, mit denen er auch aus weiter Entfernung noch gestochen scharfe Fotos schießen konnte.
Jim war ein junger Kerl von Mitte zwanzig, also nicht viel älter als ich. Sein Blondschopf wirkte stets völlig verwuselt und ungekämmt, und er trug vornehmlich mehrfach geflickte Jeans. Seine hervorstechendste Charaktereigenschaft war, dass er auf Vorschriften und Verbote nicht viel gab.
Wir fanden eine schadhafte Stelle im hohen Maschendrahtzaun, der das Fabrikgelände umgab, und zwängten uns hindurch.
Dann huschten wir im Schutz einiger Container und Kisten über den Hof auf das Lagerhaus zu. Die Halle war düster, und drinnen roch es muffig. Staub tanzte im Licht, das schräg durch die milchigen Fenster drang.
Der Gabelstaplerfahrer, der in der Halle Kisten und Paletten hin- und herfuhr, bemerkte uns nicht. Ungehindert erklommen wir eine rostige Eisentreppe und gelangten schließlich auf eine höhere Ebene, so eine Art Dachboden oder wie auch immer.
Die Kisten, die hier oben gestapelt waren, sahen morsch und verstaubt aus. Tauben hatten sich zwischen ihnen eingenistet. Ihr Rascheln und Gurren hallte an den nackten Betonwänden wider. Unrat lag auch überall herum. Es musste schon lange her sein, dass sich jemand von der Fabrik hier oben umgesehen hatte.
In der Dachschräge, die zum Gefängnis wies, gab es eine große Luke. Das Glas war zerbrochen, und dicke Spinnweben pappten in den Ecken und Winkeln. Dunkle Wasserflecke auf dem Boden deuteten darauf hin, dass es an dieser Stelle immer hineinregnete.
»Eine bessere Stellung werden wir kaum finden«, bemerkte Jim, dessen schlaksige Gestalt sich dunkel vor dem hellen Rechteck der Dachluke abzeichnete.
Geschäftig entfernte er die Spinnweben, brachte seine Kamera in Stellung und händigte mir seinen Feldstecher aus.
Jim hatte recht. Von der Dachluke aus konnten wir die gesamte Gefängnisanlage überblicken.
Jim verschoss einen Film nach dem anderen, während ich mir einen Eindruck von dem Chaos verschaffte, das auf dem Gefängnishof und auf den Dächern der Anlage herrschte.
Dabei fiel mir auf, dass es einen Anführer unter den Inhaftierten zu geben schien. Er kommandierte die anderen herum, schrie Befehle und ließ sogar einige Häftlinge, die nicht nach seiner Nase tanzen wollten, von seinen Gefolgsleuten brutal zusammenschlagen.
Der Anführer war ein grobschlächtiger Kerl mit schwarzem langen Haar und einem hageren Gesicht, das mich entfernt an einen Habichtkopf erinnerte. Sein Name war Bill Hancock, wie meine Recherchen später ergaben. Er saß wegen mehrfachen Mordes und schwerer Körperverletzung ein.
In der Spätausgabe des London City Observer erschienen Jims Fotos auf der Titelseite. Ich hatte einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben, in dem ich all meine Beobachtungen über Bill Hancock und die Aktivitäten während der Gefängnisrevolte schilderte.
Bill Hancock musste irgendwie in den Besitz dieser Spätausgabe gelangt sein. Er hatte Jims Fotos gesehen und meinen Artikel gelesen – und war auf eine irrwitzige Idee verfallen.
Bisher hatten sich die Häftlinge geweigert, mit der Polizei zu verhandeln und ihre Forderungen für die Freilassung der drei Wächter zu nennen.
Doch am Abend kam plötzlich einer der Inhaftierten an das Gefängnistor. Er hatte ein weißes, schmuddeliges Hemd an einen Besenstiel gebunden und fuchtelte damit in der Luft herum. Er war feist und unrasiert, seine Klamotten halb zerfetzt und unordentlich. Rußschlieren durchzogen sein verschwitztes Gesicht, sodass er wie die Karikatur eines Vietnamkämpfers aussah.
Jim und ich standen zu dieser Zeit bei den anderen Journalisten vor dem Tor. Stone hatte uns aufgetragen, bis zum Sonnenuntergang vor dem Gefängnis zu warten, falls sich noch etwas ereignen sollte.
Und wie es schien, hatte Stone mal wieder den richtigen Riecher gehabt.
Als der Häftling sicher war, dass die Polizei ihn in Ruhe lassen würde, kam er bis ans Gitter heran.
»Unser Anführer will mit zwei bestimmten Personen verhandeln!«, rief er mit rauer Stimme.
Die Fernsehkameras übertrugen die Szene live in die Wohnzimmer der Londoner Bürger, und unzählige Tonbänder schnitten die Worte mit.
»Als Gesprächspartner akzeptiert er nur die Journalistin Jessica Bannister und den Fotografen Jim Brodie! Sie sollen sofort hier erscheinen!«
Jim warf mir einen erstaunten Seitenblick zu. »Wie kommen wir denn zu dieser Ehre?«, flüsterte er.
»Hier stehen die beiden!«, rief in diesem Augenblick ein übereifriger Kollege von einem Konkurrenzblatt und deutete aufgeregt auf Jim und mich.
Die Kameras schwenkten zu uns herum. Plötzlich standen wir im Zentrum des allgemeinen Interesses!
Jim und ich konnten nicht anders. Wir mussten ans Tor treten, während uns die aufmerksamen Blicke der Polizisten folgten.
»Lassen Sie sich auf keine Diskussion ein«, zischte mir ein Scotland-Yard-Beamter zu. »Sie sind nicht befugt, irgendwelchen Forderungen zuzustimmen.«
Ich fühlte mich mehr als unwohl in meiner Haut. Und als Jim und ich schließlich dem feisten, nach Schweiß riechenden Mann gegenüberstanden, zitterten mir die Knie.
»Was soll dieser Zauber?«, fragte Jim in seiner laxen Art. Selbst diese ungewöhnliche Situation konnte ihn nicht aus der Ruhe bringen. »Warum will Bill Hancock unbedingt mit uns verhandeln?«
Der Sträfling griff sich unter das zerrissene Hemd und zog eine Ausgabe des London City Observer hervor. Er warf die Zeitung durch das Gitter auf die Straße, wo sie mit der Titelseite nach oben liegen blieb. Jims Fotos und mein Artikel waren zu sehen.
Der Kerl grinste uns hämisch an. »Ihm hat wohl euer Bericht gefallen. Bill ist ein medienbewusster Mensch. Er legt viel Wert darauf, dass unsere Forderungen auch an die breite Öffentlichkeit gelangen und nicht in der Schreibtischschublade des Polizeipräsidenten vergammeln.«
»Wir sind nicht befugt, auf irgendwelche Forderungen einzugehen«, sagte ich.
Mein Gegenüber zuckte nur gleichgültig mit den Schultern.
»Die Zeit drängt nicht«, sagte er scheinbar gelassen. »Bill gibt euch einen Tag Zeit, die Befugnisgewalt mit den Bullen zu klären. Solltet ihr morgen Abend aber nicht wieder hier erscheinen, wird die erste Geisel getötet!«
Mit diesen Worten wandte er sich ab und trottete in aller Seelenruhe zum Hauptgebäude des Gefängnisses zurück.
Jetzt stürmten die Polizisten und die Journalisten auf uns ein und löcherten uns mit Fragen, auf die wir selbst gerne eine Antwort gehabt hätten. Nach einer Stunde konnten wir den Platz dann endlich verlassen und nach Hause gehen. Viele unserer Kollegen sahen uns mit neidvollen Blicken nach.
Wir würden mit den Revoltierenden verhandeln und im London City Observer exklusiv über die Forderungen und Hintergründe berichten. Stone konnte zufrieden mit uns sein. Die Auflage unseres Blattes würde explosionsartig steigen – und Jim und ich konnten die Story unseres Lebens schreiben.
Aber es sollte alles ganz anders kommen …
***
Das Verdeck meines kirschroten Mercedes war nun geschlossen. Ich starrte missmutig über das nebelverhangene Moor. Meine Gedanken jedoch weilten noch in London und bei den Ereignissen dieses Tages.
Heute Abend sollte das erste Treffen zwischen Jim, mir und den revoltierenden Gefangenen stattfinden – aber ich war weit weg von London.
Jim und ich waren an diesem Morgen ganz aufgeregt gewesen und stürzten uns sogleich auf die Vorbereitungen für die Verhandlungen mit Bill Hancock.
Doch da rief uns Martin T. Stone, der Chefredakteur des London City Observer, zu sich in sein Büro. Er saß im Ledersessel hinter seinem mit Papieren völlig überfüllten Schreibtisch, und sein Gesichtsausdruck verriet, dass er so grimmig und schlecht gelaunt war wie immer.
Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, wenn Stone nach uns schicken ließ.
Jetzt betrachtete er Jim und mich eine Weile lang schweigend, sah uns einfach nur intensiv mit seinen stahlblauen Augen an.
»Jessica, Sie werden sich nicht mehr um diese Gefängnisrevolte kümmern!«, sagte er dann schließlich mit rauer Stimme.
»Was? Aber ich …«
Ich wollte protestieren. Aber Stone brachte mich mit einer herrischen Geste zum Verstummen.
»Die Sache ist viel zu gefährlich, Jessica. Bill Hancock ist ein skrupelloser Mörder. Er hat bereits zwei Menschen auf dem Gewissen. Und ich möchte nicht, dass Sie Nummer drei werden.«
»Aber …«
»Keine Widerrede!«, fuhr Stone mich in ungewohnter Härte an.
Ich hatte ja schon viel mit ihm durchgemacht. Aber so wie heute hatte ich ihn noch nie erlebt.
»Wie wird Bill Hancock reagieren, wenn Jessi nicht zur Verhandlung erscheint?«, fragte Jim.
»Er wird es gar nicht merken«, erwiderte Stone barsch.
»Scotland Yard schickt eine Agentin. Sie wird Jessica bis aufs Haar gleichen und mithilfe unserer Videoaufzeichnungen vom letzten Betriebsfest auch ihre Gestik, Mimik und ihre Stimmlage einüben.«
Ich stieß hörbar die Luft aus und ließ betrübt die Schultern hängen.
»Glauben Sie mir«, sagte Stone jetzt in versöhnlichem Tonfall. »Es ist besser so. Die Sache ist einige Nummern zu groß für Sie. Und … ich möchte Sie nicht verlieren, Jessica. Dafür bin ich sogar bereit, auf eine Exklusivstory zu verzichten.«
Stone lächelte mich an. Es war ein väterliches, freundschaftliches Lächeln, mit dem er wohl um Verständnis heischen wollte.
»Zum Ausgleich habe ich eine andere Story für Sie«, sagte er und war gleich darauf wieder ganz der geschäftige Chefredakteur. »Sicher haben Sie schon mal etwas vom Shattner-Sanatorium in Dartmoor gehört?«
Ich seufzte und gab mich geschlagen. »Sprechen Sie etwa von der Schönheitsfarm in dieser uralten Burg, wo sich die Reichen ein Stelldichein geben, um ihre paar Fältchen im Gesicht beseitigen zu lassen?«
Stone nickte.
»Und über was soll ich da berichten? Etwa über Salben und Schlammpackungen?«
Widerwillen und Wut stiegen in mir hoch. Aber Stone ließ sich dadurch nicht beeindrucken.
»Die Tochter eines prominenten amerikanischen Schauspielers hielt sich bis vor Kurzem im Shattner-Sanatorium auf. Ihr Name ist Stella Waid. Seit gestern ist sie spurlos verschwunden.«
»Vermutlich wurde es ihr in dem alten Kasten zu langweilig«, bemerkte Jim. »Sicher ist sie nur durchgebrannt und kehrt bald wieder zurück.«
»Das Shattner-Sanatorium liegt mitten im Moor an der Mündung des Dart«, erklärte Stone ungerührt. »Die nächste Ortschaft heißt Totnes und ist zehn Kilometer entfernt. Von dort führt nur eine einzige Straße durch das tückische Moor zur Burg.«
»Vielleicht hat sie sich im Moor verirrt und ist umgekommen«, überlegte ich, und ein Schauer rieselte mir dabei den Rücken hinunter.
»Genau das sollen Sie herausfinden«, sagte Stone. »Am besten machen Sie sich sofort auf die Socken. Bis zu Grafschaft Devon ist es ein weiter Weg. Ich habe Ihr Kommen bereits angekündigt. Allerdings musste ich mir für Sie einen anderen Namen ausdenken. Offiziell übernehmen Sie ja die Verhandlungen mit den revoltierenden Gefängnisinsassen. Und damit die Tarnung der Scotland-Yard-Agentin nicht auffliegt, recherchieren Sie so lange unter dem Namen – Samantha Stone!«
Jim prustete los.
Stone bedachte ihn mit einem strafenden Blick, woraufhin der Starfotograf des London City Observer sofort verstummte.