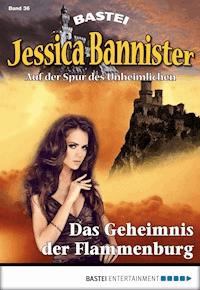0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die unheimlichen Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Als Jessica zum ersten Mal die unheimliche Gestalt in der schwarzen Mönchskutte erblickt, glaubt sie, ihren Augen nicht trauen zu dürfen. Denn dieses Wesen muss schon seit Urzeiten tot sein!
Höhnisch grinst ein Totenschädel unter der Kapuze hervor, und die junge Journalistin ergreift panisch die Flucht. Doch trotz ihrer Angst ist klar: Sie muss das Geheimnis des Geistermönchs lüften, der seit Jahrhunderten die nebelverhangenen Wälder von Wales unsicher macht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Die Hauptpersonen
Der schwarze Mönch der Rache
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: shutterstock / Dmitrijs Bindemanis; Dmitry Yakunin
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-4267-3
www.bastei-entertainment.de
Die Hauptpersonen:
Jessica Bannister
Sie ist Reporterin beim London City Observer und auf mysteriöse Fälle spezialisiert. Sie hat übersinnliche Fähigkeiten, kann in Visionen und Träumen in die Vergangenheit reisen und die Zukunft voraussehen. So sah sie als Zwölfjährige auch den Tod ihrer Eltern voraus. Sie wuchs danach bei ihrer Großtante Beverly Gormic auf, bei der sie noch heute lebt.
Jim Brodie
Er ist Fotograf beim London City Observer. Als Jessica ihren Job bei der Zeitung antritt, steht er ihr sogleich mit Rat und Tat zur Seite, und es entwickelt sich schon bald eine enge Freundschaft zwischen den beiden. Wenn Jessica an einem Auftrag arbeitet, ist er fast immer als Fotograf an ihrer Seite.
Beverley Gormic
»Tante Bell« ist Jessicas Großtante. Nach dem Tod von Jessicas Eltern hat sie ihre Nichte bei sich aufgenommen und großgezogen. Jessica hat auch heute noch ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Ziehmutter. Beverly weiß über Jessicas übersinnliche Fähigkeiten Bescheid, sie selbst befasst sich intensiv mit Spiritismus und Okkultismus.
Martin T. Stone
Der Chefredakteur des London City Observer
Der schwarze Mönch der Rache
von Janet Farell
Stunde um Stunde verrann, und nicht eine einzige Sekunde trug dazu bei, dass ich ruhiger wurde. Nervös starrte ich durch die Windschutzscheibe, ohne eigentlich zu wissen, was ich überhaupt suchte.
»Gemütliche Gegend«, murrte Jim Brodie, mein Begleiter, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Wenn man so etwas überhaupt Straße nennen konnte.
Jim hatte seine gewohnte Lässigkeit längst verloren. Irgendwie verkrampft saß er hinter dem Steuer seines klapprigen Fords und ließ wie ich die unangenehme Schaukelei über sich ergehen.
Zu allem Unglück wurde die Sicht auch immer schlechter. Alles wirkte grau in grau und drückte auf meine Stimmung, die nicht gerade rosig war. Denn ein düsteres Gefühl der Bedrohung lastete auf mir, die Ahnung einer schrecklichen Gefahr.
Und diese Ahnung sollte sich bald bestätigen …
Seit wir vor etwa einer halben Stunde hinter dem Städtchen Tregoran wegen einer Baustelle eine Umleitung hatten nehmen müssen, verschlechterte sich sowohl der Zustand der Straße als auch das Wetter. Graue Schwaden hingen wie feingewebte Tücher zwischen den Bäumen, die am Fahrbahnrand an uns vorbeizogen.
Wir befanden uns mitten in dem Cambrian Mountains, ohne allerdings genau zu wissen, wo. Jim tat zwar so, als hätte er alles im Griff, doch da hatte ich so meine Bedenken.
»Wenn du mich fragst, haben wir uns ganz gewaltig verfahren«, bemerkte ich.
»Unmöglich«, erwiderte Jim empört und blickte zur Seite. »Wie kommst du denn darauf? Als Pfadfinder habe ich mich auch nie verlaufen. Du bist in Begleitung eines erfahrenen Waldläufers, Jessi. Nur keine Panik. Winnetou und Old Shatterhand waren Waisenknaben gegen mich.« Er grinste breit.
Seit ich, Jessica Bannister, als Journalistin beim London City Observer, einer großen Londoner Boulevard-Zeitung arbeitete, hatte ich viel mit Jim Brodie, einem hervorragenden Fotografen und guten Freund, erlebt. Ich mochte seine lockere Art, mit der er auch scheinbar aussichtslose Situationen meisterte, und er hatte auch immer einen kessen Spruch auf den Lippen.
Sein blonder Haarschopf wirkte stets wild und zerzaust, er trug mehrfach geflickte Jeans und konnte seine vorlaute Klappe zumeist einfach nicht halten.
»Na, dann kann mir ja nichts passieren, wenn du so ein toller Pfadfinder bist, Jim. Außer dass ich in dieser klapprigen Kiste einen Bandscheibenvorfall kriege«, konterte ich und lächelte schief zurück. »Die anfallenden Arztkosten bezahlst aber du, alter Trapper.«
Jim schaltete einen Gang zurück und fuhr noch langsamer. Den Fluch, den er dabei zwischen den Zähnen zerbiss, konnte ich nicht verstehen. Vielleicht war das auch besser so.
Ich blickte wieder nach vorne. Der Wald schien irgendwie dichter geworden zu sein, so als wären die Bäume enger zusammengerückt. Immer häufiger schlugen tiefhängende Äste gegen das Dach, und die Nebelschwaden verschoben sich stärker mit den Zweigen, als wollten sie ein noch dichteres Netz bilden.
Ich war keine ängstliche Natur und hatte schon so manch heile Sache erlebt, aber diese Gegend war mir irgendwie unheimlich. Wir befanden uns in Wales und schienen immer noch tiefer in die Cambrian Mountains zu geraten, obwohl wir eigentlich längst kurz vor den Toren Londons hätten sein müssen.
Ich musste an Tante Bell denken und blickte auf die Uhr. Gewiss machte sie sich schon wieder die größten Sorgen, weil ich mich in den letzten zwei Tagen nicht gemeldet hatte.
So war sie halt. Seit ich meine Eltern im Alter von zwölf Jahren verloren hatte, kümmerte sie sich wie eine Mutter um mich. Obwohl ich längst volljährig war, hätte sie mich am liebsten nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen.
»Nicht gerade unser Glückstag«, maulte ich und strich meinen Rock zurecht.
Er war völlig zerknautscht, und außerdem tat mir das Kreuz weh. Allmählich sehnte ich mich zudem nach einer Dusche oder zumindest einer bequemeren Sitzgelegenheit.
»Wo du recht hast, da hast du recht«, gestand Jim Brodie. Wieder grinste er. »Leider kann ich es nicht ändern, aber ich arbeite daran. Zum Teufel aber auch, dass ich mein Zauberbuch vergessen habe.«
»Ha, ha, ha«, erwiderte ich. »Du warst auch schon mal origineller.«
»Stimmt«, gab Jim zu und beschloss, die etwas gereizte Stimmung durch Schweigen abzuschwächen, wofür ich ihm dankbar war.
Ich musste an den Anfang der Woche denken. Montagmorgen hatte unser Chefredakteur Martin T. Stone uns beide kurz nach der Frühstückspause in sein Büro zitiert und uns einen Auftrag erteilt, der sich gewaschen hatte.
In der Nähe von Llanfarian an der walisischen Westküste sollte es angeblich eine Geisterbeschwörerin namens Lilian Ferguson geben, die in der Lage sein sollte, den Geist jedes beliebigen Verstorbenen aus dem Reich der Toten zu holen und zu befragen. Darüber sollte ich vor Ort recherchieren, einen Artikel schreiben und Jim ein paar Fotos der Extraklasse liefern.
Unbewusst musste ich trotz allem Malheur lächeln. Nie zuvor hatte ich einen solchen Flop erlebt. Alles war ein gewaltiger Schwindel gewesen.
Diese Miss Ferguson, eine alte Dame Anfang achtzig, und drei Einheimische hatten versucht, die Öffentlichkeit mit ein paar simplen Tricks unter Mithilfe der heutigen Technik von Phänomenen zu überzeugen, die es nicht gab.
Meinen Chef würde es jedoch gar nicht amüsieren, dass das Ergebnis mehr als kläglich ausgefallen war. Das war mir jetzt schon klar. Ich sah ihn bereits vor mir, und es war keine angenehme Vorstellung …
Ein Knall gegen den Unterbodenschutz riss mich aus den Gedanken.
Die Schlaglöcher schienen nicht weniger zu werden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie sich gerade heute exakt auf dieser Straße zu einer Party versammelt hatten, nur um uns zu ärgern.
Wir wurden jetzt heftig durchgeschüttelt, sodass man Angst haben musste, dass der Kopf jeden Moment mit der Unterseite des Wagendaches Bekanntschaft machte.
Seufzend schloss ich die Augen und versuchte, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ich lehnte mich zurück, um mich zu entspannen.
Wenn ich den Kopf gegen die Nackenstütze drückte, war diese elende Ruckelei nicht ganz so schlimm. Bisher hatte ich die Müdigkeit in meinem Körper mehr oder weniger ignoriert. Erst jetzt spürte ich, wie erschöpft ich war.
Am frühen Nachmittag hatten wir die Küste der Cardigan Bay verlassen, um nach London zurückzukehren. Gegen Abend wollten wir eigentlich daheim sein, doch darauf wurde wohl nichts, es sei denn, wir fanden endlich eine vernünftige Straße und entsprechende Hinweisschilder.
Ich war zu nervös, um die Fahrt über etwas zu dösen zu können. Da war dieses Gefühl der Bedrohung, das sich nicht abschütteln ließ. Ich wusste auch nicht, was der Grund dafür war, doch irgendetwas beunruhigte mich.
Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf, der mich nicht mehr losließ. Vor einer Stunde hatten wir Llanfarian verlassen, um über Tregaron, Lampeter und Pencader auf die Autobahn zu gelangen, die nördlich von Swansea begann und uns auf schnellstem Wege bis nach London gebracht hätte.
Von Llanfarian bis Swansea waren es etwas mehr als 60 Kilometer Luftlinie, und die Landstraßen, die durch die waldreichen Cambrian Mountains führten, ließen eigentlich gar nicht zu, dass man sich verfuhr.
Die Umleitung, der plötzlich immer schlechter werdende Weg, der den Namen der Straße gar nicht verdiente, dieser Nebel und der fast beängstigende Wald …
Was hatte das alles zu bedeuten?
Beunruhigt öffnete ich wieder die Augen und sah Jim an, ohne dass er meinen Blick zu bemerken schien. Er konzentrierte sich auf den Fahrweg und saß mittlerweile noch weiter nach vorne gebeugt, da sich der Dunst zu einem handfesten Nebel entwickelt hatte.
Angestrengt versuchte ich, meine Nervosität zu unterdrücken, denn was sollte schon passieren? Jim war ein guter Fahrer und sogar als Experte zu bezeichnen, wenn es darum ging, seinen fast schrottreifen Ford durch alle Lebenslagen zu steuern, ohne dass er seinen Geist aufgab.
Und außerdem war in dieser Gegend wohl kaum mit Gegenverkehr zu rechnen, was ich bei dieser Wetterlage als sehr positiv empfand.
Die seltsame Unruhe in mir, die nichts mit Jim und dem Auto zu tun hatte, blieb, ohne dass ich sie erklären konnte.
Tante Bell hätte eine Lösung gehabt und mich auf meine leichten hellseherischen Fähigkeiten hingewiesen, die ich von meiner Mutter geerbt hatte. Schon als Kind hatte ich den Tod meiner geliebten Eltern und einen Brand im Nachbarhaus vorhergesagt.
Ich musste unwillkürlich lächeln bei dem Gedanken an Beverly Gormic. Sie war eine liebenswerte Frau mit einem großen Herzen, allerdings auch ein wenig überkandidelt. Ihr ausgeprägter Hang zum Übersinnlichen konnte manchmal nerven. Wer nur einmal ihre Villa im Norden von London betreten hatte, wusste Bescheid.
Ihr früh verstorbener Mann Franklin, zeit seines Lebens der Archäologie verschrieben, hatte von seinen zahllosen Reisen Kostbarkeiten, aber auch noch mehr Plunder mitgebracht, allesamt aber Hinterlassenschaften uralter Kulturen, die Tante Bell hütete wie ihren Augapfel.
Tante Bell war die Erste gewesen, die von meinen übersinnlichen Fähigkeiten überzeugt gewesen war. Inzwischen wusste ich, dass ich die Fähigkeiten tatsächlich auch hatte. In Träumen und Visionen konnte ich manchmal ein Stückchen der Zukunft sehen, und ich hatte auch gelernt, damit zu leben.
Fröstelnd schloss ich wieder die Lider. Und ich betete, dass diese Unruhe in mir nichts zu bedeuten hatte.
Doch meine Hoffnungen wurden enttäuscht …
***
Kaum hatte ich mich wieder einigermaßen entspannt, als die leichte Gänsehaut, die auf meinem Körper lag, zu einer Woge unangenehmer Kälte wurde, die sich nicht mehr abschütteln ließ.
Entsetzt stellte ich fest, dass etwas Beklemmendes von mir Besitz ergriff. Es war nicht zu beschreiben, nur einfach da und voll furchteinflößender Energie, die mich übernahm und auf seltsame Art und Weise beherrschte.
Ich wollte die Augen öffnen, um das Schreckliche, das da in der Dunkelheit meines Denkens lauerte, zu verscheuchen. So wie man einen Albtraum abbricht, indem man erwacht, doch es ging nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Nein, ich hatte keine Chance, mich freizumachen. Dieses Etwas hielt mich gefangen und zwang mich, all das zu sehen und in mich aufzunehmen, was es mir präsentierte. Kalt, brutal und ohne Gnade.
In der Finsternis flackerte plötzlich ein kleines Licht, so als ob man ein Streichholz in einer riesigen Höhle anzündet. Nur Sekunden später begann dieses winzige Flackern um seine eigene Achse zu kreisen, um immer größer zu werden, bis es so grell war, dass ich am liebsten aufgeschrien hätte.
Plötzlich war der grelle Spuk vorbei, und ein sanftes, grünliches Gleißen befreite mich von meinen Schmerzen, ohne mich aus den Klauen des Unbegreiflichen zu entlassen.
Was war nur mit mir los? Warum konnte ich meine Augen nicht öffnen, und was lähmte mich?
Die Angst in mir wurde übergroß. Ich wusste, dass ich nicht träumte, um in diesen Träumen Bilder aus der Zukunft zu empfangen.
Das hier war etwas anderes.
Etwas hielt mich gefangen und zwang mir seinen Willen auf.
Das Schlimme an alledem war, dass ich klar denken konnte, ohne jedoch auch nur die geringste Chance zur Gegenwehr zu haben. Das andere Etwas war viel stärker.
Plötzlich war es vorbei.
Nun nahm ich Konturen wahr, die sich langsam aus grauweißen Schwaden schälten. Ich erkannte ein Gesicht, ein sehr bekanntes und vertrautes Gesicht. Es war Jim. Er lächelte und sagte etwas, dass ich nicht verstehen konnte.
Aber da war noch etwas anderes. Ich konnte es nicht sehen, aber ich spürte das Bedrohliche, das irgendwo lauern musste. Alles in mir kämpfte gegen das lähmende Gefühl an. Ich musste Jim warnen, denn die Gefahr drohte ihm!
Aber es war bereits zu spät. Etwas Dunkles, Mächtiges sprang aus dem Nichts auf Jim zu, ehe er begriff, was mit ihm passierte. Er wurde zu Boden geschleudert, und ich vernahm seine schrecklichen Schreie, die abrupt endeten.
Dann sah ich wieder sein Gesicht. Es war blutüberströmt. Überall war Blut, und er lag wie leblos mitten in einer großen, roten Lache.
Ich wollte schreien, doch ich konnte nicht.
***
»He, was ist los?«
Ich riss die Augen auf, denn die Verkrampfung wich in derselben Sekunde, da ich Jims Stimme vernahm. Er klang sehr besorgt.
Für zwei, drei Sekunden war ich völlig verdattert und musste erst einmal meine Gedanken ordnen. Es war, als sei ich aus einem kurzen Schlaf erwacht, obwohl ich wusste, dass ich nicht eingenickt war.
Jim Brodie blickte mich an.
»Ist dir nicht gut?«, wollte er wissen.
»Wieso?«, gab ich zurück. Etwas Besseres fiel mir im Moment nicht ein. »Ich … ich muss wohl eingedöst sein.«
In Wirklichkeit klopfte mein Herz wie wild, und ich hatte Mühe, ruhig zu atmen. Der Schrecken in mir saß tief, doch ich wollte es mir nicht anmerken lassen.
Jim nickte. »So kann man es auch nennen«, erwiderte er und blickte wieder nach vorne. »Auf jeden Fall hast du gekeucht und gestöhnt, als ob du einen Albtraum gehabt hättest.«
»Quatsch«, sagte ich möglichst schroff, um von meiner wahren Verfassung abzulenken.
Eigentlich hätte ich Jim von meiner Vision von gerade eben erzählen sollen. Immerhin ging es ihn ganz besonders an, denn ich hatte von ihm und nicht von irgendeiner x-beliebigen Person geträumt.
Ich unterließ es dennoch. Besonders schon deshalb, weil mein Begleiter nichts von meiner übersinnlichen Gabe wusste. Das war ein Geheimnis, das ich ganz allein mit Tante Bell teilte.
Ich musste wieder an Bell und ihre ständigen Mahnungen denken. Ich musste meine Visionen und Träume ernst nehmen und darauf achten, was sie mir sagen wollten, das hatte mir Tante Bell immer wieder eingetrichtert. Aber ich konnte meine übersinnliche Gabe nicht kontrollieren. So war es manchmal sehr schwierig, Rückschlüsse aus meinen Träumen und Visionen zu ziehen.
Auch war es diesmal ganz anders als sonst gewesen. Da war etwas gewesen, das versucht hatte, Besitz von mir zu ergreifen, aber mir war nicht klar, was genau es gewesen sein konnte.
»He, sieh mal da!«
Ich erschrak, denn ich war geistig völlig abwesend gewesen.
Nun sah ich, was mein Kollege meinte.
Den Wald hatten wir gerade hinter uns gelassen, und der Nebel begann ebenfalls, sich langsam aber sicher zu verabschieden. Die dichten Schwaden, die wie Leichentücher im Geäst der Bäume gehangen hatten und über der Straße geschwebt waren, wichen zurück.
Vor uns lag ein kleines Tal, das von einem breiten Bach durchflossen wurde, der wiederum in einem See mündete. An den sanft ansteigenden Hügeln stand dichter Wald. Die Straße, auf der wir fuhren, führte weiter südlich zwischen Weiden und Wiesen hindurch und verlor sich hinter einem kahlen Hügel.
In dem Dorf, das zwischen der Straße und dem Bach lag, gab es nicht mehr als hundert Häuser, Scheunen und Stallungen. Eine kleine Kirche, deren Turm alles überragte, stand im Zentrum des Ortes.
»Hübsch«, fand ich, denn ich mochte diese kleinen, verträumten Flecken Erde, wo die Zeit stillzustehen schien. »Hast du eine Ahnung, wie das Dorf heißt?«
»Clavenor, wenn ich mich nicht gewaltig irre«, klärte mich Jim auf. »Eben habe ich einen verwitterten Wegweiser am Straßenrand gesehen.«