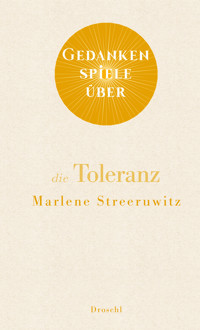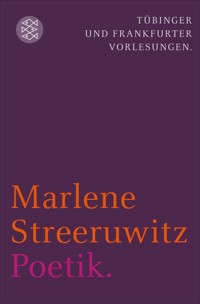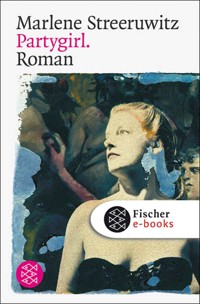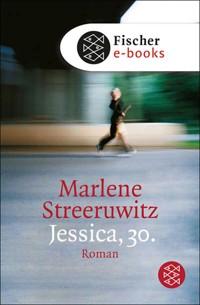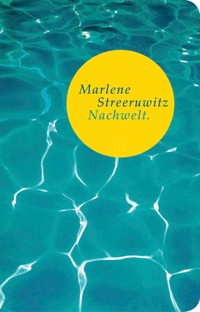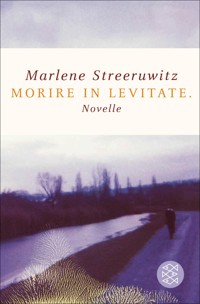
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sterben. In Leichtigkeit.« Wie und wann wird das sein. Und wird es dann das Ererbte sein. Dieses Gestorben-Werden, im Passivum. Erdrückt von den Hinterlassenschaften der Täter und Zuschauer. Die beschwiegene Nazi-Vergangenheit wird zum körperlichen Symptom, und der hinfällige Körper – als Pflegefall degradiert – zum Ort der Erzählung. Auf einem winterlichen Spaziergang folgt Geraldine Denner ihren Gedanken. Sie will ihre Geschichte nicht verdämmern lassen, sie will sterben können. Sie hofft, wissend zu bleiben. Und in der nicht vergessenen Erzählung vom eigenen Leben jene Leichtigkeit zu finden, die das Ende in Würde verwandelt. In Andrej Tarkowskijs Film ›Nostalghia‹ wünscht sich Domenico ein »Sterben aus Leichtigkeit«. Die Opernsängerin Geraldine Denner in dieser Novelle von Marlene Streeruwitz hat diese Möglichkeit nicht: Zu brutal war sie in das kollektive Schweigen gezerrt worden. Aus dieser Auslöschung im Leben wünscht sie sich eine Leichtigkeit der Überwindung für den letzten Augenblick. »Dachte nur sie immer daran. Dachte nur sie die ganze Zeit daran, wie das sein würde. Dieser letzte Augenblick. Und würde sie dann daliegen und sich denken, dass es das nun war. Und dass das nur sie wissen würde, wie das war. Dieses Geheimnis nur ihr gehören würde.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Marlene Streeruwitz
morire in levitate.
Novelle
Über dieses Buch
»Sterben. In Leichtigkeit.« Wie und wann wird das sein. Und wird es dann das Ererbte sein. Dieses Gestorben-Werden, im Passivum. Erdrückt von den Hinterlassenschaften der Täter und Zuschauer.
Die beschwiegene Nazi-Vergangenheit wird zum körperlichen Symptom, und der hinfällige Körper – als Pflegefall degradiert – zum Ort der Erzählung.
Auf einem winterlichen Spaziergang folgt Geraldine Denner ihren Gedanken. Sie will ihre Geschichte nicht verdämmern lassen, sie will sterben können. Sie hofft, wissend zu bleiben. Und in der nicht vergessenen Erzählung vom eigenen Leben jene Leichtigkeit zu finden, die das Ende in Würde verwandelt.
In Andrej Tarkowskijs Film ›Nostalghia‹ wünscht sich Domenico ein »Sterben aus Leichtigkeit«. Die Opernsängerin Geraldine Denner in dieser Novelle von Marlene Streeruwitz hat diese Möglichkeit nicht: Zu brutal war sie in das kollektive Schweigen gezerrt worden. Aus dieser Auslöschung im Leben wünscht sie sich eine Leichtigkeit der Überwindung für den letzten Augenblick.
»Dachte nur sie immer daran. Dachte nur sie die ganze Zeit daran, wie das sein würde. Dieser letzte Augenblick. Und würde sie dann daliegen und sich denken, dass es das nun war. Und dass das nur sie wissen würde, wie das war. Dieses Geheimnis nur ihr gehören würde.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books 2016
© 2004 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Gundula Hißmann und Andreas Heilmann, Hamburg
Coverabbildung: Polaroid von Marlene Streeruwitz
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490129-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Herzen brachen. Sie steckte [...]
Herzen brachen. Sie steckte ihre Hände tiefer in die Manteltaschen. Herzen konnten brechen. Sie hätte die Daunenjacke anziehen sollen. Der Stoffmantel nicht warm genug. Ihres. Ihr Herz. Das würde diese dünne Linie entlang. Diese Linie. Links. Links vom Brustbein. Diesen scharfen Schmerz entlang. Innen. Diesen Schmerz entlang. Der aus der Erinnerung aufstieg. Der aus der Erinnerung aufsteigen konnte. Mittlerweile. Dieser messerklingenscharfe Schnitt links in der Brust sich an sich selbst erinnern konnte. Längst nicht mehr die drängende Schwere einer Verzweiflung brauchte. Sich sammeln konnte. Zu diesem fadenspitzen Stechen gerann. Der Schmerz ein heller Metallfaden die Brust herauf gespannt. Mit sich trug. Oft.
Oft lange. Auf einem Röntgenbild zu sehen sein hätte müssen. Unter dem Rippenansatz gerade herauf. Aber bei Röntgenaufnahmen nie zu spüren gewesen. Gerade nicht zu fühlen. Und dann auch nichts zu sehen gewesen war. Nichts zu sehen sein konnte. Aber da brechen würde. Der Schmerz sich verfestigt hatte. Da. Über die Jahre hatte der Schmerz sich verfestigt und zugespitzt. Dumpfer gewesen. Am Anfang. Früher. Und immer frischer geworden. Im Lauf der Zeit. Keine Narbe. Keine Narbe geworden. Das Gegenteil einer Narbe. Das genaue Gegenteil einer Narbe. Der frische Schnitt.
Sie blieb stehen. Der Schal war verrutscht. Der eisige Wind um den Hals. Um die Ohren. Sie zog die Handschuhe aus. Verknotete den Schal neu. Zog die Handschuhe wieder an. Der Wind von Norden. Über das Leithagebirge herüber auf den See hinaus. Das Wasser im Kanal rechts vom Weg. Das Wasser gerade während des Zufrierens. Das Wasser dicklich. Durchsichtig. Schwer. Unbeweglich unter dem Wind. Aber noch kein Eis. Der Wind raschelnd in den Weiden am Ankerplatz. In den Heckenrosenbüschen. Im Schilf. Der Wind trieb Schilfreste vom Schilfschnitt über den Lagerplatz links.
Sie ging schneller. Warum war es ihr nun gleichgültig geworden. Und war das endgültig. Oder war das wieder so eine Stufe auf dem Weg. Eine von diesen Raststationen. Zum Gewöhnen an die Verluste. Eine von diesen Plattformen. Auf denen man zu stehen kam. Zum Verschnaufen. Und sich gewöhnen. Dass wieder etwas nicht funktionierte. Nicht mehr so funktionierte. Jedenfalls nicht so funktionierte wie früher. Die Augen. Die Zähne. Die Gelenke. Der Magen. Die Blase. Und dann die Ersatzteile. Die Hilfsmittel. Die Prothesen. Nicht zu bemerken. Außen nicht zu bemerken. Bis jetzt. Bis jetzt war ihr von außen nichts anzusehen. Nur Vorbereitungen. Jetzt einmal nur Vorbereitungen für später. Wenn es dann offensichtlich werden sollte. Sie war zu jung. Sie war noch zu jung für dieses Offensichtliche. Aber das Training lief. Der Stolz wurde niedergezwungen. Jeden Tag. Jeden Tag ein bisschen. Nicht mehr ohne Brille einkaufen können. Kein einziges Ablaufdatum ohne Brille zu entziffern. Oder die Rechnung. Die Rechnungen. Die Zahlen grauschattig. Sie musste auf die Leuchtanzeige der Kassierin schielen. Bei »Merkur« war ihr sogar die zu klein. Und sie konnte nicht immer 50er Euroscheine hinhalten und darauf hoffen, richtig herauszubekommen. Es war ein Verlust. Ein kleiner Verlust. Die Handlungsfähigkeit nicht wirklich eingeschränkt. Es war höchstens so unangenehm wie das Sodbrennen nach Kaffee. Nicht stark. Nicht umfassend. Nicht wirklich hindernd. Aber dauernd da. Sie gab den Kaffee nicht auf. Sie würde den Kaffee nicht aufgeben. Warum sollte sie nicht mehr Kaffee trinken. Aber dieses selbstverständliche Schlendern in der Welt. Diese vollkommene Unbehelligtheit. Die gab es nicht mehr. Eine Brille und Rennie-Lutschtabletten und Betablocker und ein Schal für die Schultern. Das waren Notwendigkeiten geworden. Voraussetzungen. Voraussetzungen für Funktionieren. Und in einer Handtasche herumzuschleppen. Ausgerüstet sein. Aus dem Haus laufen. Nur so. Das ging nicht mehr. Aus dem Haus gehen. Das war eine Expedition geworden. Und das würde schwieriger werden. Und hoffentlich würde sie nie inkontinent. Aber warum sollte ihr das erspart werden. Warum sollte ihr das erspart bleiben. Immerhin war dafür noch Zeit. Das war dann immerhin noch 20 Jahre entfernt. Oder 15. Zumindest 10 Jahre sollte sie noch haben. Ohne eine solche Komplikation. Und vielleicht war es ja vorher. Vorbei. Ein flash. Diese Linie entlang. Ein Riss. Und aus. Und nur das Gefühl von Ohnmächtigwerden. Dieses Gefühl nicht. Dieses mühselige Ziehen hinter den Augen und der Kehle. Und Ankämpfen dagegen. Schlucken. Würgen. Und vor und zurück. Im Kopf. Dieses Vor-und-Zurück. Das dann langsamer wurde.
Und zerrender. Und der Eindruck, dass es sich beschleunigte, daher kam, dass dieses Hinauszerren und Zurückschnellen immer kürzere Strecken zurücklegte. Die erste Phase der Lähmung offenkundig darin bestand. Diesem Ziehen ohne Gegenwehr. Ausgeliefert. Sich selbst von innen in diese erste Lähmung ausgeliefert. Es ja der eigene Kopf machte. Das eigene Blut. Und was für eine Ungerechtigkeit. Den Tod mit der eigenen Wahrnehmung. Das Letzte von sich selbst. Selbst. Der eigene Todesengel. Bisher nur bis dahin. Bisher war sie nie wirklich ohnmächtig geworden. Bisher das Schlucken und den Kopf heben und es nicht wollen. Bisher hatte das geholfen. Bisher hatte sie immer solche Angst gehabt. Hatte die Besinnung nicht verlieren dürfen. Unter keinen Umständen sich selbst verlieren. Bisher hatte die Angst sie immer noch gerettet.
Eine Traube weißer Bälle hing von einer Weide. Weiße Bälle in einem Netz zusammengehalten. Rechts. Die Bälle grauweiß. Mehr als 20 Stück mussten das sein. Sie blieb nicht stehen. Sie hätte stehen bleiben müssen, die Bälle zu zählen. Die Weide über dem Kanal. Auf der anderen Seite des gallertigen Wassers. Die Bälle hingen in der Weide. Ruhig. Bewegten sich nicht im Wind. Die Balltraube schwer wie das Wasser. Das Schilf. Die Büsche. Die Bäume. Alles vom Wind in den Süden gebogen. Raschelnd und wispernd und in Bewegung. Das Wasser unberührt und glatt. Nur der Wind zu hören. Kein Flugzeug. Kein einziges Flugzeug über dem See. Kein Flugzeug in der Warteschleife kreisend. Tief über der Landschaft auf den Flughafen zu. Sonst oft 3 oder 4 Flugzeuge ihre Kreise zogen und immer tiefer. Das Dröhnen von oben und vom Hügelzug zurückgeworfen. Der Himmel leer. Der Himmel dünn blau und durchsichtige Wolkenbänke. Und nur der Wind. Im Schilf und in den Bäumen. Der Himmel dem Himmel. Und keine Masten. Keine Masten zu sehen. Keine Fernleitungsmasten in den Himmel. Auf der Fahrt über die Autobahn links die riesigen Masten. Nun schon in 3 Reihen über die Hügel. Es war sinnlos gewesen zu demonstrieren. Gegen dieses Mastengestelze zu unterschreiben. Wahrscheinlich hatte das sogar das Gegenteil erreicht. Das Interesse war damals aufgebraucht worden. In den 80ern. Und erledigt. Als wäre damals alles ohnehin erledigt worden. Und gerade erst wirklich notwendig gewesen wäre. Jedenfalls hatte sich das Gefühl verändert. Niemand nahm noch an, etwas verändern zu können. Etwas abzuändern. Und schon gar nicht gemeinsam. Und schon gar nicht für die Natur. Für eine Landschaft. Sie würde noch die fünfte Reihe von Masten entlangfahren müssen. Von Ungarn nach Norden. Eine Notwendigkeit würde das genannt werden. Eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und kein Argument dagegen. Schönheit. Schönheit eine ungültige Eintrittskarte geworden. Machte sie das so einsam. Der Verlust dieser Argumente. Ihrer gewohnten Argumente. Die, die sie nachgelernt hatte. Weil sie mit dem Verlust dieser Argumente die Möglichkeit verloren hatte, dazuzugehören. Dazugehören zu können. Hatte sie die Eintrittsparolen versäumt. Verlernt. War sie nicht nahe genug dabeigeblieben. Hatte etwas überhört. Hatte nicht mitbekommen, wie die Passwörter gewechselt worden waren. Hatte sich nicht genug angestrengt, alles zu verstehen. Aber es gab keine mehr. Es gab ganz einfach keine Passwörter mehr. Und das war die einzige Demokratisierung. Keine Passwörter mehr. Aber auch gleich gar nichts mehr, was mit denen zugänglich sein hätte können. Und bei ihr fiel das noch mit dem Altwerden zusammen. Das war doppelt enttäuschend. Keine Gesellschaft mehr. Nur noch Altäre. Und kein Kirchenschiff, einen aufzunehmen. Die Ministranten liefen noch herum und bimmelten und schenkten Wein ein. Aber es hatte jede Bedeutung verloren. Es war nur noch das Laufen und das Bimmeln. Es ging nur noch darum, wie viel Wein eingeschenkt wurde. Es ging nur um die Regulierung. Es ging nur noch darum, wie weit die sechste Reihe der Strommasten von der fünften entfernt sein würde. Und es ging sie nichts an. Es ging niemanden etwas an. Es ging wiederum niemanden etwas an. Es war alles sehr weit zurückgedreht. Und es war alles eine Mischung aus allen Zeiten, in denen es niemanden etwas angegangen. Jedenfalls nicht Leute wie sie. Die waren Zuschauer. Sie waren alle höchstens Zuschauer. Und die Bildschirme dafür schon überall. In den Wartehallen. In den Zügen. In den Bussen. Im Taxi. Und immer CNN