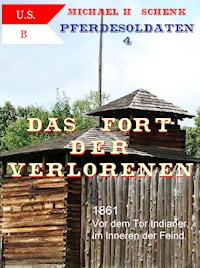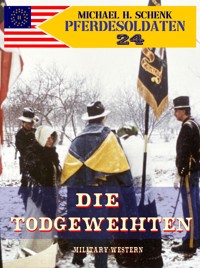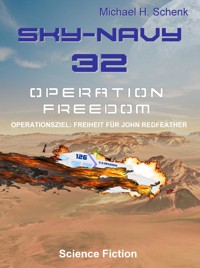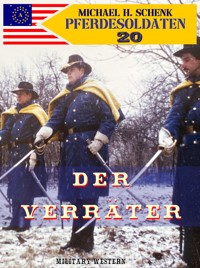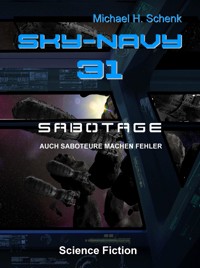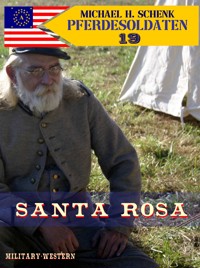
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
Western-Reihe um die fiktiven US-Kavallerieoffiziere Matt und Mark Dunhill, die im Bürgerkrieg und den Indianerkriegen bestehen müssen. Am Ende jeden Romans stellt der Autor die realen geschichtlichen Fakten vor. Spannung und ein hohes Maß an Authentizität sind garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michael Schenk
Pferdesoldaten 19 - "Santa Rosa"
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 Was bisher geschah
Kapitel 2 Viva la Revolucion
Kapitel 3 Offiziers-Besprechung
Kapitel 4 Goldene Steine
Marseillaise
Kapitel 5 Hinterhalt
Kapitel 6 Der Vorschlag
Kapitel 7 Die ungewohnte Flagge
Kapitel 8 Die Lockvögel
Kapitel 9 Die Beratung
Kapitel 10 Am Ratsfeuer
Kapitel 11 In der Falle
Kapitel 12 Ein Misserfolg
Kapitel 13 Der gemeinsame Feind
Kapitel 14 Patrouille West
Kapitel 15 Apachenwort
Kapitel 16 Abgefangen
Kapitel 17 Leere Worte
Kapitel 18 Zaste!
Kapitel 19 Eine letzte Chance
Kapitel 20 Der Bürgerrat
Kapitel 21 Rückschlag
Kapitel 22 Schatten im Mondlicht
Kapitel 23 Entscheidung an der Grenze
Kapitel 24 Unsichere Zukunft
Kapitel 25 Eine Frage der Ehre
Kapitel 26 Waffenstillstand
Kapitel 27 Unter der weißen Fahne
Kapitel 28 Ein letzter Schlag
Kapitel 29 Trennung
Kapitel 30 Am Ratsfeuer
Kapitel 31 Willkommen in Santa Rosa
Kapitel 32 Karte Fort Coronado und Umgebung
Kapitel 33 Karte Santa Rosa
Kapitel 34 Ankündigung
Kapitel 35 Historische Anmerkung
Kapitel 36 Historische Anmerkung
Kapitel 37 Maße und Geschwindigkeiten
Kapitel 38 Persönliche Freiheiten in den Romanen
Kapitel 39 Bisher erschienen:
Kapitel 40 Hinweis: Für Freiheit, Lincoln und Lee
Impressum neobooks
Kapitel 1 Was bisher geschah
Pferdesoldaten 19
Santa Rosa
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2023
Während sein Vater Matt Dunhill mit der fünften US-Kavallerie gegen die Konföderation des Südens kämpft, wurde sein Sohn Mark mit seiner Einheit in das gleiche Regiment übernommen. Der junge Captain ist in Fort Coronado, im Süden von New Mexico stationiert. Ein Gebiet, in dem Apachen, Banditen und Deserteure ihr Unwesen treiben. Nachdem eine große Kriegshorde der Apachen, unter Führung des alten Häuptlings Tse-tsij, unter schweren Verlusten zurückgeschlagen wurde, ist die Garnison von Fort Coronado deutlich verstärkt worden. Noch immer dringen kleine Apachenbanden über die Grenze hinweg ein und ziehen sich wieder zurück, bevor sie gestellt werden können. Zudem besteht der Verdacht, dass die Bewohner der kleinen Siedlung Bancroft einen lebhaften Handel mit den Chiricahua treiben. Auch die Hinweise auf einen erneuten Kriegszug der Apachen mehren sich. Für Major Bill Selkirk, den Kommandanten von Fort Coronado, eine sehr unangenehme Situation, denn ohne Beweise kann er nicht gegen Bancroft vorgehen und im Kampf gegen die Apachen dürfen seine Truppen die Grenze zu Mexiko nicht überschreiten.
Kapitel 2 Viva la Revolucion
Santa Rosa, Imperio Mexicano, im Grenzbereich zu New Mexico.
Die mexikanische Ortschaft Santa Rosa war einst von den spanischen Conquistadores gegründet worden und hatte seitdem allen Unbilden der Natur und des Menschen widerstanden. An der nordwestlichen Ecke des derzeitigen Kaiserreiches Mexiko gelegen, war der Ort durch Handel und Ackerbau zu einem gewissen Wohlstand gekommen. Zwei Quellen speisten im Norden einen kleinen Teich und im Osten einen munter plätschernden Bachlauf, so dass Mais und Getreide wuchsen. Ein altes Bewässerungssystem versorgte die nördlichen Felder und wurde sorgfältig instand gehalten. Santa Rosa glich einer blühenden Oase, denn das öde und wüstenartige Land an der Nordgrenze wurde hier von üppigen Grünflächen abgelöst, auf denen Mesquite-Sträucher und kleinere Baumgruppen wuchsen.
Viele Gruppen hatten schon versucht, Santa Rosa für sich einzunehmen: Yaqui-Indianer, Apachen, mexikanische Banditen und Revolutionäre. Jetzt waren es auch noch die Soldaten des französischen Kaisers Maximilian I., der derzeit das Land regierte und der von den Juaristas, den Männern des abgesetzten Präsidenten Benito Juarez, bekämpft wurde. Doch immer wieder hatten es die Bewohner des großen Dorfes verstanden, eine Zerstörung und Plünderung ihrer Heimat zu verhindern.
Dies war der Verdienst langjähriger Übung und der guten Augen jener Männer, die nach jeglicher Bewegung im Umland aufmerksam umher spähten, um eine Annäherung frühzeitig zu melden, damit Santa Rosa sich gebührend vorbereiten konnte.
Der wichtigste Aussichtspunkt hierfür war der alte Torreon. Viele ältere Siedlungen verfügten über einen solchen Verteidigungsturm, der bei einem Angriff auch die letzte Zuflucht war. In ihm gab es stets einen Brunnen, Vorräte sowie die Möglichkeit, einem Angriff oder einer Belagerung zu widerstehen. Vielerorts waren diese Türme längst zerfallen, doch in Santa Rosa wurde er sorgfältig gepflegt und ausgebessert. Der Torreon von Santa Rosa wies zudem eine Besonderheit auf, da der plumpe Turmbau vier Ebenen hoch war und damit einen Ausblick über die umgebenden Hügel hinweg gewährte. So war es einem aufmerksamen Beobachter möglich, die Annäherung Fremder über viele Meilen hinweg zu erkennen, selbst in sternenklaren Nächten, wenn Pferdehufe oder Wagenräder den Staub der Straße emporwirbelten.
Paolo Lopez besaß den Ruf, einer der besten Beobachter in der ereignisreichen Geschichte von Santa Rosa zu sein. Seinen scharfen Augen und einem ausziehbaren Teleskop von ausgezeichneter Güte war es zu verdanken, dass in den vergangenen Jahren niemand das Dorf hatte überraschen können.
Im Augenblick stand Emilio Hermanez, der Alcalde (Bürgermeister) des Dorfes am Fuß des Torreon und beschattete seine Augen, während er zur Plattform hinaufspähte. „Nun, Paolo, was siehst du? Wer kommt da?“
„Warte einen Moment, Emilio, warte. Es braucht Zeit und ein gutes Auge, das zu erkennen“, kam die Antwort von oben.
Während der Alcalde einen reich bestickten Anzug und Sombrero trug, war Paolo in das schlichte Weiß eines einfachen Peons, eines Landarbeiters, gekleidet. Den aus Stroh geflochtenen Sombrero hatte der Beobachter in die Stirn gezogen. Mit einer Hand schützte er das Objektiv seines Teleskops vor der Sonne.
„Paolo?“
„Ich sagte doch, du sollst warten, Emilio. Es braucht Zeit und ein …“
„…und ein gutes Auge, ich weiß“, knurrte der Alcalde, allmählich nervös werdend. „Maldetto, Paolo, du hast ein gutes Auge, aber uns fehlt Zeit!“
„Emilio, du weißt doch, wie schwierig es ist, gegen die Sonne zu schauen“, verteidigte sich Paolo.
„Ah, Paolo, weißt du, wie schwierig es ist, alles rechtzeitig vorzubereiten?“
„Oh, Emilio, und ob ich das weiß. Aber ich glaube, ich kann jetzt erkennen …“
„Was, Paolo? Was erkennst du?“
„Es sind … Es sind …“
„Bei der heiligen Madonna, Paolo, wer? Wer ist es? Nun sag schon!“
„Juaristas, Emilio.“
„Madonna mia, bist du sicher? Juaristas?“
„Haben mich meine Augen schon jemals getäuscht?“, ereiferte sich Paolo. „Natürlich sind es Juaristas.“
„Behalte sie im Auge, Paolo, mein Guter!“, rief der Alcalde hinauf. „Und wehe dir, du hast dich doch getäuscht.“
Emilio Hermanez machte auf den Absätzen kehrt und begann zu laufen. Der Torreon stand am nördlichen Rand des großen Dorfplatzes und während Emilio auf die Kirche zu hastete, rief er immer wieder warnend, dass die Juaristas kämen.
Padre Joaquin trat gerade aus der doppelflügeligen Tür seiner Kirche und sah Emilio fragend entgegen. „Emilio, wer ist es?“
„Juaristas, Padre, Juaristas.“
„Sage du den anderen Bescheid“, entgegnete der grauhaarige Padre, wandte sich ab und eilte mit geraffter Soutane die wenigen Stufen zurück. Seine einfachen Sandalen klatschten auf den sorgsam gereinigten Boden des Innenraums, während er den Altarraum zum Ziel nahm.
„Juaristas!“, rief er warnend seinem Helfer zu. „Eile dich, Leonardo, eile dich.“
In Windeseile packte Padre Joaquin die Enden des reich bestickten Altartuches, hob sie an und hüllte Becher, Schalen und Kruzifix darin ein. Schon eilte Leonardo mit einem einfachen Leinentuch und Bechern und Schalen aus Zinn herbei und ersetzte das massiv goldene Kruzifix durch eine geschnitzte Ausführung.
Der Padre verharrte kurz vor der Sakristei und warf einen besorgten Blick auf das Gitter, welches Altarbereich und Besucherraum voneinander trennte. Doch die schwarze Farbe war makellos und täuschte Schmiedeeisen vor, wo sich Gold befand.
Inzwischen erreichte Emilio Hermanez sein eigenes Haus, wo seine Frau Esmeralda besorgt vom Balkon herunterblickte. „Juaristas, mein Liebes, mein Engel, meine Madonna!“, rief er zu ihr hinauf. „Die Schärpe, Esmeralda, mein Täubchen! Die einfache mit den Schmutzflecken! Und bringe mir die einfache Jacke!“
Emilio wusste, dass er sich auf sie verlassen konnte, ebenso auf die anderen Bewohner des Dorfes. Schon oft waren die erforderlichen Vorbereitungen getroffen worden.
Endlich stand der Alcalde vor der Cantina. Juan Ramirez, ihr Besitzer, stand unter dem Vordach und unterhielt sich gerade mit Hubertus Lanzmayer, der die beste Cervesa nach deutschem Rezept braute, das man sich nur wünschen konnte.
„Juaristas?“, fragten beide unisono.
Als Emilio, ein wenig außer Atem, nickte, klatschte der stämmige Deutsche in die Hände. „Juan, ich werde Hilfe brauchen.“
„Seguramente, mein Freund, selbstverständlich.“ Der Besitzer der Cantina trat kurz in die offene Tür. „Dolores, die Leute von Juarez kommen. Hole noch etwas Pulque und Mescal aus dem Keller und die billigere Cervesa. Ah, und wir haben noch ein oder zwei Flaschen Champagner und Cognac … Bring sie rasch in das Versteck. Ich helfe Hubertus mit dem Klavier.“
„Juan, mein Freund, wie oft muss ich dir noch sagen, dass es ein Piano ist?“, seufzte Hubertus.
Dolores Ruiz, die junge und hübsche Bedienung, langte nach den besagten Flaschen. „Warum soll ich auch den Champagner verstecken? Das schreckliche Zeug trinken ja noch nicht einmal die Juaristas.“
„Weil es sogar Mexicanos gibt, die das Zeug hinunterwürgen, weil sie dann glauben, zur feineren Gesellschaft zu gehören“, antwortete Juan eilig. „Also tu, was ich dir sage.“
Dorfbewohner eilten umher, um alles herzurichten, eifrige Hände packten am Piano an, um es unter den Vorbau des Hauses des Alcalden zu tragen. Dort tauschte Emilio inzwischen den reich bestickten Anzug gegen ein schlichteres Exemplar und legte sich die rot-weiß-grüne Schärpe, das Zeichen seiner amtlichen Würde, um.
„Sie kommen!“, meldete ein Mann, der am südlichen Ortseingang postiert war. „Sie kommen.“
Hufgetrappel wurde hörbar.
Jenseits der südlichen Häuser wurde etwas Staub aufgewirbelt. Die Gestalten von Reitern waren zwischen den weiß gekalkten Häusern sichtbar. Gerade rechtzeitig entrollten zwei Frauen die alte mexikanische Trikolore und befestigten sie am Handlauf des Balkons. Dorfbewohner versammelten sich auf der Plaza, um die Reiter mit Freudenschreien zu begrüßen.
Emilio Hermanez hob die Hand.
Hubertus Lanzmayer griff in die Tasten und nach wenigen Augenblicken fiel ein gemischter Chor aus Frauen und Mädchen ein, um die Kämpfer von Benito Juarez mit ihrer inoffiziellen Hymne „La Cucaracha“ zu empfangen.
Nun trabten die ersten Reiter auf die Plaza und Emilio breitete freudestrahlend die Arme aus. „Meine lieben Freunde, seid willkommen! Es lebe die Revolution! Es lebe Benito Juarez!“
Kapitel 3 Offiziers-Besprechung
Fort Coronado, Grenzgebiet zwischen New Mexico und Mexiko.
Mit seinen gerade mal achtzehn Jahren war Mark Dunhill noch immer einer der jüngsten Kompanieführer in der regulären US-Army. Die Tatsache nunmehr zum Regiment seines Vaters, der fünften US-Kavallerie, zu gehören, erfüllte ihn mit Stolz und der Hoffnung, eines Tages Seite an Seite mit diesem zu dienen, auch wenn dies derzeit wohl noch in weiter Ferne lag. Matt kämpfte irgendwo in Virginia gegen die Truppen des Südens und Mark diente in Fort Coronado, wo der Bürgerkrieg weit entfernt schien.
Der sonntägliche Roll-Call und der Gottesdienst waren vorüber und die im Fort stationierten Soldaten traten ab, um endlich das ersehnte Frühstück einzunehmen. Die Offiziere folgten hingegen der Einladung von Major Bill Selkirk, dem Kommandanten des Forts, der in seinem Hauptquartier zur Besprechung bat, wobei Kaffee und, zur Feier des Tages, auch ein Schluck Whiskey ausgeschenkt wurden.
Als Mark seinen Dienst in Coronado antrat, da dienten hier zwei geschwächte Kompanien Infanterie, zwei ebenso geschwächte Kompanien Kavallerie und eine Sektion Artillerie. Neun Offiziere hatten diese Einheiten befehligt, den Major und dessen Adjutanten, Lieutenant Debries, eingeschlossen.
An diesem Morgen wurde Mark wieder einmal bewusst, wie sehr sich dieses Bild inzwischen verändert hatte, denn die letzten angekündigten Verstärkungen waren am gestrigen Tag eingetroffen.
Nun erreichten die stationierten Einheiten nahezu ihre Sollstärke. Marks bislang stets geschwächte Kompanie „H“ war an diesem Morgen erstmals mit insgesamt vierundneunzig Kavalleristen angetreten, wobei der junge Captain jetzt, neben seinem bewährten First-Lieutenant Ted Furbanks, auch zwei zusätzliche Second-Lieutenants erhalten hatte.
Obwohl die alte spanische Festung von Beginn an für eine größere Zahl an Soldaten ausgelegt worden war, schien es nun eng in ihren Mauern zu werden, denn mit den neuen Offizieren waren erstmals auch einige Frauen eingetroffen, so dass man den Ehepaaren eigene Räume zur Verfügung stellen musste.
Statt der früheren neun Offizieren, versammelten sich nun neunzehn in der Kommandantur, was es erforderlich machte, eine Reihe zusätzlicher Stühle aus der Messe herbeizuholen.
„Machen Sie es sich bequem, Gentlemen“, befahl der Major und legte den federgeschmückten Hardee-Hut und das Koppel mit Revolver und Säbel ab. Mit einem erleichterten Seufzer knöpfte er den zweireihigen Frock-Coat auf, der ihm als Linienoffizier, mit Dienstgrad auf Regimentsebene, zustand. Captains und Lieutenants besaßen als „Company-Grade“ nur einreihige Uniformröcke.
Es war Sommer und alle empfanden es als Erleichterung, die Jacken zumindest öffnen zu können. Die beiden Fenster der Kommandantur, zum Innenhof zeigend, waren zwar geöffnet, doch zwischen den Adobebauten der alten spanischen Anlage schien die Luft zu stehen. Auch wenn es innerhalb der Häuser ein wenig milder und vor allem schattiger war, der Sommer in New Mexico brachte die übliche brütende Hitze mit sich.
Unter den hölzernen Vordächern hingen Kalebassen, deren Verdunstungskälte den Inhalt angenehm kühlte. Auf Anraten des neuen Garnisonsarztes enthielten sie vor allem Zitronenlimonade.
Wie üblich unterhielten sich die Offiziere leise miteinander. Selkirk ließ sie gewähren, denn manchmal erfuhr er so Dinge, die man sonst vielleicht nicht mit ihm erörtert hätte. Dass man seinen Forderungen nach Verstärkung nachgekommen war, erfüllte ihn mit zwiespältigen Gefühlen, da er sich ausrechnen konnte, dass man nun von ihm auch Erfolgsmeldungen erwartete. Bislang sah es jedoch nicht danach aus, als könne er mit den zusätzlichen Truppen entlang der Grenze eine Änderung zum Besseren bewirken.
Bill Selkirk wartete, bis sich alle Anwesenden entspannt hatten und mit frischem Kaffee versorgt waren, dann gab er seinem Adjutanten einen Wink.
Lieutenant Jules Debries hatte viel von seiner vorherigen Unbefangenheit eingebüßt, seitdem er an den Animas Springs und später am westlichen Trail gegen die Apachen gekämpft und dem Tod mehrfach ins Auge geblickt hatte. Doch er war nicht, wie mancher andere Soldat, an den Erlebnissen zerbrochen, sondern an ihnen gereift. Er hatte sich vor der Zusammenkunft mit dem Major besprochen und begann, wie üblich, für ihn mit der Eröffnung der Beratung, denn um eine solche handelte es sich fraglos. Jeder der Anwesenden wusste, dass der Kommandant durch die Verstärkungen in Zugzwang geraten war.
Jules Debries nahm den Stab und trat an die große Wandkarte, auf welcher der Zuständigkeitsbereich des Forts markiert war und der auch die angrenzenden Gebiete zeigte. Handschriftlich waren einige Nachtragungen vorgenommen worden. Dabei handelte es sich um charakteristische Geländemarken, die der Orientierung dienen konnten.
„Gentlemen, ich möchte zunächst noch einmal die Ereignisse der vergangenen Wochen und deren Auswirkungen auf uns aufzeigen, da wir gestern die letzten Verstärkungen erhielten, zu denen auch die Lieutenants Fillmore und Towns von der ‚H‘-Kompanie der fünften US-Kavallerie sowie Lieutenant Jackson von der Batterie ‚D‘ der Socorro Light Artillery gehören.“
Die drei Genannten erhoben sich kurz und deuteten eine Verbeugung an, was mit Lächeln und demonstrativem Applaus belohnt wurde. Nachdem sich alle wieder gesetzt hatten, übernahm Debries wieder das Wort.
„Wie Sie sehen können, sind wir für ein beachtliches Stück Grenze verantwortlich. Direkt südlich von uns ist sie nur fünf Meilen entfernt und erstreckt sich fünfzig Meilen nach Osten und dreißig Meilen nach Westen. Dort, im Westen, weicht sie dann, ungefähr auf Höhe von Trail Crossing, schlagartig um rund fünfundsechzig Meilen nach Süden zurück, ungefähr bis auf Höhe der kleinen Ansieldung Bancroft. Ab dort verläuft sie wieder direkt nach Westen und zwar für weitere siebzig Meilen. Das sind so ungefähr zweihundertzwanzig Meilen Grenze, wozu natürlich noch unser eigentliches Patrouillengebiet im Norden und Westen gehört, welches bis zur Überlandstraße zwischen Derning und Lordsburg reicht.“
Debries machte eine kurze Pause, um die Größenordnung auf die Offiziere einwirken zu lassen. „Bereits seit Herbst des vergangenen Jahres nahmen die Probleme mit weißen und mexikanischen Banden zu, die über die Grenze nach New Mexico einfielen und hier Überfälle verübten. Hinzu kamen Gruppen von Apachen, die das Land zunehmend unsicher machten. Sie drangen sogar bis Fort Seldon vor, zogen sich dann aber mehr in unser Gebiet zurück. Wie Sie alle ja wissen, kam es vor wenigen Wochen zu zwei Gefechten. Einmal hier, an den Animas Springs, und einmal hier, auf dem westlichen Trail, wobei es auch direkte Angriffe der Apachen auf unser Fort und auf die Barrows Ranch gab. Letztlich schlug Major Selkirk sie vernichtend und zwang sie zum Rückzug nach Mexiko.“
Zustimmendes Gemurmel von den meisten Offizieren. Jene, die dabei gewesen waren, sahen sich weder von der Rolle des Majors noch von der These, der Feind sei vernichtend geschlagen, überzeugt.
„Inzwischen mehren sich die Anzeichen für erneute Aktivitäten der Apachen, während die Aktivitäten mexikanischer Banditen abzunehmen scheinen. Dafür bekommen wir es wohl vermehrt mit Gruppen von Deserteuren aus der konföderierten und auch der Unionsarmee zu tun. Aufgrund der bisherigen Ereignisse wurde unsere Garnison nun entscheidend verstärkt und ist erstmals in der Lage, ein dichtes Netz von Patrouillen in unserem Gebiet zu errichten.“ Jules Debries stellte den Zeigestab ab. „Über die weitere Planung wird Sie nun Major Selkirk instruieren. Major, Sir?“
„Danke, Mister Debries.“ Selkirk wandte sich in seinem Drehstuhl von der Karte zu den Offizieren. Sein Gesicht war ernst. „Gentlemen, Washington und die Armee erwarten Erfolge. Fort Coronado soll die illegalen Grenzübertretungen der mexikanischen Bandoleros und der Apachen verhindern und zusätzlich die umliegenden Siedlungen, Farmen und Ranches vor Übergriffen schützen. Wir sind nun endlich stark genug, dies auch zu gewährleisten. Uns stehen nun zwei volle Kavalleriekompanien zur Verfügung. Kompanie ‚H‘ der fünften US und Kompanie ‚B‘ der zweiten New Mexico Freiwilligenkavallerie. Ich habe mich entschlossen, die Patrouillenstärke auf fünfundzwanzig Mann festzulegen, stets unter Führung eines Offiziers und jeweils vier Patrouillen gleichzeitig hinauszuschicken. Drei zur Grenze und eine für den inneren Bereich. Damit bleibt eine volle Kompanie in Reserve, was uns die Möglichkeit gibt, mit aller Härte auf eine etwaige Bedrohung zu reagieren. Ferner behalte ich mir vor, zur gegebenen Zeit Vorposten einzurichten, die ich mit Infanterie besetzen werde. Mister Baxter, Sie haben eine Frage?“
Captain William Baxter war Kommandant der „B“-Kompanie und hatte sich am vorherigen Abend mit Mark Dunhill bekannt gemacht und mit diesem ausgetauscht. „Ja, Sir, die habe ich. Wie ich erfuhr, geht man davon aus, dass die Siedlung Bancroft mit den Apachen Handel treibt.“
Selkirk zögerte einen Moment mit der Antwort. „Ja, wir vermuten das. Bedauerlicherweise liegen uns keine handfesten Beweise vor, um gegen Bancroft vorgehen zu können.“
„Das heißt, wir lassen Bancroft gewähren?“, hakte Baxter nach.
Selkirk errötete. „Wie ich schon sagte, können wir ohne Beweise nicht gegen die Siedler dort vorgehen. Natürlich sehen unsere Patrouillen dort immer wieder nach dem Rechten, aber bislang haben sie nichts gefunden, was eine Schuld der Leute dort belegen würde.“
Debries sah sich genötigt, seinem Vorgesetzten beizustehen. „Die einzigen Hinweise sind ein paar Wagenspuren, die wir fanden.“
Das war jetzt für Mark neu. „Wagenspuren? Darf ich fragen, wo diese gefunden wurden?“
„Sie wurden damals von Captain Harrington entdeckt“, antwortete Selkirk ein wenig unwirsch.
Damals … Es war erst wenige Wochen her, dass Captain Harrington unter der Folter der Apachen gestorben war und schon wurde er zu einem Bestandteil der Geschichte, an den man sich im Fort nur ungern erinnerte. Bei Selkirk war dies möglicherweise verständlich, denn seine Weigerung, den Forderungen der Apachen nachzugeben, hatte letztlich zum Tod des Offiziers geführt. Allerdings traf den Major im Grunde keine Schuld, denn er hätte dem Ansinnen der Chiricahua nicht nachgeben können.
Mark wollte sich mit der knappen Antwort seines Vorgesetzten nicht zufrieden geben. „Also von Harrington … Hat der Captain Vermutungen zu diesen Wagenspuren geäußert? Und wo genau hat er sie entdeckt?“
Selkirk warf Mark einen finsteren Blick zu, dann nahm er den Zeigestab und kreiste einen Bereich auf der Karte ein. „Ungefähr hier, in dieser Gegend. Mister Debries?“
Erneut fügte der Adjutant ein paar Informationen hinzu. „Ich kann mich noch gut an den damaligen Rapport von Mister Harrington erinnern. Er fand die Spuren zweier schwerer Fuhrwerke, ungefähr zehn Meilen westlich von Bancroft in den südlichen Ausläufern der Animas Mountains. Eine hoch gelegene Senke, von der aus man einen recht guten Rund-um-Blick hat und die selbst, durch die umgebenden Felsen, schwer einsehbar ist. Dazu die Hufabdrücke von etwa zwanzig unbeschlagenen Pferden.“
„Konnte Harrington herausfinden, woher die Wagen wahrscheinlich kamen und wohin sie verschwunden sind?“, schaltete sich Ted Furbanks ein, der Marks Zweiter im Kommando war.
„Es gibt nur einen Pfad auf dieses Plateau. Der führt in Richtung auf Bancroft, trifft aber vorher auf den westlichen Trail. Es lässt sich also nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die Wagen aus Bancroft stammten oder von jenseits der Grenze kamen.“
Selkirk nickte und klopfte mit dem Zeigestab gegen die Karte. „Gentlemen, wenn Sie Ihr Augenmerk einmal hierher richten … Das hier ist die mexikanische Siedlung Santa Rosa. Ein größeres Dorf, würde ich meinen. Angeblich soll man dort intensiven Handel mit allen möglichen Leuten treiben und Waren aus Mexiko und auch Texas beziehen.“ Der Major lehnte sich zurück und legte die Fingerspitzen aneinander. „Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass die Greaser Handel mit den Apachen treiben. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Mexikaner ihre Niederlage im Krieg gegen uns nicht überwunden haben.“
„Kann man nichts dagegen unternehmen?“, erkundigte sich Lieutenant Horner von der „E“-Kompanie der Infanterie.
„Was wollen Sie denn dagegen tun?“, knurrte Selkirk. „Etwa einmarschieren und eine neuen Krieg entfachen?“
Horner errötete und schüttelte schweigend den Kopf.
Der Major ließ ein leises Schnauben hören. „Gentlemen, die Lage in Mexiko ist ausgesprochen unübersichtlich. Das Land nennt sich inzwischen Kaiserreich Mexiko und wird von Maximilian I. regiert, einem Protege des Franzosenkaisers Napoleon III., der ihn auch mit Truppen unterstützt. Der Kaiser ist höchst unbeliebt und wird vor allem von den Juaristas, den Anhängern des ehemaligen Präsidenten Benito Juarez, bekämpft. In Mexiko gärt es und beide Seiten kämpfen mit unversöhnlicher Grausamkeit. Da sind die Apachen nur das Tüpfelchen auf dem i. Gentlemen, ich muss hoffentlich nicht erwähnen, dass wir die Grenze nach Mexiko unter gar keinen Umständen überschreiten dürfen. Dies könnte zu einem erneuten Krieg führen.“
„Sir, unabhängig von der Herkunft der Wagen“, meldete sich nun Captain Butler, von der „E“-Kompanie der Infanterie, zu Wort, „wenn diese Wagen wirklich etwas mit Waffenhandel zu tun haben … Besteht nicht die Möglichkeit, ihnen eine Falle zu stellen? Sie auf frischer Tat zu ertappen? Ich möchte wetten, mit einem Strick um den Hals würden die Burschen sicherlich gesprächig.“
Zustimmendes Gemurmel und Selkirk nickte bedächtig. „Ein verlockender Gedanke. Hat einer der Herren einen Vorschlag, wie wir das bewerkstelligen können?“
Das einsetzende Stimmengewirr verriet, dass es sogar mehrere Vorschläge zu geben schien.
Kapitel 4 Goldene Steine
Geheimes Apachenlager, im Grenzgebiet zwischen New Mexico und Mexiko.
Das Lager der Chiricahua-Apachen unter ihrem Häuptling Tse-tsij, Standing Rock, lag in den nördlichen Ausläufern der San Miguel Mountains. Hier, im Norden von Mexiko, war die Landschaft sehr abwechslungsreich. Trockene Bereiche, in denen Sand, Steine, Mesquite-Sträucher und Saguaro-Kakteen dominierten, lösten sich mit fruchtbaren Landstrichen ab, in denen es dichten Grasbewuchs, kleine Wälder und sogar Teiche und Seen gab, in denen ertragreiche Felder von Bachläufen durchzogen waren.
Die Chiricahuas verfügten in den San Miguel Mountains über ein sehr großes und im Grunde auch sehr sicheres Lager. Schon mehrfach hatten mexikanische Truppen versucht, es ausfindig zu machen und zu zerstören und sie alle waren unter hohen Verlusten gescheitert. Selbst die im Norden Mexikos lebenden Yaqui-Indianer erlitten mehrere Niederlagen und fürchteten die Apachen, ja unterwarfen sich ihnen teilweise sogar. Immer wieder war es den Apachen gelungen, ganze Landstriche zu erobern und die Furcht vieler Mexikaner war so groß, dass sie insgeheim Handel mit ihnen trieben und sie vor Bewegungen der eigenen Armee warnten.
Tse-tsij war nicht nur alt und grauhaarig, sondern auch zäh und erfahren. Es gelang ihm immer wieder, Bündnisse zwischen den einzelnen Horden der Apachenstämme zu schmieden. Der letzte Versuch, die Weißen in New Mexico zurückzudrängen, war jedoch gescheitert. Für die Chiricahuas kein Grund, den Krieg gegen die Weißen aufzugeben. Für sie war der Stamm der Jicarilla-Apachen ein warnendes Beispiel. Sie waren nach verlustreichen Kämpfen von den „Norte Americanos“ besiegt und zu einem Friedensvertrag gezwungen worden, den sie seitdem nie gebrochen hatten.
Das Lager in den Bergen lag in einem großen und von den umgebenden Felswänden gut geschützten Tal. Hier gab es Wasser, Gras für die Pferde sowie Anbauflächen für Mais und wildes Getreide, aus dem die Frauen Mehl machten und, ebenso wie aus Mais, Fladenbrot fertigten. In der näheren Umgebung gab es Wild und man konnte die Speisekarte auch durch die Rinder der Mexikaner ergänzen. Manche Ranch und manche Farm zollten den Apachen Tribut in Form von Viktualien. Waffen wurden eingehandelt oder erobert.
Tse-tsij wohnte in einem großen Wickiup. Es war eine Hütte aus Flechtwerk, in Form eines Iglus. Hier lebte der alte Häuptling mit seiner Frau und einer unverheirateten Tochter. Ein Sohn fand Unterkunft in einem der Wickiups für unverheiratete Krieger. Zwei Söhne waren verheiratet, hatten eigene Heime und dem Häuptling bislang drei Enkel geschenkt.
Der stolzeste Besitz von Tse-tsij waren fünf erstklassige Mustangs und zwei große braune Quarter Horses der Kavallerie, deren vorherige Besitzer keine Verwendung mehr für sie hatten. Wie alle Apachenkrieger verfügte der Häuptling über Pfeil und Bogen sowie mindestens eine Schusswaffe. Bei ihm waren es ein Army-Colt, Modell 1860, und ein Sharps-Karabiner.
Bei den letzten Kämpfen gegen die Weißaugen waren die Chiricahua in den Besitz von rund zwei Dutzend neuen Sharps- und sogar Spencer-Karabinern gelangt.
Auch Dit-laa, Bloody Hand, war stolzer Besitzer eines Spencers, doch seine Freude wurde von dem Umstand getrübt, dass man nur wenig Munition für diese Waffen besaß. Der Spencer benötigte eine spezielle Patrone, die sehr kurz und verhältnismäßig schwach war, so dass der Karabiner nicht die Reichweite und Durchschlagskraft anderer Karabiner aufwies, was er aber durch die hohe Feuergeschwindigkeit wettmachte.
„Es ist betrüblich, dass wir keine Munition für das viel schießende kleine Gewehr kaufen können“, stellte Tse-tsij mit einem Blick auf Dit-laa fest, der gerade zwei jungen Apachen die neuartige Waffe erklärte. Der Häuptling wandte sich zur Seite und sah nun Neez-geeh an. Der Long Shot genannte Krieger war einer der wenigen Scharfschützen und schwor auf das neue Springfield-Gewehr, welches er einem getöteten Infanteristen aus den Händen genommen hatte. „Wir sollten mit den Weißaugen reden, die uns Gewehre und Munition verkaufen. Sie werden einen Weg finden, uns die Patronen für die viel schießenden kleinen Gewehre zu besorgen.“
Neez-geeh nickte, doch K´os-k´aa, der Medizinmann schüttelte seine Rassel und drückte damit seine Missbilligung an.
„Du hast Zweifel, mein Bruder?“, fragte Neez-geeh überrascht.
„Wir sollten lieber mehr Patronen für die anderen Waffen einhandeln“, meinte der Medizinmann und schüttelte nachdrücklich die Kürbisrassel, in der sich ein paar Maiskörner bewegten. „Und weitere Gewehre.“
„Wir haben schon viele Gewehre“, lehnte nun Neez-geeh ab. „So viele Gewehre, dass jeder unserer Krieger zwei von ihnen besitzt.“
Sie hoben die Köpfe, als Schatten über sie fiel.
Ndi-zaaje, der eher schweigsame Krieger Talking Tall, kam mit seinem jungen Weib Nii-g´a herbei. White Cloud trug eine gebrannte Tonschale, in der eine Reihe jener Leckerbissen lag, die von Apachen geschätzt wurden.
Ndi-zaaje reagierte auf die letzten Worte von Neez-geeh. „Mein Bruder, die Chiricahuas haben tapfer gekämpft und den Weißaugen viele Gewehre abgenommen. Auch die Brüder anderer Horden, die mit uns kämpften, haben Gewehre genommen. Doch es gibt viele Brüder bei den Mescalero und anderen Stämmen, die tapfer mit uns kämpfen würden, wenn sie ebenfalls Gewehre besäßen.“
Ndi-zaaje schüttelte nun den Kopf. „Man kann auch mit Pfeil und Bogen kämpfen und oftmals ist der lautlose Pfeil viel besser als die schreiende Kugel.“
„Ayeeh“, stimmte Dit-laa grinsend zu, „und auch das Messer kann töten, wenn es gut geführt wird.“
Ndi-zaaje sah den Sprecher missbilligend an. „Ein jeder kennt die Leidenschaft unseres Bruders, das Blut des Feindes über seine Hand fließen zu lassen. Ein jeder kennt den unbestreitbaren Mut von Dit-laa. Doch um die Klinge in den Feind zu versenken, muss man ihm sehr nahe sein. Denke an den Kampf an den Animas Bergen zurück … Viele tapfere Brüder kamen den Weißaugen nicht nahe genug, um ihr Messer an ihnen zu wetzen. Nein, mein Bruder, wir brauchen Gewehre für die vielen Brüder, die noch zu uns stoßen werden.“
„Wenn unsere Brüder von den Mescalero oder Mimbreno wirklich kämpfen wollen, so steht es ihnen doch frei, sich die Gewehre von den Weißaugen zu holen“, hielt Dit-laa grimmig dagegen.
K´os-k´aa schüttelte die Rassel. „Hebt euren Zorn für die Langmesser und Marschiereviel der Weißaugen auf. Ndi-zaaje spricht recht, wenn er sagt, wir brauchen Gewehre für unsere Brüder.“
Häuptling Tse-tsij nahm sich etwas aus der Schale, die Nii-g´a schweigend herumreichte. Sie war eine gute Frau und würde nichts von dem verlauten lassen, was sie am Feuer des Häuptlings hörte. Für Nii-g´a war es eine Ehre, den Häuptling und seine Ratgeber bedienen zu dürfen, sie war keineswegs dazu verpflichtet. Manchmal überließ sie diese Arbeit ihrer weißen Sklavin. Auch diese würde kein Wort über das verlieren, was sie hörte. Nicht, weil sie das Idiom der Apachen nicht verstand, sondern weil man ihr die Zunge entfernt hatte.
„Wir brauchen weitere Gewehre und wir brauchen Munition“, sagte Tse-tsij nun entschieden. „Wir brauchen fertige Patronen in ihren metallenen Hüllen und wir brauchen Papier, Pulver und Blei für jene Waffen, bei denen wir die Munition selber anfertigen müssen. Das alles bekommen wir von den weißen Händlern.“
Neez-geeh konnte dem nur zustimmen. „Wir können alles bekommen, wenn wir den Weißaugen nur genug von dem gelben Metall geben.“
Dit-laa nickte auflachend. „Sie sind verrückt nach Gold. Es raubt ihnen die Sinne.“
Neez-geeh stimmte in das Lachen ein. „In diesen Bergen lassen sich viele Nuggets finden. Doch wir müssen darauf achten, dass die Weißen niemals erfahren, woher wir sie haben.“
Tse-tsij kannte die Begierde der Weißen, die von den Mexikanern geteilt wurde. Wenn diese jemals erfuhren, woher die Goldnuggets stammten, dann war auch dieses Lager nicht mehr sicher. „Dit-laa, du wirst mit einer Gruppe nach Ban-Croft reiten und den Weißaugen sagen, was wir haben wollen. Handele mit ihnen, du weißt, in ihrer Gier kennen sie keine Grenzen. Sage ihnen vor allem nicht, über wie viel Gold wir verfügen.“
„Keine Sorge, Tse-tsij, ich kenne die Weißaugen. Schon oft ist ihr Blut über meine Hand geflossen.“
Der Blick des alten Häuptlings war mahnend. „Zügle deine Hitze. Du wirst noch viele Gelegenheiten haben, das Blut des Feindes zu vergießen. Doch jetzt brauchen wir sie lebend, denn sie werden uns bringen, was wir brauchen, um sie letztlich alle zu töten.“
Marseillaise
Santa Rosa, Imperio Mexicano, im Grenzbereich zu New Mexico.
Die Juaristas von Benito Juarez waren fort und wieder hatte keiner von ihnen Verdacht geschöpft, es könne sich bei Santa Rosa um etwas anderes handeln, als ein Hort der Unterstützer des von Frankreich abgesetzten Präsidenten. Für die Bewohner des Dorfes war es ein bewährtes Spiel und ihre einzige Sorge bestand darin, dass sich eines Tages zwei der verfeindeten Gruppen in ihrem Ort treffen könnten. In den vergangenen zwei Jahren war eine solche kritische Situation nur ein einziges Mal eingetreten und sie hatten sie bereinigen können, in dem die Wache auf dem Torreon einfach behauptet hatte, der Feind rücke mit furchtbarer Übermacht an. So waren die Gäste hastig abgerückt und das einzige Problem im Dorf war es gewesen, das Willkommen rechtzeitig auf die anderen Besucher auszurichten.
Juanito Mendoza, der vierzehnjährige Sohn des Arztes, hielt gerade auf dem Torreon Wache. Seine Rufe hatten Emilio herbei gerufen. Und wie immer, wenn ein anderer Dorfbewohner Ausschau hielt, eilte auch Paolo besorgt herbei.
Padre Joaquin ließ die Glocke läuten, damit das Dorf erfuhr, dass man sich auf den Empfang einer noch unbekannten Gruppe einrichten müsse.
Die Mittagshitze lag brütend über Santa Rosa und auf den Feldern im Norden war die Arbeit eingestellt worden. Auf der südlich gelegenen Schaffarm trieb man hastig die Tiere in den Pferch und bereitete sich darauf vor, sich nötigenfalls in die östlichen Hügel in Sicherheit zu bringen, denn noch war unbekannt, wer sich da näherte.
„Eh, Juanito, wer kommt da?“, rief Emilio zur Turmplattform hinauf.
„Reiter!“, war die helle Stimme des Jungen zu vernehmen. „Viele Reiter!“
„Bueno, Juanito, doch was für Reiter?“
Paolo Lopez war bereits auf dem Weg nach oben, während Juanito versuchte, die Konturen in der Staubwolke zu deuten. Erleichtert vernahm er die Schritte von Paolo auf den Stufen der steinernen Rundtreppe.
„Manchmal blitzt es“, meldete der Sohn des Arztes verlegen und reichte das Teleskop weiter.
„Du hast es gut gemacht“, lobte Paolo und legte die Hand aufmunternd auf Juanitos Schulter. „Du hast uns rechtzeitig gewarnt und das ist sehr, sehr gut. Dein Vater Pepe kann stolz auf dich sein.“
Erleichtert und mit vor Eifer gerötetem Gesicht sah der Vierzehnjährige nun zu, wie der fähigste Beobachter das Instrument auf die südliche Straße nach San Felipe richtete. Die Erwähnung von Juanito, dass es in der Staubwolke gelegentlich aufblitze, war für Paolo ein wichtiger Hinweis. Sorgfältig stellte er die Schärfe nach.
„Eh, Paolo, mein Guter, wer ist es?“, drängte der Alcalde von unten.
Es eilte, denn die Reiter waren schon bedrohlich nahe. Dennoch nahm sich Paolo Zeit, ihm durfte kein Irrtum unterlaufen.
„Maldetto, Paolo!“