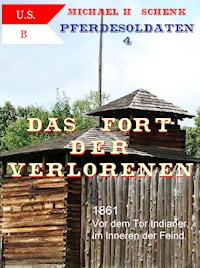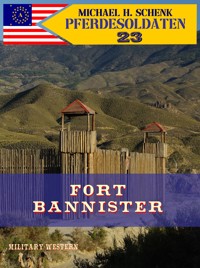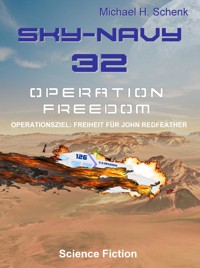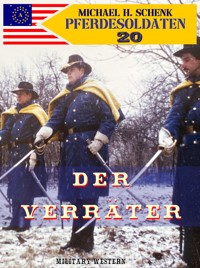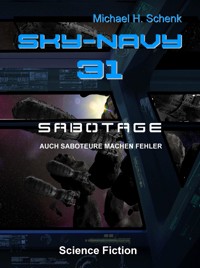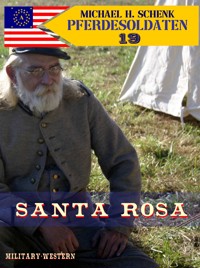1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
"Die Pferdesoldaten" bietet spannende Western aus der Zeit der nordamerikanischen Indianerkriege. Die in sich abgeschlossenen Abenteuer stellen die U.S. Reitertruppen in den Jahren zwischen 1833 und 1893 vor. Entgegen der üblichen Western-Klischees bietet der Autor dabei tiefe Einblicke in Ausrüstung, Bewaffnung und Taktiken, die sich im Verlauf der Jahre immer wieder veränderten. Schicke gelbe Halstücher und Kavallerie mit Repetiergewehren wird der Leser hier nicht finden, wohl aber Action mit einem ungewohnten Maß an Authentizität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael Schenk
Pferdesoldaten 21 - Die Vertriebenen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 Was bisher geschah
Kapitel 2 Die Patrouille
Kapitel 3 Die Vertriebenen
Kapitel 4 Hinterhalt
Kapitel 5 Gestörter Frieden
Kapitel 6 Vermisst
Kapitel 7 Überrascht
Kapitel 8 Heimliche Beobachter
Kapitel 9 Misstrauen
Kapitel 10 Im Hinterhalt
Kapitel 11 Die Entscheidung des Majors
Kapitel 12 Ungewissheit
Kapitel 13 An den Befehl gebunden
Kapitel 14 Die Nutzlosen
Kapitel 15 Aufbruch
Kapitel 16 Grenzpatrouille
Kapitel 17 Entscheidungen
Kapitel 18 Menschen, nicht Feinde
Kapitel 19 Eine furchtbare Entdeckung
Kapitel 20 Judge Taylor
Kapitel 21 Zu den Animas Springs
Kapitel 22 Tiefe Furchen
Kapitel 23 Der Transport
Kapitel 24 Im Apachenlager
Kapitel 25 Fremde Gesichter
Kapitel 26 Auf der Lauer
Kapitel 27 Das Für und Wider
Kapitel 28 Die neuen Gewehre
Kapitel 29 Die Unseren
Kapitel 30 Recht und Gerechtigkeit
Kapitel 31 Pläne
Kapitel 32 Karte Fort Coronado und Umgebung
Kapitel 33 Foto des Autors
Kapitel 34 Ankündigung
Kapitel 35 Von Markierung, Folter und Entführung
Kapitel 36 Allgemeiner Hinweis
Kapitel 37 Maße und Geschwindigkeiten
Kapitel 38 Persönliche Freiheiten in den Romanen
Kapitel 39 Verluste in den verschiedenen Kriegen
Kapitel 40 Bisher erschienen:
Kapitel 41 Hinweis: Für Freiheit, Lincoln und Lee
Impressum neobooks
Kapitel 1 Was bisher geschah
Pferdesoldaten 21
Die Vertriebenen
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2023
Der junge Captain Mark Dunhill ist in Fort Coronado, im Süden von New Mexico, stationiert. Ein Gebiet in dem Apachen, Banditen und Deserteure ihr Unwesen treiben. Diesen fällt es immer wieder leicht, über die Grenze ins nahe Mexiko zu entkommen, wo ebenfalls ein Krieg, zwischen den Anhängern von Benito Juarez und den Truppen des Kaisers Maximilian I., tobt. So fällt es Marks Kommandant, Major Selkirk, schwer, sich in den Augen Washingtons zu bewähren. Als Mark vor Kurzem auf Forderung eines kaiserlichen Offiziers hin an einer gemeinsamen Operation in der kleinen Stadt Santa Rosa teilnahm, hat sich das Verhältnis zwischen Mark und Selkirk verschlechtert.
Während sein Vater Matt weiterhin gegen die Konföderierten kämpft, sehen sich Mark und seine Kameraden einer erneuten Bedrohung durch die Apachen gegenüber. Abermals wird er vor der Wahl stehen, ob er einen ausdrücklichen Befehl des Majors ignorieren soll.
Kapitel 2 Die Patrouille
Am nördlichen Ausläufer der Four Fingers.
Es war der Februar des Jahres 1865.
Winter in New Mexico. Ein Winter, der im Gegensatz zu den nördlicher gelegenen Staaten im Grunde nur von Mitte November bis Mitte Februar andauerte. Die tägliche Höchsttemperatur lag in der Regel um 14° Celsius. Kalt genug für Schneefall war es eigentlich nur im Dezember, in dem die Temperaturen auf zwischen -2° Celsius und +9° Celsius sanken. Nun, im Februar, hatte sich der Schnee der Jahreswende längst aufgelöst. Doch der Wind konnte noch immer schneidende Kälte mit sich bringen,
Die beiden Reiter trugen die Uniform der Unions-Kavallerie und hatten sich eng in ihre himmelblauen Feldmäntel gehüllt. Die Kragen waren aufgerichtet und verhakt. Die gelb gefütterten Capes hatten die Männer nach vorne geschlagen und die langen Stulpen der Ärmel nach unten gekrempelt. Da den Soldaten keine Handschuhe zustanden, schützten die Männer die klammen Finger und die Schlösser ihrer Karabiner auf diese Weise vor der beißenden Kälte. Die Reiter gehörten zur Kompanie „A“ der ersten New-Mexico-Freiwilligenkavallerie. Ihre Einheit war in Fort Coronado stationiert. Sie waren Teil einer siebenköpfigen Patrouille, die routinemäßig die Grenze nach Mexiko kontrollierte.
Die Grenze verlief rund fünfzehn Meilen südlich des Forts. Sie erstreckte sich fast dreißig Meilen nach Westen, bevor sie, im rechten Winkel, rund fünfzig Meilen direkt nach Süden und dann wieder nach Westen verlief. Der weitere Grenzverlauf lag im Gebiet anderer Stützpunkte. Grob gesehen mussten die sieben Kavalleristen eine Strecke von einhundertvierzig Meilen nach Westen und Süden, und zusätzliche sechzig Meilen nach Osten, in Richtung auf Texas, zurücklegen. Im Wechsel von Schritt und Trab sowie den erforderlichen Pausen und Nachtruhen, kehrte die Patrouille somit erst nach zehn Tagen ins Fort zurück. Zehn Tage, in denen es keine Unterstützung gab.
Der große Patrouillenbereich von Fort Coronado war ein Indiz dafür, wie schwach die Grenze nach Süden gesichert wurde. So fiel es Deserteuren, Banditen und Apachen leicht, sie zu überqueren und den Patrouillen auszuweichen. Noch immer befand sich die Union der Nordstaaten im Bruderkrieg mit der Konföderation der Südstaaten. So gab es einfach nicht genug Truppen zur dichten Überwachung der Grenze. Inzwischen machte sich allerdings die Hoffnung breit, dass der unselige Konflikt bald enden werde. Bis es so weit war, mussten die Grenztruppen jedoch mit ihrer Situation zurechtkommen.
Das Grenzgebiet wirkte in diesem Abschnitt auch ohne Schnee ein wenig unwirtlich. Zwar gab es in New Mexico auch herrliche Waldgebiete und fruchtbares Land, aber hier, im südlichen Grenzbereich, wuchsen weit weniger Bäume. Sträucher und Gräser gediehen in dem oft sandigen Boden weit besser. Vereinzelt breiteten sich aber auch hier jene Kakteen aus, wie sie vor allem im Norden Mexikos so typisch waren. Die Landschaft wurde von Hügeln, Bächen und Flüssen durchzogen, die meisten waren jedoch versiegt oder zu Rinnsalen geworden. Die Kenntnis von Wasserquellen, den „Springs“, war überlebenswichtig, ebenso wie die Fähigkeit, auf jedem Ritt die Augen offen zu halten und wachsam zu sein.
Es war nur wenige Monate her, dass große Apachengruppen die Grenze unsicher gemacht hatten, wobei sie den Truppen erhebliche Verluste zufügen konnten. Seit etlichen Wochen herrschte jedoch Ruhe. Kein Feind ließ sich blicken.
Gerade diese Ruhe machte die Patrouille jedoch nervös. So schickte der Sergeant zwei Privates der kleinen Patrouille voraus, als auf der linken Seite des Trails die typische Formation der „Four Fingers“ auftauchte.
Die vier Finger waren ein lang gestreckter Berg, der diese Bezeichnung eigentlich nicht verdiente, da er nur wenige Dutzend Yards an Höhe maß. Es war also eher ein lang gestreckter Hügel mit steilen Hängen, umgeben von größeren und kleineren Felsgruppen. Den Namen trug die Erhebung auf Grund von vier steil emporragenden Felsnadeln, von zwei Dutzend Yards Durchmesser und fast zweihundert Yards Höhe. Mit etwas Fantasie konnte man die Formation als auf dem Rücken liegende Hand interpretieren, von der vier Finger ausgestreckt emporragten.
Das östliche Ende der Four Fingers lag knapp acht Meilen hinter der Grenze, auf mexikanischem Gebiet. Die nördlichste Ausdehnung ragte jedoch fünfhundert Yards auf das Hoheitsgebiet der U.S.A. und war ein wichtiger Orientierungspunkt. Ein gut erkennbarer Trail führte vom US-amerikanischen Boden nach Mexiko hinein und endete an der Kleinstadt Santa Rosa. Dort, wo die Felsformation auf amerikanischen Boden lag, gab es eine Vielzahl großer und kleiner Felsgruppen, die den Trail auf beiden Seiten säumten. Eine günstige Gelegenheit für einen Hinterhalt.
Die beiden Vorhutreiter waren sich der Gefahr bewusst, dennoch verzichteten sie darauf, die Hähne der Sharps-Karabiner zu spannen. Die Waffen mussten unter allen Umständen vor dem Sand geschützt werden, der den Kavalleristen ins Gesicht blies.
Die Männer waren erfahren und vorsichtig. Vor den für einen Hinterhalt besonders gut geeigneten Stellen zügelten sie ihre Pferde, betrachteten misstrauisch die Ränder des Trails und die wenige Yards entfernten vorderen Felsen.
In diesem Moment bedauerten sie auf besondere Weise, dass ihre Kompanie erst zur Hälfte mit den siebenschüssigen Spencer-Karabinern bewaffnet war. Sie selbst mussten sich mit den Sharps begnügen. Instinktiv und nahezu gleichzeitig langten sie an die Verschlüsse der Armeeholster, öffneten die großen Klappen und lockerten den Sitz der Colts vom Typ New Model Army.
„Du nach rechts, ich nehme die linke Seite“, meinte einer der Privates.
Der andere drehte sich halb im Sattel um. Die fünf übrigen Reiter der Patrouille befanden sich nur vierhundert Yards hinter ihnen, dennoch führte der Wind manchmal so viel Sand mit sich, dass man kaum dreihundert Yards weit sehen konnte.
„Okay, Pete, und halte die Augen offen“, stimmte der zweite Kavallerist zögernd zu.
Die Männer trennten sich. Der bequemere Weg führte sicherlich auf dem Trail entlang, doch sie nahmen ihre Aufgabe ernst. Zwischen den Felsen zu reiten, erhöhte die persönliche Gefahr, zugleich aber die Sicherheit der Patrouille, die auf diese Weise nicht so schnell überrascht werden konnte.
Für einen Moment war die Sicht auf die Kameraden kaum getrübt. Pete hob den Karabiner und signalisierte mit der Waffe, dass die Vorhut ausschwärmen würde.
Petes Kamerad ritt bereits nach links und erreichte die Felsen, die entlang der Four Fingers standen, Pete selbst lenkte sein braunes Quarter Horse rund zwanzig Yards nach rechts.
Die Blicke der Männer glitten über die Landschaft, suchten nach Spuren und der Anwesenheit eines möglichen Feindes. Nur gelegentlich und eher aus den Augenwinkeln, traf der Blick den Kameraden.
Pete war angespannt. Das Gefühl sagte ihm, dass hier Gefahr lauerte, doch es war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Er erreichte eine Stelle, an der er sich zwischen hoch aufragenden Felsen befand, die ihn den Blicken des Kameraden entzogen. Instinktiv konzentrierte er sich auf die Oberseiten der Felsen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Apache sein Glück versuchte, in dem er von oben auf einen Reiter hinuntersprang.
Der Angriff erfolgte von unten.
Dit-laa, Bloody Hand, machte seinem Namen alle Ehre. Der Krieger hatte sich unter einer mit Sand bedeckten Decke eingraben lassen. Mit der stoischen Geduld eines Apachen ertrug er die Kälte und bewegte ab und an die Muskeln, um sich geschmeidig zu halten. Jetzt nutzte er den Glücksfall, dass das verhasste Weißauge tatsächlich direkt auf ihn zukam. Dit-laa sprang auf und reckte beide Arme vor dem Kopf des Pferdes empor. Das erschrockene Tier wieherte und stieg steil auf, wobei Pete den Halt verlor und rücklings aus dem Sattel stürzte. Mit einem Satz war Dit-laa beim Feind und rammte diesem die breite Klinge des Messers in die Kehle. Pete war sofort tot und sein Blut benetzte die Hand seines Mörders.
Während sich das gut trainierte Kavalleriepferd sofort wieder beruhigte, knöpfte der Apache Koppel und Feldmantel des Getöteten auf und zog sich beides über. Verächtlich auf die Leiche spuckend, setzte der Krieger das Bummers-Cap auf sein schwarzes Haar, das von einem Stirnband zusammengehalten wurde.
Schon zog sich Dit-laa in den McClellan-Sattel, nahm den Karabiner des Kavalleristen in die Hand und trieb das Pferd rasch an, um die verlorene Zeit des toten Vorhutreiters wieder aufzuholen.
Dem Kameraden von Pete erging es nicht anders. Bei ihm war es jedoch eine Schädelkeule, die sein Schädeldach zertrümmerte und ihm den Tod brachte.
Die beiden Apachen lenkten die Pferde wieder auf den Trail zurück, mit den Feldmänteln und Kepis der Kavalleristen getarnt.
Wind und Flugsand verhinderten, dass der Sergeant und die anderen vier Patrouillenreiter die Vorkommnisse bemerkt hatten. So blieb ihnen auch verborgen, wie sich zwei Dutzend Apachen näher an den Trail heranschoben.
Für die Kavalleristen war es Pete, der ihnen mit seinem Karabiner signalisierte, dass alles in Ordnung sei und so ritten sie ahnungslos in den Hinterhalt.
Kapitel 3 Die Vertriebenen
Konföderierter Siedler-Treck, einige Meilen östlich der „Four Fingers.
Der Winter war die denkbar schlechteste Zeit, sein Heim aufzugeben und sich auf eine lange Reise zu begeben. Auch wenn in New Mexico kein Schnee lag, so fanden die Zugtiere der Wagen, die Pferde der Reiter und das mitgeführte Vieh allenfalls ein karges Futter.
Doch die Angehörigen dieses Trecks hatten vorgesorgt und führten entsprechende Vorräte mit. Gerade die für Siedlertrecks so unpassende Zeit bewog sie alle, sich genau jetzt ihren Weg zu suchen. Sie waren Texaner und es waren Not und Krieg, die sie zu Vertriebenen machte.
Der Treck bestand aus knapp dreißig Wagen. Allesamt größere und kleinere Gespanne, deren Planen, zum Schutz gegen Kälte und Flugsand, fest verzurrt waren. Auf den Böcken saßen Männer und Frauen, und es spielte keine Rolle, wer von ihnen die Zügel führte und wer eine Waffe bereithielt. Die Frauen hatten im Krieg auf die harte Weise gelernt, unverzagt zuzupacken oder sich selbst zu verteidigen.
Im Schutz der Planen verbargen sich Kinder und jenes Hab und Gut, dass diesen Menschen einen Neuanfang ermöglichen sollte. Dazu ausreichend Vorräte, Viehfutter und Wasserfässer, letztere an den Seiten der Planwagen angebunden. Sie wurden bei jeder sich bietenden Gelegenheit nachgefüllt.
Das Ende des Krieges zwischen den Staaten zeichnete sich ab. Keiner hatte noch ernsthafte Zweifel, dass der Norden gewinnen würde. Dass gierige Yankees über die alte Heimat im Süden herfallen würden. Nein, von ihnen wartete niemand ab, bis die „Carpetbaggers“ aus dem Norden einfielen. Sie brannten ihre kleine Siedlung nieder, verließen sie, suchten eine neue Heimat und ihre Hoffnungen ruhten auf Kalifornien.
Sie waren Farmer, Rancher, Schuhmacher, Schmiede sowie Vertreter anderer Berufe. Sie würden in der Lage sein, eine neue und lebensfähige Gemeinschaft aufzubauen, wenn sie nur ein geeignetes Stück Land fanden.
Der Treck führte Rinder und Ersatzpferde mit sich, große Hunde begleiteten die Wagen. Einige von ihnen waren Hütehunde, die gelernt hatten, die Herden zusammenzuhalten. Diese Vierbeiner wurden von einigen Reitern unterstützt.
Der Treck umfasste dreißig Ehepaare und über zwanzig Kinder verschiedenen Alters. Jetzt, am frühen Vormittag, befanden sich alle zum Unterricht auf drei der Wagen. Dieser wurde von der Lehrerin Geraldine und zwei der Frauen abgehalten.
Neben diesen rund achtzig Personen bestand der Treck noch aus einer zweiten und ebenso starken Gruppe. Allesamt Männer und alle von ihnen ehemalige Soldaten der Konföderation der Südstaaten. Sie waren keine Deserteure, sondern ehrenhaft oder wegen Verwundung oder auch Altersgründen aus der Armee ausgeschieden.
Brian Brenner, ehemaliger Colonel, hatte den linken Unterarm eingebüßt. Die Wunde war verheilt und wurde von einer Stumpfkappe mit speziellem Haken bedeckt. Er war nun vierzig Jahre alt, sehr hager und trug einen dichten und sauber gestutzten Vollbart. Er galt als skeptischer Mann, aber sehr fürsorglicher Treckführer. Da wo ihm der Haken nicht helfen konnte, tat dies Jedediah, ein großer und vor Kräften strotzender Afro-Amerikaner. Er hatte dem Colonel einst als Sklave gedient, war von diesem in die Freiheit entlassen worden und hielt ihm unverbrüchlich die Treue.
Der Treck mied den südlichen Trail, auf dem es regelmäßige Yankee-Patrouillen gab. Er bewegte sich dicht an der unsichtbaren Grenzlinie nach Mexico entlang. Tauchten Unionisten auf, so wollte man über die Grenze ausweichen, bis die Gefahr vorüber war. Den Vertriebenen erschien die Bedrohung durch den bisherigen Feind weit größer als das Risiko, einer mexikanischen Patrouille oder Bandidos zu begegnen. Man rechnete sich eine reelle Chance aus, einen solchen Gegner erfolgreich niederkämpfen zu können. Die meisten Banden würden sich ohnehin von der Stärke des Trecks abschrecken lassen. Selbst die größeren Knaben der Texaner konnten mit einer Waffe umgehen.
Die Männer und Frauen hielten sich, so gut es eben ging, warm und versuchten, sich vor dem steten und schneidenden Wind zu schützen. Die meisten trugen mit Pelz oder Fell gefütterte Jacken und wollene Schals, an den Händen waren oft die von den Frauen gefertigten Handschuhe zu sehen. Decken umhüllten die Beine der auf den Wagenböcken sitzenden Personen. Auch einige Reiter der Eskorte verwendeten zivile Jacken, die meisten jedoch die grauen Feldmäntel der Konföderation. In den drei Wagen mit den Kindern begegneten kleine holzbefeuerte Öfen der Kälte. Ihre dünnen Kaminrohre führten durch Löcher, die man in die dicken Planen geschnitten hatte.
Brian Brenner, für alle immer noch der „Colonel“, war sich seiner Verantwortung bewusst und ein vorsichtiger Mann. Von seinen achtzig Reitern war die Hälfte für Vorhut, Nachhut und Flankenschutz eingeteilt. Brenner ritt mit zwanzig Männern vor dem ersten Wagen. Sein Stellvertreter, der ehemalige Lieutenant Hagen Dornberg, hielt sich mit weiteren zwanzig Reitern hinter dem letzten Gespann.
Nun löste sich Dornberg aus seiner Gruppe und trabte rasch an der Kette der Fahrzeuge entlang nach vorne, um sich mit seinem Braunen neben Brenner zu setzen.
„Colonel, Sir, wir müssten jetzt ungefähr auf Höhe von Fort Coronado sein“, begann Hagen Dornberg. „Diese Yanks sind uns gefährlich nahe.“
Brian Brenner erlaubte sich ein schwaches Grinsen. „Über das Fort sind wir schon hinaus. Es müsste jetzt zehn Meilen hinter uns liegen.“
„Dann können wir jeden Augenblick mit einer Patrouille rechnen“, knurrte Hagen.
„Yeah, aber das ist ja nichts Neues. Vorher waren es die Yanks aus Fort Bliss, jetzt sind es halt die aus Coronado. Macht für uns keinen Unterschied. Die Augen müssen wir so oder so offen halten. Das da vor uns, Lieutenant, sind übrigens die berühmten Four Fingers.“
„Dem Herrn sei Dank“, brummte Hagen. „Endlich die ersehnte Landmarke.“
„Eine rund zwölf Meilen lange Felsformation, die uns den Weg nach Mexiko versperrt, wenn wir sie erst links von uns haben“, meinte Brenner nachdenklich. „Wir müssen uns also gut überlegen, auf welcher Seite wir uns bewegen.“
„Hm, Sie meinen, wir sollten besser nach Mexiko hinein und die Four Fingers rechts von uns halten?“
„Nur wenn es erforderlich wird, Mister Hagendorn.“ Brian Brenner schob den grauen Feldhut in die Stirn, um die Augen besser zu schützen. Wie die meisten Reiter trug er noch Teile seiner Uniform, wozu Hut und Waffengurt mit Säbel gehörten. Vom langen grauen Uniformrock und dem Hut waren alle militärischen Zeichen entfernt. Die zivile Hose war auffällig rot und weiß längs gestreift. Wie alle Pferdesoldaten bevorzugte er Kavalleriestiefel mit flachen Absätzen. Da die Pferde regelmäßig geführt wurden, war das mit hochhackigen Stiefeln kein Vergnügen.
„Sehen Sie, Dornberg“, nahm Brenner den Faden wieder auf, „hier lauern die Yanks und in Mexiko sind es Indianer, Greaser und vielleicht auch Deserteure beider Seiten. Außerdem herrscht dort Krieg zwischen den Anhängern von Juarez und denen des Kaisers. Nein, ich möchte nur ungern nach Mexiko ausweichen. Darum habe ich Corporal Hastings ein gutes Stück vorausgeschickt, um den Trail rechts der Four Fingers zu erkunden.“
„Hastings ist ein guter Mann“, stimmte der ehemalige Lieutenant zu. „Falls es am Trail einen Hinterhalt oder eine Yank-Patrouille gibt, dann wird er das herausfinden.“
Sie waren keine militärische Einheit mehr und führten kein Feldzeichen. Brenner war jedoch glücklich, über zwei ehemalige Hornisten zu verfügen, die bei den beiden Hauptgruppen ritten. Im Falle einer Gefahr konnten ihre Hornsignale Leben retten. Einer von ihnen ritt stets in unmittelbarer Nähe des Ex-Colonels, meist vom treuen Jedediah flankiert, der mit seiner Schrotflinte in der Armbeuge verwachsen schien.
Brenner warf einen Blick zurück, auf den Bock des vorderen Planwagens, einem großen Conestoga. Das Achtergespann war bereits 1754 entwickelt worden und ähnelte den moderneren Prairieschonern, war jedoch deutlich schwerer und unhandlicher. Dieser Wagen wurde von Ben Brighton gelenkt, einem stämmigen Schmied, der zum Schutz der Hände grellrote Lederhandschuhe angezogen hatte. Obwohl das Lederzeug des Gespanns gut gefettet oder geölt wurde, waren die vor dem Aufbruch frisch geschnittenen Zügel noch unangenehm hart und schnitten in die Haut ein.
Eine Handvoll Gespannführer saß nicht auf dem Bock, sondern auf dem „Wheel Horse“, dem links, unmittelbar vor dem Wagen, eingespannten Pferd.
Neben Brighton saß seine blonde Frau Susan, eingehüllt in Mantel und Decke und eine Jagdflinte neben sich. Sie bemerkte Brenners Blick und winkte ihm lächelnd zu.
Die dreizehnjährige Tochter des Ehepaares, Kathy, saß mit anderen Kindern beim Unterricht.
Brian Brenner war stolz auf die Menschen des Trecks. Keiner beschwerte sich, gleichgültig, welche Schwierigkeiten sich ihnen schon in den Weg gestellt hatten, und auch die Kinder jammerten nicht. Alle akzeptierten den Verlust der Heimat und waren fest entschlossen, eine neue zu finden.
Bis vor wenigen Minuten trieb der Wind Sand und Staub über das Land, jetzt legte er sich und die Sicht wurde allmählich wieder klar. Man konnte das Land, wo seine Gestaltung es zuließ, wieder auf Meilen überblicken. Brenner war dankbar für den verschleiernden Sand gewesen, vor allem, als sich der Treck so nahe am Yankee-Fort bewegt hatte. Jetzt lag die Garnison hinter ihnen. Dafür ragte die beeindruckende Felsformation vor ihnen empor, die auf der Karte als Four Fingers eingetragen war.
Nicht jede Karte hielt, was sie versprach, doch Brian Brenner besaß eine Militärkarte, deren Eintragungen er vertraute.
„Noch nichts von Corporal Hastings zu sehen“, stellte Ex-Lieutenant Hagen Dornberg fest. „Das behagt mir nicht besonders. Wenn wir nicht bald seine Meldung erhalten, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir nördlich oder südlich der Four Fingers fahren. Auf dem Gebiet der Billy Yanks oder dem der Greaser.“
Brian Brenner würde dies entscheiden müssen, denn er war der Treckführer und alle verließen sich auf seine Entscheidungen. Der Colonel wollte eine Abstimmung über den Weg vermeiden. Eine Abstimmung konnte leicht als Unsicherheit von ihm gedeutet werden und das konnte sich ein Anführer, nach seiner festen Überzeugung, nicht leisten.
„Staub voraus, Sir“, meldete Dornberg, als sei dies unter den Umständen eine überragende Neuigkeit.
„Is da Coporal“, sagte Jedediah mit dem für ihn so typischen Slang und bewies wieder einmal seine scharfen Augen. „Hatta eilig.“
„Der Herr möge deine Augen segnen, alter Freund“, lobte Brenner seinen ehemaligen Sklaven. Er hob den Arm und die Kolonne hielt an, um auf die Vorhut zu warten.
Auch der ehemalige Corporal Daniel Hastings bewies seine außergewöhnliche Sehschärfe, als er sein Pferd zügelte, respektvoll salutierte und dann seine Meldung machte. „Yanks voraus, Sir. Ein paar Meilen vor uns verläuft diese Felsengruppe auf Yankeegebiet. Dort ist eine Engstelle, an welcher der Trail auf einer Seite von diesem Berg und auf der anderen von Felsen und Buschgruppen gesäumt wird. Ich konnte auf beiden Seiten Unionisten im Versteck lauern sehen.“
„Wie viele, Corporal?“, fragte Dornberg hastig, was ihm einen mahnenden Blick des Colonels eintrug.
„Gesehen habe ich nur sieben, Sir, und die auch nur, weil sie neugierig genug waren, die Köpfe mit den Feldmützen immer wieder hervorzustrecken.“ Hastings grinste. „Aber wo sieben sind, da sind mit Sicherheit mehr.“
Brian Brenner nickte. „Die würden es niemals wagen, uns mit nur sieben Mann einen Hinterhalt zu legen. Nein, wir müssen davon ausgehen, dass dort eine ganze verdammte Kompanie auf uns wartet.“
Hastings strich sich über das Kinn. „Die brauchen uns nur ein wenig aufzuhalten, dann kommt ihre Verstärkung aus dem Fort und macht den Sack zu.“
„Yeah“, stimmte Brenner missmutig zu. „Mit den Frauen und Kindern können wir keinen Durchbruch wagen. Unter diesen Umständen bleibt uns keine Wahl. Wir müssen nach Mexiko ausweichen und die Four Fingers südlich umfahren.“
Brian Brenner sah nur in zustimmende Gesichter und so hob er erneut den Arm und gab das Zeichen, den Trail nach Süden zu verlassen.
Niemand im Treck ahnte, dass die Apachen eine Kavalleriepatrouille überfallen hatten, um die Südstaatler mit deren Uniformen zu täuschen und so dazu zu bringen, nach Mexiko auszuweichen.
Die Schlange der Reiter und Wagen sowie kleinen Herden schien sich quälend langsam zu bewegen. Auf dem Trail waren die Fahrspuren von vielen eisenbeschlagenen Reifen fest gepresst worden, jetzt schwenkten die Gespanne in den unberührten Sand von Mexiko. Was für alle Huftiere nun angenehmer sein mochte, machte es den Wagen schwerer. Der Boden war nicht gefroren. Unter der Fracht sanken die Radreifen mehrere Zentimeter ein und die Gespanne mussten sich stärker anstrengen.
Brian Brenner, Hagen Dornberg und einige Reiter verharrten und beobachteten die Vorbeiziehenden, wobei der Colonel ihnen aufmunternd zunickte.
„Wir werden langsamer vorankommen“, brummte der Colonel. „Der Boden ist nicht gefroren und für die Wagen eigentlich zu weich.“
„Unda Yänkis könna finda uns leichta, Boss“, fügte Jedediah hinzu. „Machta jeda Wagen gute Spuren, Boss.“
„Keine Sorge, Jedediah, die Yanks werden die Grenze nicht überschreiten“, versicherte der Colonel. „Mister Dornberg, sorgen Sie trotzdem dafür, dass die Nachhut unsere Spuren möglichst verwischt. Sie sollen Decken hinter sich herschleifen, das müsste bei dem losen Sand genügen.“
„Zu Befehl, Sir.“ Dornberg grüßte leger und trabte der Nachhut entgegen.
„Vielleicht wären wir doch besser erst im Frühjahr aufgebrochen, wenn der Boden wieder fest ist“, meinte einer der Begleitreiter.
Brenner nahm ihm die verborgene Kritik nicht übel. „Wäre mir auch lieber gewesen, Carl. Aber im Frühjahr rücken die Yanks wieder vor und wir wären vielleicht nicht mehr aus Texas herausgekommen.“
Erneut nahm der Colonel die Karte zur Hilfe und winkte Jedediah heran. „Auf gutem Weg schaffen wir mit den Wagen zwei Meilen in der Stunde. Bei diesem Untergrund wohl eher eine. Nach der Karte ist die östlichste Spitze dieser Four Fingers rund vier Meilen entfernt. Dann nochmals drei Meilen, bis wir sie so weit nach Süden umrundet haben, dass die Billy Boys uns nicht einmal mehr sehen können. Was meinst du, alter Freund?“
„Ista koräkt, Boss. Sieben oda acht Stunden, bis wir außa Sicht sind.“ Der grauhaarige Afro-Amerikaner schob die Schrotflinte in die andere Armbeuge und deutete nach Süden. „Abba wir mussan rechnen mit Grisa. Oda kaisaliche Patrulljen.“
„Mal den Teufel nicht an die Wand, alter Freund“, antwortete Brenner auflachend. „Bislang haben wir ja Glück gehabt.“
„Yeah, Boss, viel Gluck. Möge Jesus Christus arme Jededaija und fruhere Massa geben Beistand. Werde zu himmlische Massa beten, Boss.“
„Ein Gebet an den Herrn kann niemals schaden“, sagte Brenner ernst. „Aber nun lass uns den Wagen folgen. Ich will wieder an die Spitze, damit ich sehe, was auf uns zukommt.“
„Und Massa Dornbärg nicht verlaufa.“
Die beiden Männer lachten und setzten ihre Pferde nach Süden in Trab.
Nach drei Stunden Fahrt näherte man sich dem östlichsten Ausläufer der Four Fingers. Bislang hatten sich keinerlei Verfolger gezeigt. Nur einmal glaubte ein Reiter der Nachhut für einen flüchtigen Augenblick einen Yankee gesehen zu haben, doch der hatte sich noch auf dem Gebiet der Union aufgehalten.
„Sie folgen uns nicht über die Grenze“, stellte der ehemalige Sergeant-Major Wilbur Banks zufrieden fest, als Brenner und Dornberg die Nachhut abpassten.
Der Colonel zog abermals seine Karte zu Rate. Der Treck bewegte sich auf für ihn unbekanntem Territorium. Der Treckmeister musste sich auf die Wegmarkierungen verlassen, die auf der Karte eingezeichnet waren. „Fraglos haben uns die Billy Boys entdeckt, wagen sich aber nicht nach Mexiko hinein. Trotzdem gefällt mir das nicht. Wenn wir, wie geplant, die Four Fingers nur südlich umfahren und dann sofort wieder nach Westen schwenken, dann können sich die Yankees ausrechnen, wo wir ungefähr wieder auf die Grenze stoßen. Dort werden sie wohl erneut auf uns warten.“
Dornberg musterte die Karte. „Wir würden zwischen den Four Fingers und dem Border Hill auf Trail Crossing stoßen, dort, wo der südliche Trail scharf weiter nach Süden abknickt und wo der Abzweig des Trails nach Kalifornien führt.“
„Kalifornien ist unser Ziel, aber ich fürchte, genau damit werden die Yankees rechnen“, überlegte Brenner. „Wir sollten sie täuschen und davon überzeugen, dass wir in Wirklichkeit nach Mexiko wollen.“
Dornberg nickte. Er beugte sich zur Seite und tippte an eine Stelle auf der Karte. „Wir könnten zwischen dem Border Hill und den südlich gelegenen Cornel Mountains durchstoßen. Da kämen wir ungefähr auf halber Strecke, zwischen Trail Crossing und dem Ort Bancroft, wieder auf den Trail. Oder wir halten uns noch weiter südlich der Cornel Mountains und erreichen den Trail unterhalb von Bancroft.“
„Was uns aber ein gutes Stück über mexikanisches Gebiet führt.“ Brenner schüttelte nachdenklich den Kopf. „Mir reichen die Yankees, ich möchte mich nicht auch noch mit den Greasern oder Kaiserlichen anlegen. Nein, Mister Dornberg, wir versuchen es zwischen Trail Crossing und Bancroft. Stoßen wir auf Yankees, können wir immer noch weiter nach Süden ausweichen.“
Der Treck der Vertriebenen würde bald den Handelsweg zwischen dem amerikanischen Trail Crossing und dem mexikanischen Ort Santa Rosa erreichen. Dort wollte Brenner wieder nach Westen wechseln lassen und damit den leichter befahrbaren Trail der alten Handelsstraße nutzen.
Am Nachmittag befand man sich schon mehrere Stunden auf mexikanischem Territorium und die Abenddämmerung war nahe.
Brian Brenner sah missmutig zum Stand der Sonne empor und hob den Arm. Mit einiger Verzögerung kam die lange Schlange zum Stehen.
Hagen Dornberg trabte an Brenners Seite. „Sir?“
„Schätzungsweise noch eine Stunde Licht“, meinte der Treckmeister. „Ich würde Mexiko zwar lieber möglichst schnell verlassen, aber Mensch und Tier sind müde. Zeit, das Nachtlager aufzuschlagen. Lassen Sie die Wagen zu einer weiträumigen Wagenburg auffahren und treiben Sie möglichst viel Vieh und Pferde in ihren Schutz. Die Frauen sollen uns eine kräftige Mahlzeit zubereiten. Lassen Sie Ihre Gruppe Wachen aufstellen. Sobald die anderen gegessen haben, wechseln wir die Posten.“
„Zu Befehl, Sir.“ Hagen salutierte und begann am Wagenzug entlangzureiten, wobei er Fahrern und Begleitern die Anweisungen zurief.
Das erste Gespann zog gemächlich nach rechts, um mit dem Rund der Wagenburg zu beginnen.
Das war der Moment des Überfalls.
Kapitel 4 Hinterhalt
Siedler-Treck, Ostspitze der Four Fingers.
Unvermittelt tauchten Dutzende von Apachen zwischen den Four Fingers und dem Border Hill auf und bedrohten die rechte Flanke des Wagenzugs. Sie alle waren beritten und es schien rätselhaft, wie es den Kriegern gelungen war, sich bislang so gut verborgen zu halten. Sie mussten eine der Senken als Deckung genutzt haben.
„Indianer!“, brüllte einer der Flankenreiter und feuerte sein Gewehr ab. Während er damit begann, sein langläufiges Vorderladergewehr umständlich neu zu laden, brach beim Treck geordnetes Chaos aus.
Vorhut, Nachhut und der Flankenschutz der linken Seite behielten ihre Positionen bei, während sich die beiden größeren Gruppen von Brenner und Dornberg hastig zu der Wache begaben, die den Treck gewarnt hatte.
In großer Eile bemühten sich die Fahrer die Wagenburg zu bilden, während eine Handvoll Reiter und Hunde bestrebt waren, die kleinen Herden in den Schutz zwischen den Planwagen zu treiben.
Der indianische Kriegstrupp mochte an die achtzig Reiter stark sein. Er verharrte in gut einer Meile Abstand. Der Wind spielte mit den Haaren der Apachen und mit den Federn, die einige der Krieger an ihren Lanzen befestigt hatten. Neben den breiten Stirnbändern trugen einige eroberte Hüte oder Militärkepis. Die Männer hatten ihre Gesichter mit den für sie typischen Kriegsfarben bemalt. Manchmal war es nur ein breiter roter, gelber oder weißer Streifen, der sich über das Gesicht zog, manchmal war es halb oder sogar vollständig von Farbe bedeckt. Dem Kenner verrieten diese Bemalungen die Zugehörigkeit zum jeweiligen Stamm. Auch die Mustangs, kleiner als die Braunen der Weißen, waren teilweise bunt bemalt. Schweife bewegten sich unruhig. Im Licht der untergehenden Sonne waren Lanzen, Bogen, Gewehre und Karabiner zu erkennen.
Colonel Brian Brenner ließ die nun fast fünfzig versammelten Reiter der rechten Flanke eine weit auseinandergezogene Linie bilden. Die beiden Hornisten hielten sich an den Treckboss. Jeder der Siedler und ehemaligen Soldaten führte Gewehr, Karabiner oder Schrotflinte. In den Holstern steckten die Sechsschüsser. Meist waren es konföderierte Nachbauten des Colt Navy im Kaliber .36, Brenner und einige wenige besaßen den Remington New Model Army, dessen verstärkter Rahmen größere Ladungen im Kaliber .44 vertrug.
„Sinda Apaches“, stellte Jedediah fest und spannte die beiden Hähne seiner Schrotflinte.
„Yeah, das sind sie“, stimmte der Colonel zu. „Ich frage mich nur, was sie wollen.“
Einer der Reiter spuckte auf den Boden. „Was schon, Colonel? Die sind auf Blut aus, sonst hätten sie sich nicht so hübsch angemalt.“
Wenn es jetzt zum Kampf kam, dann musste er sich bis in die Dunkelheit der Nacht erstrecken. Im Allgemeinen hieß es, dass Indianer nicht in der Nacht kämpften, weil ihre Gefallenen dann nicht in die ewigen Jagdgründe fanden. Die meisten der Männer und Frauen um Brenner hatten bereits Erfahrung mit Apachen gesammelt und wussten, dass diese auch die Nacht nicht scheuten, wenn sie der Überzeugung waren, dass sich der Kampf dann lohnte.
„Achtzig bis hundert Krieger“, brummte Dornberg. „Das sind zu wenige, um sich im offenen Kampf gute Chancen gegen uns auszurechnen. Ich frage mich, warum die sich nicht einen ihrer berüchtigten Hinterhalte ausgedacht haben. Dann wäre ihre Aussicht auf Erfolg größer. Die Burschen wissen genau, dass sie hohe Verluste erleiden, wenn sie uns frontal attackieren wollen.“
Brian Brenner lächelte mit schmalen Lippen. „Wollen Sie sich den Redskins als Militärberater andienen, Mister Dornberg?“
Ein paar Reiter in der näheren Formation lachten.
Auch Hagen Dornberg grinste. „Ich frage mich nur, was dieser ebenso eindrucksvolle wie sinnlose Aufmarsch soll.“
Als sei dies das Stichwort für die Apachen gewesen, setzten diese sich in Bewegung. Ungeordnet und in einem großen Pulk galoppierten sie unter lauten Schreien auf die Gruppe um Brian Brenner zu. Sie wirkten umso bedrohlicher, da sie vor dem rötlichen Licht des Sonnenuntergangs ritten.