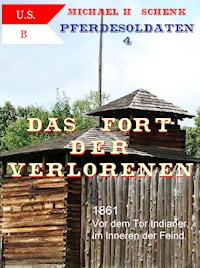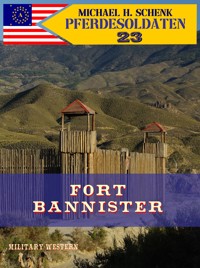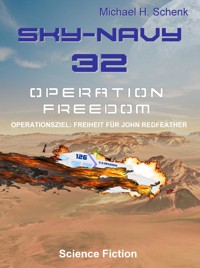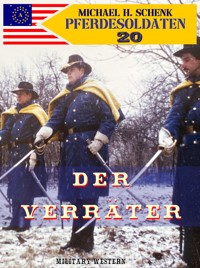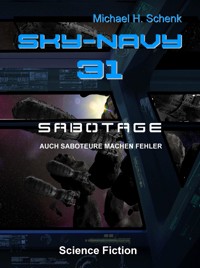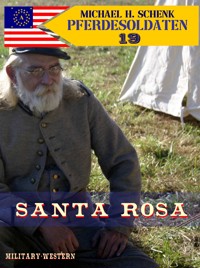2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zwerge der Meere
- Sprache: Deutsch
Für einen findigen Zwerg bieten die Meere viele Möglichkeiten. Vor allem, wenn man Vel Halkor heißt und der Eigentümer des kleinen Handelsschiffes "Wellenpfeil" ist. Mit seiner halbzwergischen Tochter Velara und dem krebsartigen Irghil Dan´Hargos gelingt es dem Zwerg immer wieder, das Auskommen der kleinen Besatzung zu sichern. Unter dem Schutz der Handelsflagge befahren sie die Meere und geraten dabei in den Krieg zwischen den Erenok und dem menschlichen Reich von Mean.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 867
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Velara
und das Reich der sieben Inseln
(Zwerge der Meere 2)
Fantasy
von
Michael H. Schenk
© Michael H. Schenk 2012/2024
Das Problem bestand nicht darin, einen der Dergo-Barsche zu finden. Die zwölf Meter langen Fische bevorzugten die seichten Gewässer der Hasgara-Inselkette. Die Schwierigkeit bestand vielmehr darin, in sein gewaltiges Maul zu gelangen, die wertvollen Rachenkristalle zu lösen und wieder zu verschwinden, bevor der Barsch zuschnappen konnte. Zwar waren diese Meeresbewohner eigentlich friedliche Pflanzenfresser, aber gelegentlich schätzten sie auch Fleisch, vor allem, wenn der leckere Happen gerade zwischen ihren Kiefern herumschwamm. Um an die kostbaren Dergo-Kristalle zu gelangen, benötigte man drei Dinge – die Schlafpause des Barsches, die eigene Schnelligkeit und einen Schnappstopper aus erstklassigem Zwergenstahl.
Die hölzernen Planken des Oberdecks waren durch die Sonne aufgeheizt. Es war fast zu heiß, um sie mit bloßen Füßen zu berühren. Velara tappte mit hastigen Schritten zur Backbordreling der Wellenpfeil und entkleidete sich, um rasch ins kühle Wasser zu gelangen. Auch der Handlauf war aufgeheizt und sie fluchte leise, als sie sich darüber schwang und ihre Füße auf die Außenbordleiter stellte. Der Schnappstopper in ihrer Hand schlug mit dumpfem Pochen gegen die Bordwand.
Velara befand sich in jener Phase, in der sich ein Mädchen zur Frau wandelt. Mit all den körperlichen und seelischen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Ihr Vater war sich nicht besonders sicher, ob sie nun dreizehn oder fünfzehn Jahre alt war, da dies von der Umrechnung der jeweiligen Zeitzone abhing. Eigentlich spielte es keine Rolle. Auch wenn es Unstimmigkeiten über ihr Alter geben mochte, so waren sich doch alle darin einig, dass sich Velara zu einer Schönheit entwickelt hatte. Sie war relativ groß und sehr schlank und wies schon jene weiblichen Formen auf, die bei Männern begehrliche Blicke hervorriefen. Bei den Männern der Menschen waren diese Blicke mit dem Wunsch nach spontaner Paarung verbunden, die Männer anderer Rassen bewunderten immerhin ihr Ebenmaß und wussten Schönheit anzuerkennen, wo sie diese erblickten. Menschenmänner wurden gelegentlich ein wenig zu aufdringlich. Velara begegnete dem mit einem freundlichem Blick und einem höflichen oder entschiedenen „Nein“ und, wenn dies nicht reichte, mit einem weit nachdrücklicheren Tritt. Die männlichen Wesen anderer Rassen wurden in der Regel nicht sonderlich zudringlich und wenn doch, so reichte es aus, wenn Steuermann Dan´Hargos ein wenig knurrte oder nachdrücklich mit seinen Scheren klapperte. Velara hatte die sanft gebräunte Haut, die man erhielt, wenn man sich lange auf See aufhielt, und bis auf die Hüfte fallende schwarze Haare. Wie gewöhnlich hatte sie diese zu einem langen Nackenzopf geflochten.
„Kind, sei vorsichtig.“
Am Heck der Wellenpfeil, wo sich das Steuerrad des Schiffes befand, stützte sich Velaras Vater auf die Handspeichen des Steuers und sah sie besorgt an. Die gedrungene Statur und seine Größe verrieten den Zwerg ebenso unzweifelhaft, wie die sorgfältig geflochtenen Bartzöpfe, die ihrem Besitzer bis fast zur Mitte der Oberschenkel reichten. Sein Alter war noch schwerer zu bestimmen als das seiner Tochter. Das Gesicht war von Wind und Wetter gegerbt und die Jahre hatten tiefe Furchen in die Haut gegraben. Das einst rot glänzende Haar war längst Schwarz geworden, doch die Augen von Vel Halkor blitzten noch immer schlau und unternehmungslustig.
Wenn man Tochter und Vater nebeneinander sah, war es offensichtlich, dass Vels Liebe nicht einer Zwergenfrau gegolten hatte. Es war ausgesprochen selten, dass sich ein Zwerg der Meere mit einem anderen Menschenvolk verband, doch es kam vor, und im Falle von Velara erwies sich das als Glücksfall.
„Ach, Vater, ich bin immer vorsichtig“, erwiderte sie lächelnd und überprüfte nochmals den Schnappstopper und den richtigen Sitz des Sammelgürtels. Der schmale Ledergurt mit den angenähten Taschen war im Augenblick ihr einziges Kleidungsstück.
„Du sagst immer, dass du vorsichtig bist“, brummte Vel Halkor. „Und dann gerätst du meist in größte Schwierigkeiten, aus denen wir dich nur mit Mühe herausholen können.“
„Du übertreibst, Vater.“
„Ja, das tut er“, ertönte ein tiefer Bass, der von einem zischenden Unterton getragen wurde. „Aber nur sehr wenig, kleines Mädchen.“
Dan´Hargos war eine beeindruckende Gestalt. Äußerlich glich der Steuermann einem drei Meter langen Krebs und er galt selbst im Volk der Irghil als ungewöhnlich groß. Die tiefblaue Farbe seiner Panzerung und die lange Form seiner tödlichen Scheren verrieten, dass er sich, gemessen an den intelligenten Krebsen, im besten Mannesalter befand. Die Irghil waren ein friedliches Händlervolk und verfügten über keine Stimmbänder. Sie formten ihre Laute durch das Aneinanderreiben von hornigen Gaumenplatten. Einige, darunter Dan´Hargos, verstanden sich darauf, die menschlichen und zwergischen Laute zu formen. Dabei wurde das „S“ von einem intensiven Zischen begleitet, an welches man sich erst gewöhnen musste, während das „R“ einen seltsam rollenden Klang erhielt. Der Steuermann gehörte zu den wenigen Gepanzerten, die mit den Gaumenplatten sogar die Betonung der Worte variieren konnten. Die drei langen Stielaugen waren auf Velara gerichtet und der Steuermann der Wellenpfeil hielt eine metallene Pfanne in den beiden Armen, die sich unterhalb der Mundöffnung seines gepanzerten Schädels befanden. Seine beiden Kampfscheren hatte er auf den Rücken gefaltet.
„Heute gibt es Parnat-Gulasch zum Mittag“, stellte der Krebs fest. „Du weißt, wie kompliziert es ist, das Gulasch zuzubereiten. Etwas zu viel Hitze, und es ist verdorben. Etwas zu wenig Hitze, und das Gift im Fleisch ist noch aktiv, und dann wird es eure Mägen verderben. Bring dich also nicht in Schwierigkeiten, kleines Mädchen, sonst ist das Mittagessen ruiniert.“
„Was ihr immer habt“, seufzte Velara. „Wollt ihr etwa selbst nach den Dergo-Kristallen tauchen?“
„Kind, ich muss mich um die verklemmte Steuerkette kümmern und Dan um sein Gulasch.“
„Euer Gulasch“, korrigierte der Krebs. „Ich mag so verbranntes Zeug nicht. Ich mag mein Fleisch roh.“
„Schön, unser Gulasch.“ Vel Halkor sah seine Tochter mahnend an. „Setz den Schnappstopper behutsam an und achte darauf … “
„Vater!“ Der Blick ihrer meergrünen Augen war empört.
Der Zwerg kapitulierte mit einem vernehmlichen Seufzer. „Sei einfach vorsichtig.“
Velara ließ sich sachte ins Wasser gleiten und genoss die Kühle, mit der es ihre nackte Haut zu umschmeicheln schien. Für einen flüchtigen Moment spürte sie den leichten Schmerz, als ihr Körper von der Lungenatmung auf Kiemenatmung umstellte. Die drei waagrechten Kiemenschlitze in ihrem Nacken würden sich nun sanft bewegen. Diese Kiemen waren ein Geheimnis, das von der kleinen Mannschaft der Wellenpfeil gut gehütet wurde.
Ihr Vater hatte eine der letzten Überlebenden der Ataner zur Frau genommen. Dieses Volk war vor wenigen Jahren mit seiner Insel versunken und nahm dabei seine zahlreichen Geheimnisse mit in den Tod. Die Ataner waren nie besonders beliebt gewesen und niemand bedauerte ihr Verschwinden. Dennoch hatte sich Vel Halkor ausgerechnet in eine Atan verliebt. Es war eine gegenseitige und glückliche Liebe gewesen, bis Velaras Mutter bei einem Sturm über Bord gegangen war. Vater und Tochter versuchten noch immer, ihre Trauer zu überwinden. Möglicherweise war dies der Grund, warum sich Vel Halkor so ausnehmend um seine Velara sorgte.
Die Geheimnisse des versunkenen Volkes lockten. Wenn man erfuhr, dass Velara und ihr Vater intensiven Kontakt zu ihm gepflegt hatten, würde man sicher versuchen, ihnen dieses Wissen zu entlocken. In dem Fall wäre es für beide auch kaum von Nutzen, darauf hinzuweisen, dass sie die Atan kaum zu Gesicht bekommen hatten, da die Besatzung der Wellenpfeil seit Velaras Geburt auf und von der See lebte. Atan war das Reich der Welt gewesen und hatte sie beherrscht. Die nördliche Seescheibe ebenso wie die südliche und sogar die unüberwindliche Tiefe, die dazwischen lag.
Velara bewegte sich ebenso sanft wie die Kiemendeckel in ihrem Nacken. Dergo-Barsche spürten, wie alle anderen Fische, die Bewegungen im Wasser, und Velara wollte sie nicht aufscheuchen. Als die Wellenpfeil in die Lagune eingelaufen war, hatten sie von Deck aus die mächtigen Barsche erkennen können. Fünf von ihnen lagen um eine der Korallenbänke und würden jetzt, um die Mittagszeit, ihr Verdauungsschläfchen halten. Wenigstens hoffte Velara, dass es so war. Ihre mächtigen Körper waren in dem kristallklaren Wasser gut sichtbar gewesen. Die grau gefleckten Leiber hatten sich deutlich von dem hellen Sand der Lagune abgehoben. Die Barsche benötigten keine Tarnung, denn keiner der Meeresräuber war hungrig und verwegen genug, sich mit einem Dergo anzulegen. Nun aber beabsichtigte Velara, einem von ihnen in das vier Meter lange Maul hineinzuschwimmen.
Velara liebte die Lagunen der Hasgara-Inselkette. Es war Süßwasser, kristallklar und es hatte immer eine angenehme Temperatur. Während des Tages kühlte das Wasser und in der Nacht, wenn die Sonne gesunken war, strahlte der feine Sand der Lagune die aufgenommene Wärme wieder ab. Das war auch der Grund, warum sich hier immer Dergo-Barsche finden ließen. In anderen Bereichen des Meeres war der Salzgehalt des Wassers höher. Dort konnte Velara manchmal nur mit geschlossenen Kiemen tauchen und somit nicht unter Wasser atmen. Es gab sogar einige Stellen, an denen das Salz so konzentriert war, dass es zu Verletzungen führte.
Velara liebte die See ebenso, wie ihr Vater dies tat. Vor allem unter ihrer Oberfläche. Die Vielzahl des Lebens faszinierte sie immer wieder aufs Neue. Sie konnte sich an der Menge der Farben und Formen berauschen, die Fische und Pflanzen ihren Augen boten. Zwischen dem hellen Sand der Lagune breiteten sich bunte Korallenstöcke aus. Dazwischen tummelten sich die großen und kleinen Fische. Einige wirkten fast grell in ihrer Farbenpracht und schienen stolz umherzuschwimmen, andere waren eher unscheinbar und suchten den Schutz ihres Schwarms. Mehrere kleine Krebse bemerkten Velaras Schatten und reckten ihr drohend die winzigen Scheren entgegen. Seepflanzen und Röhrenwürmer wiegten sich in der sanften Strömung des Gewässers.
Velara glitt leicht durch das Wasser. Sie hatte schon Schwimmen gelernt, bevor sie auf ihren Beinen laufen konnte. Jedenfalls behauptete ihr Vater das mit sichtlichem Stolz. Die junge Frau beschränkte sich auf die Bewegungen ihrer Beine und hielt die Hände ruhig, den Schnappstopper eng an den Leib gelegt, damit sie mit ihm nicht versehentlich gegen eine der Korallen stieß. Der ungewöhnliche Ton hätte die Barsche sofort alarmiert, denn sie hatten einen unangenehm leichten Schlaf.
Sie sah ihr Ziel vor sich. Einen großen Korallenstock, der eher einem Riff ähnelte und einem Schiff durchaus gefährlich werden konnte. Die Konturen der Dergo-Barsche hoben sich deutlich von den bunten Farben ab. Sie sahen bedrohlich aus, denn immerhin bestand ihr Körper zu einem Drittel aus dem riesigen Maul. Es wies keine Zähne auf, aber mehrere Reihen sehr scharfer Knochenplatten, mit denen die Barsche die Wasserpflanzen oder Korallen zerlegten und dann einsaugten. Was nicht verwertbar war, wurde ausgeschieden.
Dergo-Kristalle waren nicht verwertbar. Wenigstens nicht für die Barsche.
Eigentlich stammten diese Kristalle von abgestorbenen Kristallsäulen, deren Standort niemals entdeckt worden war. Die Barsche schluckten sie eher beiläufig mit anderem Fressbarem. Warum ausgerechnet die Kristalle nicht ausgeschieden wurden, hatte niemand klären können. Es interessierte auch nicht. Hauptsache, es gab diese Kristalle. Beim Volk der Erenok galten sie als hoch wirksames Aphrodisiakum und sie zahlten gutes Gold dafür. Gold, welches Velara, ihr Vater und die kleine Mannschaft gut gebrauchen konnten, denn es gab ein paar Dinge, die sie dringend erwerben mussten, um ihr Schiff intakt und gesund zu erhalten.
Früher hatte Velara geglaubt, die Augen von Fischen seien alle gleich. Inzwischen wusste sie es besser. Es gab runde und schlitzförmige Pupillen, und sogar Augen, die überraschend menschlich wirkten. Die Barsche hatten rötliche Pupillen und eine blaue Iris und ihr Blick wirkte freundlich. Im Schlaf waren sie halb geschlossen.
Velara wählte den größten der Barsche aus, da er ihr am nächsten war. Je länger sie zwischen den Kolossen schwamm, desto größer wurde die Gefahr, dass sie aufwachten. Jetzt, im Schlaf, hatten sie die Mäuler weit geöffnet. Eine seltsame Eigenheit, die Velara sich zu Nutze machen wollte. Bis vor wenigen Jahren hatten die Erenok selbst den einen oder anderen Kristall aus den Barschen geholt. Sie waren dabei wenig rücksichtsvoll vorgegangen und hatten die gutmütigen Meeresriesen getötet, um an ihre Beute zu gelangen. Mit ihren Waffen war ihnen das nicht schwer gefallen. Dies rächte sich schon bald, da die Erenok die Population der Dergo-Barsche in ihren Gewässern nahezu ausrotteten. Velara taten die Barsche leid, aber das brutale Verhalten der Erenok kam ihr und der Wellenpfeil zu Gute, denn es trieb die Preise drastisch in die Höhe. Es lohnte sich, die Kristalle zu erbeuten und dabei ein gewisses Risiko einzugehen.
Der Schnappstopper würde dieses Risiko in Grenzen halten.
Das Werkzeug war eine lange Metallstange, die man noch weiter ausziehen und arretieren konnte. An ihren Enden trugen sie gerundete Metallplatten, die den Kieferwölbungen der Barsche angepasst waren. In der Mitte befand sich ein Scharnier, mit dem sich der Schnappstopper blitzschnell entriegeln und zusammenklappen ließ. Zum einen sollte der arme Barsch nicht bis an sein Lebensende unter Maulsperre leiden, und zum anderen war die Anfertigung eines Schnappstoppers aufwändig und teuer.
Velara ließ sich behutsam auf den Grund der Lagune sinken, sodass sie aufrecht auf dem Sand stand. Sie achtete sorgsam auf Anzeichen, ob der Barsch vor ihr erwachen könnte. Doch sein Maul stand weit offen und Velara lächelte zufrieden, als sie das Blitzen von Kristallen entdeckte. Ein alter Barsch, dessen Kristalle noch nie geerntet worden waren. Dieser Tag würde sich wirklich lohnen. Vorausgesetzt, dass sie an die Kristalle herankam und sich wieder entfernen konnte, bevor ihr Besitzer zuschnappte. Aber dafür hatte sie ja den Schnappstopper.
Sie paddelte unmerklich mit den Füßen, ließ sich mit der sanften Strömung treiben. Die Barsche nutzten sie, damit ihnen im Schlaf frisches Wasser zugeführt wurde, Velara nutzte sie, um sich in das Maul des Riesenbarsches gleiten zu lassen. Sie hatte das schon mehrmals getan und doch war es eine äußerst beunruhigende Vorstellung, der Dergo werde es im falschen Moment schließen. Sie sah die beweglichen Knochenplatten, mit denen der Barsch seine Nahrung, und sicherlich auch Velara, mühelos zerkleinern konnte.
Diese war nun fast in dem Maul verschwunden und jetzt kam es auf Schnelligkeit an.
Mit einer gleitenden Bewegung richtete die junge Frau den Schnappstopper zwischen dem Kiefer des Dergo-Barsches auf, schlug die Arretierung nach oben und die Stange spannte und verkeilte sich.
„Jetzt wird er wild“, dachte Velara und hielt sich am Schnappstopper fest.
Der riesige Fisch erwachte mit einer Maulsperre und war sichtlich wenig begeistert. In den ersten Augenblicken versuchte er einfach seinen Kiefer zuzuklappen, doch als dies nicht gelang, wollte er den Fremdkörper durch ruckartige Bewegungen loswerden. Ein zwölf Meter langes Muskelbündel kann sehr beachtlich Rucken. Velara klammerte sich an der Metallstange fest, wurde wild hin und her geworfen und rutschte einmal schmerzhaft über eine der Knochenplatten hinweg. Sie spürte kaum Schmerz, so scharf war die Kauleiste, doch sie sah einen kleine Blutwolke aufsteigen und wusste, dass sie einen tiefen Schnitt am Bein erlitten hatte.
„Das ist nicht gut“, dachte sie. „Das ist überhaupt nicht gut.“
Die heftigen Bewegungen des Barsches wurden schwächer. Auch das hatte Velara bereits erlebt. Der Bursche hatte längst nicht aufgegeben, denn er musste den sperrigen Gegenstand wieder loswerden. Dazu würde der Dergo mit offenem Maul einen der Korallenstöcke rammen. Er war ein Fisch, doch das hieß nicht, dass er sich nicht zu helfen wusste. Velara musste zusehen, dass sie das Maul verließ, bevor sie im Magen endete.
Sie hielt sich mit einer Hand am Schnappstopper fest, streckte die andere aus und konnte die blitzenden Kristalle ergreifen. Sie waren in die Schleimhäute des Barsches eingebettet und wahrscheinlich war es nicht angenehm, dass sie ihre Beute dort heraus zog. Der Barsch reagierte mit erneuten Schlingerbewegungen, aber Velara wusste, worauf es ankam. In kürzester Zeit hatte sie die Kristalle an sich gebracht und in den Taschen des Gürtels verstaut.
Jetzt kam es auf den richtigen Augenblick und Winkel an. Der Barsch bewegte sich erneut und Velara spürte, dass der Fisch auf ein Ziel zu schwamm. Ein festes, ausgesprochen stabiles Ziel. Sie stellte sich mit dem Rücken zur Öffnung des Mauls und ging tief in die Hocke, umklammerte den Schnappstopper mit beiden Händen.
„Lass das verdammte Mistding bloß nicht klemmen“, dachte sie und schlug auf die Entriegelung.
Im gleichen Moment stieß sie sich mit aller Kraft ab.
Der Schnappstopper klappte zusammen, wurde von Velara mitgerissen und gleichzeitig schlossen sich auch die gewaltigen Kiefer des Barsches. Es war so knapp, dass die junge Frau vermutete, der Dergo habe ihr noch etwas Haut von den Zehen geschabt, während sie, praktisch vor seiner Nase, emporschoss. Es ging wirklich um Haaresbreite, aber sie schaffte es.
Der gewaltige Fisch, nun von der fremdartigen Sperre in seinem Maul erlöst, schoss erschrocken ins tiefere Wasser davon und ließ eine erleichterte Velara zurück.
Die Anspannung legte sich und sie tastete zufrieden an die gefüllten Sammeltaschen ihres Gürtels, während sie sich umsah, um sich zu orientieren.
Der Rumpf der Wellenpfeil hob sich deutlich von der Wasseroberfläche ab. Ihr Vater und die Mannschaft würden begeistert sein, welchen Fang sie gemacht hatte. Sicher reckte Dan´Hargos seine drei Stielaugen schon neugierig über die Reling, Gulasch hin oder her.
Über der Wasserlinie sah die Wellenpfeil wie ein gewöhnliches Schiff aus. Wie eines der zahlreichen kleinen Schiffe, die auf dem nördlichen oder südlichen Meer der Welt unterwegs waren, um Handel zu treiben, Passagiere zu befördern oder Fische zu fangen.
Die Wellenpfeil hatte einen relativ plump wirkenden Rumpf mit viel Stauraum für die Fracht und wenig Komfort für die Besatzung. Das Holz oberhalb der Wasserlinie war weiß gestrichen, darunter schimmerte der kupferne Beschlag, der gegen Algenbewuchs schützte. Das Deck hingegen hatte die natürliche Maserung des Holzes und wirkte vom häufigen Schrubben wie poliert. Handläufe und Aufbauten waren mit kunstvollen Schnitzereien versehen.
Rechts und links des Bugs waren fünfeckige Wappenschilder angebracht, die darauf hinwiesen, dass dieses Schiff von einem Zwerg befehligt wurde.
Im vorderen Drittel befand sich das kastenförmige Maschinenhaus mit dem grazilen Schornstein der Dampfmaschine, im hinteren Drittel der einzelne Mast mit dem ausladenden Rahsegel. Dazwischen war das kleine Beiboot festgezurrt.
Am Heck erhob sich das Ruderhaus. Es bot gerade genug Raum für den Steuermann Dan´Hargos und seinen voluminösen Panzerleib oder für Kapitän Vel Halkor, wenn dieser sich gemüßigt fühlte, seine geliebte und monströse Korallenpfeife zu rauchen. Die kleine Mannschaft des Schiffes war sich nicht immer sicher, ob ihr Kapitän oder die alte Dampfmaschine mehr Rauch produzierten. An der Heckreling hing die Handelsfahne schlaff von ihrem Flaggenstock.
Obwohl die Maschine das Schiff unabhängiger vom Wind machte, wurde sie nur selten genutzt. Zum einen kostete der Brennstein zu ihrem Betrieb gutes Gold und zum anderen liebte es die Mannschaft, zu spüren, wie ihr Schiff auf Wind und Wellen reagierte.
Allerdings gab es noch einen weiteren Grund und der war unterhalb der Wasserlinie verborgen.
Zum Schutz gegen Wurmfraß und Muschelbewuchs war das Unterwasserschiff, wie allgemein üblich, mit Kupfer beschlagen. Entlang des Kiels und am Heck befanden sich jedoch ungewöhnliche Scharniere, mit denen der Schiffsboden teilweise geöffnet werden konnte. Wenn man sehr genau hinsah, bemerkte man, dass die Wellenpfeil eigentlich aus zwei Rümpfen bestand, die man miteinander verbunden hatte, sodass sie lediglich wie ein einzelner Rumpf wirkten. Zwischen diesen Rümpfen verbarg sich ein besonderes Geheimnis, welches ebenso brisant war wie die Kiemen in Velaras Nacken.
Ein Röhrenrochen gehörte sicher zu den schnellsten und tödlichsten Säugetieren der Meere. Wenn er sein Maul öffnete, so konnte man das Beiboot der Wellenpfeil hineinrudern, ohne dabei anzustoßen. Schön, ein ganz klein wenig musste man die Ruder vielleicht einziehen, doch nur ein winziges bisschen. Mit diesem riesigen Maul sog der Rochen Wasser und Fische an. Die Fische landeten in seinem Magen, das Wasser stieß er hinten wieder aus. Durch sehr enge und flexible Körperöffnungen und mit hohem Druck, sodass sich der Röhrenrochen außerordentlich schnell bewegen konnte. Zwischen den drei Ausstoßöffnungen befand sich ein zwölf Meter langer, stachelartiger Schwanz. Sehr muskulös, sehr flexibel und außerordentlich tückisch, da er Stromschläge mit einer hohen Spannung austeilen konnte.
Eines der Geheimnisse der Ataner hatte darin bestanden, diese Röhrenrochen zu zähmen und als Antrieb für ihre Schiffe einzusetzen. Das Volk der Ataner hatte sich, obwohl durchaus menschlich, sowohl an Land, als auch im Wasser wohl gefühlt, und konnte sich als Einziges mit den Röhrenrochen verständigen. Dieses Geheimnis wurde nun im Rumpf, oder besser zwischen den Rümpfen der Wellenpfeil, bewahrt. Der Röhrenrochen des kleinen Handelsschiffes hörte auf den Namen „Ruderschlag“. Das war nicht besonders klangvoll und beeindruckend. Doch auf diese Weise schöpfte niemand Verdacht, wenn eines der Mannschaftsmitglieder versehentlich einmal diesen Namen fallen ließ, wenn fremde Ohren zuhörten.
Velara hatte die halbe Strecke zum Schiff bewältigt, als sie die Veränderungen bemerkte.
Wer einen guten Teil seines Lebens im Wasser verbracht hatte, spürte die Schwingungen, die ein großer und schnell schwimmender Körper hervorrief. Auch die Fische spürten es. Die Schwarmfische ballten sich zusammen und die anderen suchten den Schutz der Korallen.
Es gab nur einen Grund für solche Furcht.
Einer der großen Meeresräuber war auf Jagd.
Velara sah sich suchend um. Für einen Raubfisch war sie eine ideale Beute. Ein netter schmackhafter Happen, der bei Weitem nicht so schnell ausweichen konnte wie ein wirklicher Fisch. Zudem stellte die junge Frau betroffen fest, dass sie sich schon aus dem Grund als Festmahl anbot, da sie nunmehr ziemlich alleine in der Lagune zu schwimmen schien.
Sie verfluchte den Umstand, keine Waffe mitgenommen zu haben. Der Schnappstock zählte nicht. Er war aus gutem Stahl, doch viel zu unhandlich. Und sie hatte weder ein gutes Messer noch eine Bolzenwaffe bei sich. Keine guten Voraussetzungen, um die Begegnung mit einem bezahnten Tod der Tiefe zu bestehen. Die meisten Raubfische verfügten zudem nicht nur über ein mörderisches Arsenal an Zähnen, sondern auch noch weit gefährlichere Waffen. Wenn sie Pech hatte, dann war es …
„Ein Hammerschädel!“ Es war ein unbewusster Schrei, den sie ausstieß, und kleine Luftbläschen perlten von ihrem Mund zur Oberfläche empor.
Der Hammerschädel war kaum halb so groß wie ein Dergo-Barsch. Sein Körper wirkte gestreckt und sehr flach. Oberhalb und unterhalb des breiten Schlitzmauls waren die knöchernen Auswüchse zu sehen, die dem Raubfisch zu seinem Namen verholfen hatten. Sie wirkten, als hätte man eine senkrecht stehende Sichel durch den Schädel gerammt, deren Spitzen nach vorne zeigten. Diese Auswüchse konnten wie die Schere eines Krebses zupacken und schlugen mit unbarmherziger Wucht in ihre Beute. Irgendjemand hatte dies einst mit Hammer und Amboss eines Schmiedes verglichen und der Begriff Hammerschädel hatte sich eingeprägt. Der gefährliche Fisch glitt in langsamen Schleifen durch die Lagune und es war klar, dass er Beute suchte.
Die Wunde!
Der Schnitt, den sie sich im Maul des Dergo-Barsches zugezogen hatte! Auch wenn die Blutung inzwischen aufhörte, ein Beutejäger witterte winzige Moleküle davon auf große Entfernung. Velaras Verletzung hatte den Tod angelockt.
Die junge Frau blickte erneut zur Wellenpfeil hinüber. Die Klappen unterhalb des Rumpfes waren geöffnet. Ruderschlag war nicht in seinem Versteck und ging irgendwo jenen Dingen nach, die ein Röhrenrochen schätzte. Sich, befreit von dem engen Gefängnis, endlich einmal austoben und ein paar Mäuler voller Fische einsaugen. Velara hätte seinen Stachel nun gut gebrauchen können und stieß hoffnungsvoll den vibrierenden Dreiklang aus, mit dem sich Ruderschlag anlocken ließ.
Es war ein Fehler, denn der Hammerschädel vernahm diesen Laut ebenfalls.
Seine Suchschleifen, mit denen er Witterung genommen hatte, endeten abrupt und er glitt rasch und zielstrebig auf Velara zu.
Sie ließ den hinderlichen Schnappstopper fallen und schwamm mit allen Kräften auf eine der Korallenbänke zu. Es war besser, ein wenig Haut an den Korallen zurückzulassen, als im Magen des Jägers zu enden. Aber es würde ein knappes Rennen werden.
Für ein menschliches Wesen war Velara eine perfekte Schwimmerin, doch das war nichts im Vergleich zu einem Wesen, welches im Wasser geboren war. Sie konzentrierte sich auf die Korallen und versuchte die Vorstellung zu ignorieren, wie sich Hammer und Amboss des Hammerschädels in ihren Leib senkten und sie in das gierig geöffnete Maul drückten.
Ein Rauschen war zu hören, als etwas ins Wasser klatschte.
Aus den Augenwinkeln sah Velara einen blauen Schemen, der sich dem Hammerschädel unglaublich schnell näherte.
Steuermann Dan´Hargos hatte die Gefahr erkannt und nicht gezögert.
Das Volk der Irghil und die Hammerschädel waren natürliche Feinde. Einst waren die Krebse die bevorzugte Beute der Raubfische gewesen. Zu diesem Zweck hatte die Evolution die Räuber mit Hammer und Amboss ausgestattet, um die dicken Panzer ihrer Opfer knacken zu können. Die Irghil hingegen waren mit mörderischen Scheren versehen, mit denen sie den Jägern zusetzen konnten. Dennoch hatten die Hammerschädel die Krebse nahezu ausgerottet, bis irgendwann der Funke der Intelligenz in den bedrohten Irghil aufgeflammt war. Dies hatte das Blatt gewendet und die Krebswesen hatten Strategien entwickelt, mit denen sie ihren Feinden überlegen waren. Noch immer verirrten sich gelegentlich Raubfische in die Lagunenstädte der Irghil und diese machten sich ein Vergnügen daraus, den Feind zu stellen und zu töten. Die ansonsten eher sanften Irghil zeigten dann, dass sie durchaus zu Grausamkeiten fähig waren.
Dan´Hargos hatte nicht den Vorteil, andere Krebse an seiner Seite zu wissen, und konnte die Schwarmtaktik seines Volkes nicht anwenden. Dennoch reagierte der Hammerschädel augenblicklich auf den Anblick des natürlichen Feindes.
Der Steuermann faltete seine sechs Beine und die beiden Arme eng unter den Bauch. Der breite, ruderartige Schwanz bewegte sich schnell, um den gedrungenen Körper voranzutreiben. Seine beiden Scheren waren vom Rücken nach vorne gefaltet, weit geöffnet und reckten sich dem Feind drohend entgegen.
Der Raubfisch würde den Irghil frontal angreifen, im letzten Augenblick eine Ausweichbewegung machen, um den Krebs von der Seite zu packen, und seine knöchernen Waffen durch die Rückenpanzerung und die relativ weiche Bauchseite zu treiben. Auf solche Weise aufgespießt konnte der Krebs noch ein wenig mit seinen Scheren herumfuchteln, dem Hammerschädel aber nicht schaden. Es war eine wirkungsvolle und sehr alte Taktik, und die Irghil hatten eine ebenso wirkungsvolle Gegenmaßnahme entwickelt.
Velara konnte das bösartige Glitzern eines Auges sehen, als der Raubfisch an ihr vorbei schnellte und Dan´Hargos erreichte. Der Hammerschädel krümmte sich zum Flankenangriff und der Krebs machte eine blitzartige Rolle. Als Hammer und Amboss des Jägers aufeinander prallten, befand sich der Steuermann unter diesem, umschloss den Amboss mit einer Schere und rammte die andere in den Bauch des Angreifers. Zacken und Dornen der Kampfschere zerfetzten das weiche Gewebe und drangen in die Innereien des Hammerschädels. Eine Wolke gelben Blutes stieg auf, als der Räuber sich im Todeskampf krümmte.
Dan´Hargos löste sich vom Feind und gab Velara das Zeichen aufzutauchen. Diese ließ sich nicht lange bitten und schwamm erleichtert auf die Leiter der Wellenpfeil zu. Der Irghil folgte ihr, nachdem er den wertvollen Schnappstopper vom Grund der Lagune aufgesammelt hatte.
Velara sah das besorgte Gesicht ihres Vaters über sich, während sie sich die Leiter empor zog und der Steuermann hinter ihr an die Oberfläche kam.
„Bei den Clans der Meere, das war knapp, mein Kind.“ Vel Halkor sog aufgeregt an seiner Korallenpfeife und stieß eine mächtige Qualmwolke aus, während die andere Hand einen seiner Bartzöpfe knetete. „Ich wusste, dass du dich wieder in Schwierigkeiten bringst.“
„Und ich wusste, dass Dan´Hargos mich da wieder heraus holt.“ Sie lächelte den Krebs an. „Du hast dir Zeit gelassen.“
„Das Gulasch“, erwiderte der Krebs brummend. „Er ist jetzt verbrannt.“
Velaras Vater blickte seufzend über die Lagune. „Mit dem Schwimmen ist es für heute wohl vorbei. Das Blut des Hammerschädels wird andere Bestien anlocken. Verflucht, ich hoffe, es hat sich wenigstens gelohnt.“
Velara kannte diesen Blick ihres Vaters. Wenn es um Gold und Gewinn ging, dann war er ein eiskalter Rechner, und das musste er wohl auch sein, um die Wellenpfeil und ihre Mannschaft über die Runden zu bringen. Sie lächelte ihn an und schlug gegen den umgeschnallten Gürtel. „Du wirst zufrieden sein, Vater. Die Taschen sind voller Dergo-Kristalle.“
„Ah.“ Das Funkeln in Vels Augen wurde intensiver. „Zeig her.“
Dan´Hargos interessierte sich weniger für die kostbare Beute. Während das Wasser von seinem Panzer verdunstete, lehnte er an der Reling und starrte bedauernd in die kristallklare Tiefe. Die Schatten mehrerer Raubfische glitten heran. „Ich konnte mir noch nicht einmal einen ordentlichen Bissen von dem Kerl nehmen. Wäre Velara nicht im Wasser gewesen, hätte ich es bestimmt getan. Jetzt ist euer Gulasch verbrannt und mein Magen ist ebenfalls leer.“
„Schmeiß das verdammte Gulasch über Bord. Sollen sich die Fische den Magen daran verderben“, knurrte Velaras Vater geistesabwesend. Er zählte die Beute seiner Tochter und sein Gesicht zeigte ein leicht entrückt wirkendes Lächeln. „Proviant für ein Jahr. Ein neuer Kessel für die Dampfmaschine. Und, wenn ich gut handele, ein paar neue Sachen für Velara.“ Er hob den Blick und sah seine Tochter stirnrunzelnd an. „Zieh dir etwas an, Kind. An Deck läufst du mir nicht so nackt herum.“
„Ach, Vater, es sieht doch keiner außer uns.“
„Gewöhne es dir gar nicht erst an, meine Süße. Und vor allem, leg dein Schmuckband wieder um den Hals. Man sieht die Kiemen.“
Velara stieß ein paar halblaute Bemerkungen aus, welche ihr Vater glücklicherweise nicht verstand, und ging zu ihren Kleidungsstücken, die auf einer Luke lagen. Sie legte widerstrebend das schwarze Halsband mit den Ziernähten und dem Schmuckstein an. Es störte sie zwar nicht, wenn es ihre Kiemen bedeckte, aber Velara mochte es, ihre nackte Haut der Sonne und dem Wind auszusetzen. Während sie in Hose und Kilt schlüpfte, beriet sich ihr Vater mit dem Steuermann.
„Das sind sehr kostbare Kristalle“, meinte Vel und sog an seiner Pfeife. „Sie sind ungewöhnlich rein und groß. Müssen schon lange im Barsch gewesen sein.“
Dan´Hargos kreuzte zustimmend seine Augenstiele. „Wenn wir sie über mein Volk anbieten, wird der Zwischenhändler etliche Prozente für sich einstreichen. Vielleicht sollten wir direkt zu den Erenok fahren. Dann hätten wir den vollen Gewinn.“
„Aber auch das volle Risiko, mein Freund. Dein Volk ist zwar ein wenig gierig, aber auch fair und hält seine Verträge ein. Bei den Erenok kann man sich nie so sicher sein. Zudem müssen wir ein paar Dinge besorgen, die wir nur bei deinen Leuten erwerben können.“
„Dann werden wir tauchen müssen.“ Der Steuermann klickte mit seinen Scheren. „Schwierige Gewässer, Kapitän. Viel Land hier. Wir müssten ein gutes Stück auf die See hinaus, um einem Aufprall zu entgehen. Tiefes Wasser, Vel. Du weißt, das ist riskant. Unsere brave Wellenpfeil muss dringend überholt werden. Der Rumpf ist in einem Zustand, dem ich nicht recht traue.“
„Macht es denn einen großen Unterschied?“ Velara drückte Wasser aus ihrem Haarzopf. „Wir sind doch schon oft getaucht.“
Kein anderes Schiff konnte tauchen und unter Wasser fahren. Die Wellenpfeil konnte es. Dies war sicher das größte Geheimnis, welches das kleine Handelsschiff umgab. Es wurde ebenso gehütet wie die atanischen Kiemen von Velara oder der Röhrenrochen Ruderschlag. Ein Tauchschiff konnte eine gefährliche Waffe sein und die Ataner hatten diese auch eingesetzt. Alle Völker der Welt würden ohne Rücksicht versuchen, das Geheimnis der Wellenpfeil zu ergründen, wenn sie erfuhren, welche Fähigkeiten das Schiff besaß.
„Kind, du verstehst nicht genug von Navigation, um das beurteilen zu können“, erwiderte ihr Vater und stieß eine erneute Qualmwolke aus der Pfeife.
Dan´Hargos legte die Kampfscheren auf den Rücken und legte seine Augenstiel schief. „Sie hat schon navigiert und das Steuer übernommen, Vel.“
„In den seichten Tiefen der Mittelwelt und es war keine lange Tauchfahrt.“ Vel Halkor kratzte sich am Hals und wies mit der Pfeife auf den Krebs. „Und du hast ihr dabei über die Schulter gesehen.“
„Warum können wir hier nicht tauchen?“, hakte Velara nach.
Ihr Vater seufzte. „Erklär du es ihr, Dan. Du bist besser in solchen Dingen.“
„Der Teller?“
„Natürlich, der Teller“, brummte der Kapitän. „Grundzüge der Navigation.“
„Ich frage mich, warum du solche Dinge immer mir überlässt.“ Der Steuermann klickte amüsiert. Dann sah er Velara an. „Du kennst die metallenen Teller, von denen ihr Menschen esst? Schon gut, es war nicht böse gemeint.“ Dan´Hargos machte eine entschuldigende Geste mit den Augenstielen. „Nimm einen der flachen Teller und drehe ihn mit seiner Unterseite nach oben. Dann hast du die Grundform der Welt. Oben die Weltenscheibe mit den Landmassen und unten die Wasserscheibe mit dem Meeresgrund. Die Wasserscheibe ist nicht besonders tief.“
„Sechs oder sieben Kilometer“, warf Vel ein.
„Erklärst du oder erkläre ich?“ Der Irghil kreuzte empört die Arbeitsarme. Der Kapitän machte eine entschuldigende Bewegung und der Steuermann fuhr fort. „Die Landmassen haben keine Verbindung zueinander. Also, wenigstens nicht oberhalb des Wasser.“
„Alle Völker brauchen Wasserfahrzeuge, um ein anderes Land oder andere Inseln erreichen zu können.“ Vel errötete und zuckte die Schultern. „Schon gut, Steuermann, du erklärst.“
„Wo war ich?“ Dan´Hargos kratzte sich mit einer Schere am Rückenpanzer. „Ah, ja. Alle Völker brauchen Wasserfahrzeuge, um ein anderes Land oder andere Inseln erreichen zu können.“
„Das sagte ich schon“, brummte Vel.
„Erklärst du oder … Schön, dann wäre das geklärt.“ Dan´Hargos Kopfpanzer verfärbte sich einen Hauch rötlich und zeigte eine gewisse Verstimmung, die jedoch rasch wieder verschwand. „Nun, jedenfalls, wenn die Völker die See befahren, können sie sich nur auf ihrer Oberfläche bewegen, du verstehst, Velara? An der Oberfläche bietet das Wasser jedoch Widerstand und hemmt die Fahrt eines Schiffes. Wir hingegen können unter seine Oberfläche gleiten, bis hinab in die Zwischenschicht. Dort gibt es keinen Widerstand und das macht uns schnell, sehr schnell.“
Velaras Vater klopfte mit dem Pfeifenkopf auf die Reling. „Immerhin kannst du dadurch auch einschätzen, wie wertvoll und einzigartig unsere Wellenpfeil ist. Während alle anderen den weiten Weg über das Wasser nehmen müssen, viele, viele Tausende von Kilometern, tauchen wir einfach in das Wasser ein und kürzen die Dauer der Reise ab. Niemand sonst kann das. Nur wir“, fügte er mit sichtlichem Stolz hinzu.
„Wir können das aber nicht beliebig tun“, wandte der Steuermann ein. „Je tiefer die Wasserschicht, in die wir einfahren, desto höher ist der Druck, der auf dem Rumpf lastet. Wird er zu hoch, zerquetscht er uns.“ Er sah den Kapitän mahnend an. „Und im Augenblick ist unser Rumpf nicht besonders haltbar, Kapitän. Es gibt da ein paar Nieten … “
„Gut, gut, Steuermann, ich habe dich ja verstanden. Wenn wir Ilea´Irghil erreichen, werden wir das reparieren.“ Der Kapitän beugte sich weit über die Reling. „Wo bleibt eigentlich der verdammte Ruderschlag? Er wird doch wohl nicht vergessen zurückzukommen? Verdammt, am Ende balzt er gerade um ein Röhrenrochenweibchen.“
„Nicht in diesen Gewässern“, wandte Dan´Hargos ein. „Die sind zu seicht.“
„Wir werden wohl noch ein wenig warten müssen“, sagte Velaras Vater nachdenklich und blickte zu einer der Inseln hinüber. „Wir sollten die Zeit nutzen und zu einer der Inseln hinüberrudern. Trinkwasser haben wir genug, aber vielleicht finden wir ein paar Früchte, etwas Fleisch, welches sich jagen lässt, und ein paar Hölzer für unseren Schiffszimmermann.“
„Nett, dass du an mich denkst, Kapitän.“ Die Mannschaft war klein und Dan´Hargos war nicht nur Steuermann, sondern zugleich auch Koch und Zimmermann der Wellenpfeil.
Das Schiff hatte noch zehn weitere Besatzungsmitglieder. Sie waren unterschiedlicher Herkunft und bildeten eine verschworene Gemeinschaft, da das Schicksal sie irgendwie auf der Wellenpfeil zusammengeführt hatte. Die meisten waren Menschen von einer der zahllosen kleineren Inseln. Nur der Reptiler Turpaa war nichtmenschlich, gehörte aber sicherlich zu den geschicktesten Segelmachern, die man sich denken konnte.
„Schön, setzen wir das Beiboot aus“, entschied der Kapitän.
Nur wenig später ruderten sie mit dem hölzernen Boot zu einer der größeren Inseln hinüber. Noch immer streiften Hammerschädel umher und die zahllosen Fische der Korallenbänke verbargen sich, sodass die Unterwasserwelt unwirklich leer wirkte. Velara konzentrierte sich daher auf die Insel, der sie sich langsam näherten. Die Ruder hoben und senkten sich im Gleichtakt und wirkten wie der Flügelschlag eines der zahlreichen Seevögel, welche die Insel umkreisten.
Der Strand sah verlockend aus, mit dem hellen und feinen Sand, der auch den Grund der Lagune bedeckte. Dicht dahinter begann scheinbar undurchdringlicher Dschungel. Velaras Vater leckte sich beim Anblick der Baumnüsse genießerisch über die Lippen. Undefinierbare Tierlaute drangen aus dem Grün hervor.
„Haltet die Augen offen“, ermahnte Vel Halkor und wies mit dem Pfeifenstiel zu den Bäumen hinüber.
„Hauptsache, deine Pfeife qualmt ordentlich.“ Mark Levin war ein Insulaner aus dem Volk der Borea. Ein kleiner und muskulöser Mann, dessen Liebe der Dampfmaschine des Schiffes galt. „Der Rauch wird jedes Raubtier in größerem Umkreis vertreiben.“
„Immerhin vertreibt er die Mücken“, stellte der Kapitän würdevoll fest. „Ich werde sicherlich weniger Stiche auf das Schiff bringen als ihr. Ihr solltet auch mal ein Pfeifchen probieren.“
„Die Mücken werden schon ihren Grund haben, warum sie vor der Pfeife fliehen.“
Der Bug des Bootes stieß auf Grund und sie sprangen heraus, um es höher auf den Strand zu ziehen. Die Gruppe betrat wenig bekanntes Land und war daher bewaffnet. Velara trug, wie sie alle, ein beachtliches Haumesser am Gürtel, von Dan´Hargos abgesehen, gegen dessen Scheren ein Messer eher kümmerlich gewirkt hätte. Ihr Vater und zwei der anderen Männer trugen zusätzlich Bolzenwaffen und hielten sie schussbereit.
„Wir bilden zwei Gruppen.“ Velaras Vater wies mit dem Pfeifenstiel um sich. „Dan und ihr zwei seht euch die Bäume an. Sammelt ein paar der Nüsse ein. Sie sind sehr schmackhaft und Dan dürfte keine Probleme haben, die Bäume zu besteigen und sie abzuzwicken. Velara und ich werden uns einmal diese Felsengruppe dort vorne ansehen.“
„Ein bestimmter Grund?“, fragte Velara.
Ihr Vater sog die Luft ein. „Nur ein Gefühl, mein Kind. Nur ein Gefühl.“
Velara zuckte die Schultern und folgte ihrem Vater. Der warme Sand fühlte sich unter ihren Füßen sehr angenehm an. Er war bei Weitem nicht so heiß wie das Deck des Schiffes. Kurz entschlossen zog sie die Stiefel aus und hing sie an ihren Riemen über die Schultern.
Sie näherten sich der Felsengruppe und hörten hinter sich die Rufe der anderen. Offensichtlich hatte der Steuermann bereits einen Baum erklommen und warf die schweren Nüsse nach unten.
Die Felsen ragten hoch aus dem Sand und dienten einigen der Seevögel aus Nistplatz. Als sich die beiden Menschen näherten, warfen sie den Neuankömmlingen misstrauische Blicke zu, blieben aber sitzen.
Plötzlich blieb Velara stehen und verzog das Gesicht. „Ich glaube, ich bin da in etwas hineingetreten.“
Ihr Vater wandte sich besorgt um. „Hast du dich verletzt? Lass sehen. Ah, das ist Vogeldung.“
„Was? Du meinst, ich bin in Vogelmist getreten?“
„Aber ja, mein Kind, aber ja. Sehr schön, ganz, wie ich es erhofft hatte.“
Sie sah ihn empört an. „Du hast gehofft, dass ich in Vogelmist trete?“
„Nun ja, es ist sehr wertvoller Vogeldung. Ich konnte es förmlich riechen, weißt du? Dieser Dung enthält einen hohen Anteil an Salpeter. Den braucht man im Reich der sieben Inseln zur Herstellung des Kanonenpulvers. Davon haben die niemals genug.“
„Igitt, das stinkt entsetzlich.“
„Mag sein, aber dieser Gestank bringt uns Gold ein, viel Gold. Wir werden die Männer rufen und das Zeug einsammeln.“
„Vater, das ist nicht dein Ernst. Das Zeug stinkt wirklich erbärmlich. Sollen wir diesen Gestank etwa während der ganzen Fahrt nach Ilea´Irghil ertragen?“
„Das täuscht, mein Kind. Gold stinkt nicht.“
Also versammelten sie die Männer und kratzten den Vogelmist von den Felsen, um ihn in Säcken zu verstauen. Als die Wellenpfeil schließlich, mit dem Röhrenrochen Ruderschlag unter dem Rumpf, aus der Lagune auslief, war die Besatzung froh, sich säubern zu können.
„Und das Zeug stinkt trotzdem“, stellte Velara fest.
Ihr Vater war in diesem Moment der Einzige, der gegensätzlicher Meinung zu sein schien. Von Dan´Hargos einmal abgesehen, doch der Krebs konnte seine Geruchsknospen auch verschließen.
„Nun, was halten Sie von ihr?“
„Bitte?“ Theanos schreckte aus seinen Gedanken und wandte sich um.
„Nun, Sie sind bereits zwei Wochen an Bord der Delancer“, meinte Kapitän Bart-Veldem mit freundlichem Lächeln. „Was halten Sie von meinem Schiff?“
„Nun, äh, sehr schön“, murmelte Theanos verlegen.
Der Kapitän lachte auf. „Sie können nur sehr schlecht lügen, junger Freund. Niemand findet die Delancer schön. Nun, von mir vielleicht abgesehen. Aber ich bin auch ihr Kapitän und bei mir erwartet man das wohl. Wir sind hier auf See, Heilkundiger Theanos, also reden Sie offen, wie es sich für einen Seefuß gehört.“
„Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Hafen wieder erreichen“, gestand Theanos ein. Er errötete stärker und zuckte verlegen die Schultern. „Sie ist alt.“
„Sogar sehr alt“, bestätigte der Kapitän und sein Lächeln vertiefte sich. Er trat neben den jungen Bordarzt an die Einfassung der Brücke und lehnte sich auf den Handlauf. „Das älteste Schiff der königlichen Marine des Reiches der Sieben Inseln, Heilkundiger. Es schwimmt noch immer, obwohl es viele Feinde gegeben hat, die versuchten, die brave Delancer unter Wasser zu schicken.“ Er strich liebevoll über den hölzernen Handlauf. Das Material war abgegriffen und vielfach ausgebessert. „Sie ist eine Legende, die Delancer, mein Freund, das können Sie mir ruhig glauben. Ja, sie ist alt und nicht mehr die schnellste. Aber sie hat noch immer ein paar Zähne, die sie dem Feind zeigen kann.“
Seiner Majestät Kreuzer Delancer war nun fast hundertundzwanzig Jahre alt und, nach einhelliger Meinung der Mannschaft, kaum mehr als ein Wrack, dass sich nur mühsam über Wasser hielt. Untereinander wurde die Besatzung nicht müde, sich dieses Umstandes zu versichern. Zumindest, wenn der Kapitän nicht in der Nähe war. Ebenso einig war man sich aber auch darin, auf dem besten und ruhmreichsten Schiff des Königs zu fahren, und verteidigte diesen Ruf erbittert gegen jede andere Besatzung. Beide Auffassungen enthielten jenen Anteil an Wahrheit, der ein Schiff zur Legende machte, und die Delancer war unbestritten eine Legende.
„Als sie zum ersten Mal ins Wasser geglitten ist“, erklärte Bart-Veldem, „da war sie das größte und modernste Schiff und, natürlich, dass am schwersten bewaffnete. Damals wurde sie als Schlachtschiff bezeichnet. Seitdem ist manches Jahr vergangen und es gibt viele neue und größere Schiffe. Im Laufe der Zeit wurde unsere brave Delancer daher immer weiter zurückgestuft. Nun gilt sie als Kreuzer und noch dazu als der kleinste der Marine. Der Krieg hat sie überholt, trotz der vielen Umbauten, die man an ihr vorgenommen hat. Aber sie kann noch immer ihren Teil beitragen.“
Der Krieg.
Der junge Arzt Theanos bezweifelte, dass die Delancer noch einen bedeutsamen Teil zum Krieg beitragen konnte. Im Gegenteil, ihre Besatzung würde froh sein können, eine Begegnung mit dem Feind zu überleben. Sicher, der hölzerne Rumpf war nachträglich mit Metallplatten gepanzert worden. Man hatte die scharfkantigen Bodenklingen unter das Schiff geschraubt und auch die Segelmasten durch eine Dampfmaschine ersetzt, die das mächtige Schaufelrad am Heck antrieb. Aber ihre Kanonen waren alt und wiesen nicht die Größe moderner Kaliber auf. Damit ließ sich einem Muschelschiff der Erenok kaum Schaden zufügen.
Als man die Delancer erbaute, war noch Frieden gewesen. Das zeigte sich in den einst großzügigen Unterkünften für die Mannschaft und die Verwendung edler Hölzer. Mit dem Einbau der Dampfmaschine hatte man Vorratsräume für den Brennstein einrichten müssen. Dem war die Bequemlichkeit der Besatzung zum Opfer gefallen. Nun verfügten nur noch die Offiziere über etwas, dass sich, mit viel gutem Willen, als Kabine bezeichnen ließ. Theanos Unterkunft lag im Unterwasserschiff und war überraschend geräumig, wenn man davon absah, dass sie zugleich als Behandlungsraum diente. Bei einem Gefecht würde man zusätzlich die Mannschaftsmesse als Krankenrevier herrichten. Keine angenehme Vorstellung, auf einem Tisch operiert zu werden, auf dem man kurz zuvor gegessen hatte. Aber an diesem Krieg war nichts Angenehmes.
Vor rund hundert Jahren war er entbrannt und keiner wusste genau, warum das überhaupt geschehen war. Sicher war nur, dass er das Reich über alle Maßen beanspruchte und dass die Menschen sich nicht auf der Gewinnerstraße befanden. Der Krieg verschlang die Ressourcen der sieben Inseln und er verschlang ihre Menschen. Bestimmte Rohstoffe wurden knapp und die Anwerber des Königs zogen sechzehnjährige Mädchen und Jungen zum Waffendienst ein. Nur wenige blieben davon verschont. Das Leben im Reich der sieben Inseln war darauf ausgelegt, in diesem unbarmherzigen Krieg zu überleben. Die Schiffe des Reiches und seine Truppen waren denen der Erenok im Grunde überlegen, doch das nützte wenig, wenn man bedachte, wie schnell der Feind seine Verluste ausgleichen konnte.
So menschenähnlich die Erenok auch äußerlich wirkten, so unterschieden sie sich doch wesentlich von den Menschen Means. Ihre flachen Gesichter wurden von einem kurzen Rüssel dominiert, mit dem sie einen stark ätzenden Säureklumpen spucken konnten. Im Nahkampf war dies eine furchtbare Waffe und hatte den Erenok den Spitznamen „Spucker“ eingetragen. Ihr Volk schlüpfte aus Eiern und sie hassten die Menschen. Viel mehr war von ihnen nicht bekannt. Ihre Kultur und Denkweise war den Meanern ein Rätsel. Allerdings war die Forschung im Reich der sieben Inseln auch nicht darauf ausgerichtet, den Feind zu verstehen, sondern ihn zu töten. Die Zeit, in der sich Stimmen erhoben hatten, die Verständigung zwischen den beiden Rassen forderten, war lange vorbei.
„Ich habe gehört, Sie haben sich freiwillig gemeldet?“ Kapitän Bart-Veldem sah Theanos forschend an. „Es gibt Gerüchte, Ihre Familie habe Beziehungen im Königshaus. Sie wären nicht eingezogen worden.“
„Jeder tut dort seine Pflicht, wo er dem Reich der sieben Inseln am Besten dienen kann“, erwiderte der junge Arzt lahm.
„Ja, so steht es auf jedem Werbeplakat des Königs“, brummte der Kapitän. „Und ich denke, Sie weichen der Antwort aus.“
Bart-Veldem war ein guter Mann. Er missbrauchte seine Macht als Kapitän nicht und auf seinem Schiff gab es nur wenige Auspeitschungen. Wahrscheinlich verdiente er eine ehrliche Antwort. Theanos zuckte entsagungsvoll die Schultern. „Ich will an die Lehrakademie auf der Hauptinsel.“
„Verstehe“, murmelte Bart-Veldem. „Ohne Eintragung des Kampfdienstes in der Führungsakte wird das nahezu unmöglich sein, selbst wenn man gute Beziehungen nach oben hat.“ Er lächelte ohne sonderliche Wärme. „Sie haben die Delancer gewählt, weil Sie nicht glauben, dass sie in ein Gefecht geht, nicht wahr? Nördliche Route, da treibt sich praktisch nie ein Spucker herum.“
„Ich bin kein Held“, gestand Theanos ein.
„Wer ist das schon?“ Der Kapitän seufzte schwer. „Ich persönlich mag keine Helden. Wissen Sie auch warum, Heilkundiger? Weil es meistens Menschen sind, die dem Ruhm nachjagen, und andere müssen dafür bezahlen. Zudem haben Helden meist ein kurzes Leben. Ich lebe nun schon recht lange und bin sicher kein Held, Theanos. Dennoch werde ich meine Pflicht für den König und das Reich der sieben Inseln tun.“ Er sah den Arzt forschend an. „Und Sie werden das ebenso, junger Mann. Nun, wenn Sie sich schon nicht zum Helden berufen fühlen … Sind Sie wenigstens ein guter Arzt?“
Theanos nickte stumm.
Der Kapitän blickte in seine Augen und nickte dann. „Schön, ich glaube Ihnen. Wahrscheinlich haben Sie die vorgeschriebenen drei Jahre in einer Praxis geleistet. Aber glauben Sie mir, die Verwundungen, denen Sie im Krieg begegnen, sind sehr viel grausamer.“
„Ich war im Marinehospital des Königs.“
Bart-Veldem runzelte die Stirn. „Meinen Respekt dafür. Dann wissen Sie ja, was auf uns zukommen kann, wenn wir einer Kampfmuschel der Erenok begegnen.“
Sie standen auf der schmalen Galerie, die sich um die Brücke herum zog. Diese erhob sich, einem plumpen Kasten gleich, direkt am Bug des alten Kreuzers. Im unteren Geschoss der Brücke befanden sich die Offiziersunterkünfte, welche sich die Männer mit den beiden nach vorne gerichteten Jagdgeschützen teilen mussten. Ein ähnlich kantiger Kasten, nur ungleich größer, überragte das Heck mit dem mahlenden Schaufelrad. In diesem Aufbau befanden sich die Unterkünfte der Mannschaften und die Maschinenanlage. Die fünfzig Meter zwischen beiden Konstruktionen gehörten den Kanonen. Jeweils zehn Geschütze in Breitseitenaufstellung, Rohr neben Rohr. Die Waffen und ihre Bedienungen wurden durch eine Konstruktion aus Stahlplatten geschützt, die ein spitzes Dach bildeten. Der Platz im bauchigen Rumpf der Delancer gehörte den Vorräten an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Brennstein sowie dem Pulvermagazin und den Munitionsvorräten. Das Schiff war keine Schönheit, sondern auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet.
Die modernen Schiffe wirkten weitaus eleganter und waren unzweifelhaft sehr viel tödlicher. Das war auch der Grund, warum man das Schiff und seine Besatzung nicht mehr in die wirklich gefährlichen Gewässer schickte. Der jetzige Auftrag lautete auf Patrouille entlang der nördlichen Route. Das bedeutete mehrere Wochen endlos erscheinender Fahrt an der nördlichen Reichsgrenze entlang. Hier war nie ein Kampfschiff der Erenok erschienen, denn um aus Norden anzugreifen, hätten sie zwei Drittel der Welt umfahren müssen. Immerhin hielt es die Admiralität für nicht ganz unmöglich, dass es irgendwann ein Spucker versuchen könnte. Dann war es wichtig, ein paar Augen parat zu haben, die ihn entdeckten, und welche, die wirklich kampfkräftigen Schiffe der Marine heranführten. Für die guten Augen hatte die Admiralität gesorgt, denn die Delancer hatte einen überproportional hohen Aussichtsmast, der sich direkt hinter der Brücke in den Himmel streckte. Der Kapitän bezeichnete die Plattform auf der fünfzig Meter hohen Konstruktion als Ausguck, die Mannschaft bezeichnete ihn schlicht als „Kotzkiste“. Beides traf zu.
Die See war an diesem Tag sehr ruhig und die Delancer schien über ihrem Spiegelbild dahinzugleiten. Das Klatschen des mächtigen Schaufelrades wirkte ungewöhnlich laut, obwohl der alte Kreuzer nur mit langsamer Fahrt fuhr. Die Schaufeln wirbelten Wasser empor, welches unten an das Maschinenhaus schlug und genutzt wurde, um Pleuel, Kolben und Maschinenfundament zu kühlen. Bei den modernen Kampfschiffen nutzte man längst die unter Wasser rotierenden Antriebsschnecken, die weit weniger empfindlich gegen Feindbeschuss waren.
„Es wird Zeit für den Kurswechsel, Kapitän.“ Leutnant Nels-Bedeat trat aus dem Ruderhaus der Brücke und legte salutierend die flache Hand an die linke Brustseite. Der Doppelname verriet seine vornehme Herkunft und trotz der Hitze war seine weiße Seeuniform tadellos. Er schaffte es stets, dass sich jeder andere Mann neben ihm ein wenig schmuddelig und zerknittert vorkam, und hatte nicht die gutmütige Art des Kapitäns. Er war ein sehr kompetenter Seeoffizier, doch das verwunderte den jungen Arzt Theanos nicht. Auch wenn Bart-Veldem in der Auswahl seiner Mannschaft sehr eigenen Vorstellungen nachhing, jeder Einzelne davon war ein Könner auf seinem Gebiet. Das galt sogar für den Schiffskoch, der es schaffte, selbst aus dem Proviant der Flotte etwas Genießbares zu zaubern oder doch wenigstens etwas, das nicht sofortige Übelkeit hervorrief. Die Verpflegung auf den Schiffen war nicht für empfindliche Mägen geeignet, das hatte Theanos schon am ersten Tag festgestellt.
„Wir legen noch ein paar Kilometer nach Norden zu, Erster“, brummte der Kommandant.
Der Erste Offizier runzelte die Stirn. „Dann verlassen wir unser Patrouillengebiet, Kapitän.“
„Die Vorschriften, ich weiß.“ Bart-Veldem nickte bedächtig. „Zur Kenntnis genommen, Leutnant Nels-Bedeat. Halten Sie den alten Kurs, bis ich es sage.“
„Kurs und Fahrt beibehalten“, rief der Erste ins Ruderhaus hinein. Dann trat er neben den Kapitän. „Ihre berühmte Nase, Kapitän?“
„Ein Gefühl.“ Bart-Veldem blickte zum Ausguck hinauf. „Ein ganz komisches Gefühl, Erster.“
Der Erste Offizier fuhr nun schon einige Jahre mit der Delancer und würde wohl bald sein eigenes Kommando erhalten. Er hatte die eigenartigen „Gefühle“ des Kapitäns respektieren gelernt. Der alte Seemann besaß ein Gespür für die See und für jede Art von Gefahr. Vor einem Jahr hatte er, aus heiterem Himmel heraus, alle Mann unter Deck befohlen und die Luken schließen lassen. Nur wenig später war ein gewaltiger Sturm über das Schiff hereingebrochen, derart übergangslos, dass er sicher beachtlichen Schaden hervorgerufen hätte, wenn die Delancer nicht darauf vorbereitet gewesen wäre.
Bart-Veldem blickte über die See. Theanos sah, dass der Kapitän mit den Fingern auf den Handlauf trommelte, obwohl sich der alte Seefahrer bemühte, völlig entspannt zu wirken.
„Wer ist im Ausguck?“
„Nilia und Herokos.“ Nels-Bedeat lächelte unmerklich. „Nilia ist jung und hat die schärfsten Augen und Herokos ist alt, hat schlechte Augen, aber große Erfahrung.“
„Eine gute Kombination, Erster.“ Der Kapitän sah seinen Stellvertreter lächelnd an. „Sie werden mir fehlen, wenn Sie Ihr eigenes Kommando antreten. Etwas weniger Steife und etwas weniger Forschheit, und Sie werden ein hervorragender Kommandant.“
Heiler Theanos tat, als habe er die Worte des Kapitäns nicht gehört und blickte zum Ausguck hinauf. Ein einziges Mal war er dort oben gewesen. Eine Erfahrung, die ihm für den Rest seines Lebens reichte. Hinaufzusehen, das war eine Sache, von dort oben hinunter zu blicken, eine gänzlich andere. Von der Kotzkiste aus wirkte das Schiff winzig und selbst bei dieser ruhigen Fahrt schwankte die Plattform auf ihrem hohen Mast lebhaft hin und her. Bei stärkerer See befanden sich die Seeleute dort oben öfter außerhalb des Schiffes, als darüber. Wenn sie stürzten, dann machte es keinen Unterschied, wohin sie fielen. Der Aufprall auf Schiff oder Wasser würde sie gleichermaßen töten.
„An Deck! Objekt bugweisend voraus. Schätze auf zwanzig Kilometer Entfernung. Kommt auf!“ Es war die helle Stimme der Matrosin Nilia.
Der Kapitän nickte bedächtig und legte dann die Hände als Schalltrichter an den Mund. „Könnt ihr es identifizieren?“
„Helles Objekt und von beachtlicher Größe. Keine Segel und kein Dampf“, kam die Antwort von oben.
„Wenn Sie mich fragen, Kapitän“, ergänzte der dunkle Bass von Herokos, „dann ist das ein verdammter Spucker.“
„Ihr Gespür, Kapitän.“ Der Erste Offizier reckte sich ein wenig. „Schiff klarmachen zum Gefecht?“
„Die Strömung arbeitet gegen den Erenok, Erster. Er wird noch zwei Stunden benötigen, bis er uns erreicht hat. Sobald er auf zehn Kilometer heran ist, können Sie zum Gefecht trommeln lassen.“
„Das wird eine große Kampfmuschel sein, Kapitän.“
„Sie meinen, der Bissen ist zu groß für uns?“ Bart-Veldem grinste. „Da haben Sie wahrscheinlich sogar recht. Deswegen gehen wir jetzt auch sofort auf Gegenkurs und liefern ihm ein Rennen. Aber er wird uns einholen, früher oder später.“
„Verstehe.“ Der Erste nickte.
Der Kapitän wandte sich dem Steuer zu. „Ruder Hartlage auf Gegenkurs und volle Fahrt, Steuermann!“ Dann sah er Theanos an. „Und Sie sollten sich nun um Ihr Krankenrevier kümmern. Wir werden es wohl bald benötigen.“
Eine Annäherung auf See brauchte ihre Zeit.
Das gab Raum für die Vorbereitungen, die Planung der Taktik und … für die Angst.
Theanos war kein Held.
Er war nicht einmal ein besonders mutiger Mann. Als Kind war er mit den feinsinnigen Gesprächen in der Familie aufgewachsen und den Besuchen der Verwandten am Wochenende. Der Krieg gegen die Erenok war immer gegenwärtig gewesen, aber bei Saft und Kuchen klang er nach einem aufregenden Abenteuer. Als Jugendlicher stand er dann am Sterbebett seines Onkels, dem ein Spucker das Gesicht mit seiner Säure weggeätzt hatte. Das gab dem Begriff Krieg eine ganz andere Bedeutung. Dennoch waren all das Blut und der Tod weit entfernt gewesen, bis er das Alter erreichte, in dem die Werber des Königs sich für ihn zu interessieren begannen.
Seine Familie war nicht von Adel, aber sehr wohlhabend, und so zog man Theanos nicht einfach ein. Er konnte den Dienst am Reich der sieben Inseln jedoch nicht ewig hinauszögern. Das Recht auf Wahl des Wohnortes und auf Vermählung mit einem Weib war daran gekoppelt, den Kampfdienst geleistet zu haben. Theanos war jedoch nicht der Typ, hinter dem Verschluss einer schweren Kanone auf den Feind zu warten oder ihm über den Lauf eines Bolzengewehrs hinweg entgegenzusehen.
Er entschloss sich Arzt zu werden. Heiler genossen in einem Land, das um sein Überleben kämpfte, einen besonderen Status. Er wurde ein guter Arzt und auch dazu gehörte ein gewisser Mut, denn er musste sich dem Elend und der Verzweiflung stellen, welche die Verwundeten einer Schlacht umgaben. Dann war der Bordarzt der Delancer bei einem Unfall gestorben und so war Theanos überraschend auf den alten Kreuzer versetzt worden. Immerhin hatte sich der Patrouillendienst in den nördlichen Gewässern nicht gerade gefährlich angehört.
Bis zu diesem Tag.
Zum ersten Mal empfand der junge Arzt Angst.
Nicht die Angst, einen Fehler zu machen oder in seiner ärztlichen Kunst zu versagen. Nein, es war die kreatürliche Angst ums Überleben. Noch war kein Schuss gefallen, es war nicht einmal zum Gefecht getrommelt worden, und doch fühlte er sich in Schweiß gebadet. Seine Hände zitterten, als er die Treppe hinabeilte, die in den Rumpf der Delancer hinunterführte. Er achtete kaum auf die Menschen, die ihm begegneten, und eilte den langen Mittelgang entlang. Zwischen den Magazinen hindurch, die unterhalb der Wasserlinie besser vor Beschuss geschützt waren, erreichte er endlich das Krankenrevier des Schiffes. Das leere Krankenrevier, welches sich sicherlich bald mit schreienden und stöhnenden Menschen füllen würde.
Theanos warf die hölzerne Kabinentür zu und ging zu dem Schrank mit den Instrumenten. Seine Finger krallten sich um die Griffe der gläsernen Türen. Stöhnend stand er da, umklammerte die metallenen Knäufe, als könne ihre Berührung ihn vor jeglicher Gefahr schützen.
„Alles in Ordnung, Heilkundiger Theanos?“ Der Arzt hatte nicht gehört, dass die Tür geöffnet wurde. Er fuhr herum, als sei er bei einem Diebstahl ertappt worden, und starrte benommen auf die uniformierte Gestalt im Rot der Seesoldaten des Reiches. Die Frau mit den verführerischen Rundungen sah ihn mit verengten Augen an und nickte unmerklich. „Das erste Gefecht für Sie?“
Er stieß ein heiseres Krächzen aus, sein Mund fühlte sich wie ausgedörrt an.
Hauptmann Jenara, die Kommandantin der Soldatentruppe, musterte ihn aufmerksam. „Es geht vorbei, Heilkundiger, glauben Sie mir. Es ist nichts Schlechtes daran, Angst zu empfinden. Jeder vernünftige Soldat empfindet Angst. Das ist gut, Heilkundiger. Es macht ihn vorsichtig und hält ihn am Leben. Es ist nur wichtig, dass man sich dieser Angst nicht hingibt. Dass man sie überwindet, verstehen Sie?“ Ihre Stimme war ruhig und eindringlich und Theanos fragte sich, ob die Offizierin im Kampf wohl ebenso ruhig und überlegen wirkte. „Sie werden sich dieser Angst nicht hingeben, Theanos. Sie werden Ihre Instrumente vorbereiten, und wenn es so weit ist, Heilkundiger, dann werden Sie bereit sein. Es gibt eine Menge Leute auf diesem Schiff, die sich auf Sie verlassen. Ich tue dies ebenfalls.“ Ihr Mund verzog sich zu einem freundlichen Lächeln. „Und ich weiß, Heilkundiger, dass Sie keinen von uns enttäuschen werden.“
Sie nickte ihm zu und verließ das Krankenrevier, bevor der junge Arzt etwas erwidern konnte.
Er starrte dorthin, wo sie gestanden hatte, während ihre Schritte auf dem Gang verklangen. Es war seltsam, aber plötzlich fühlte er sich sehr viel ruhiger. Er sah auf seine Hände. Sie zitterten nicht. Theanos schloss die Augen, atmete einige Male tief durch und machte sich daran, sein Reich auf das Kommende vorzubereiten. Als die Sanitätshelfer eintraten, klangen seine Anordnungen ruhig und bestimmt, gerade so, als sei es Hauptmann Jenara, die an seiner Stelle sprach.
Die Delancer hatte mit Höchstfahrt gewendet und sich dabei kaum seitlich übergelegt. Die vielen scharfkantigen Stahlklingen unter ihrem Rumpf, die mehrere Meter lang waren, stabilisierten sie zusätzlich. Vor zwei Jahren hatte man festgestellt, dass die Erenok ihre Atemluft sehr lange anhalten konnten. Lange genug, um unter ein Schiff zu tauchen und ihm Schaden zuzufügen. Bei dem Schlachtschiff Condelar war ihnen das gelungen. Wie sie es genau geschafft hatten und wie viele der Spucker dabei ihr Leben verloren, war nie ergründet worden. Aber sie waren unter das neue Schlachtschiff geschwommen, hatten einige seiner Panzerplatten unter Wasser gelöst und dann Löcher in den hölzernen Rumpf gehackt. Hundert Männer und Frauen der Condelar hatten überlebt, die anderen waren mit ihrem Schiff versunken. Seitdem hatte man die scharf gezackten Klingen unter den Rümpfen angebracht und sie schienen wirkungsvoll zu sein.
Der alte Kreuzer hielt auf den Seeraum zwischen den beiden nördlichen Inseln des Reiches zu.
Die Kolben der Dampfmaschine stampften, Qualm stieg in einer mächtigen Wolke aus dem Schornstein auf und das Schaufelrad am Heck schien das Wasser zu peitschen. Dennoch zeichnete sich ab, dass die Erenok den Kreuzer einholen würden, lange bevor er die Inseln erreichte. Aber zwischen den Inseln patrouillierten andere Kriegsschiffe und auf ihnen würde man hoffentlich erkennen, in welcher Situation sich das alte Schiff befand. Sie würden nicht zögern, ihm zur Hilfe zu eilen. Die Delancer musste nur durchhalten, bis diese Hilfe eintraf. Und, wie ihr Kapitän schon festgestellt hatte, die Delancer konnte notfalls noch immer beißen.
„Eine knappe Stunde noch, dann haben sie uns“, stellte der Erste Offizier fest.
Kapitän Bart-Veldem lächelte kühl. „Dann sind sie auf Kampfentfernung heran, Erster, doch das heißt noch lange nicht, dass sie uns dann auch haben. Schön, lassen Sie klar Schiff zum Gefecht trommeln.“
Nels-Bedeat gab einen Wink nach vorne zur Brücke. Nur Augenblicke später traten die beiden Trommler der Seesoldaten hervor und begannen das Gefechtssignal zu schlagen.
Kapitän und Erster Offizier standen am Heckaufbau, in dem sich die Dampfmaschine und ihre Bedienungen abmühten, einen neuen Geschwindigkeitsrekord für die Delancer aufzustellen. Leutnant Tara, die Maschinenoffizierin, stand mit nacktem Oberkörper in der offenen Tür und ignorierte die mahnenden Blicke des Ersten Offiziers.
Sie wischte sich mit ihrem einst weißen Uniformrock den Schweiß von den Brüsten. „Ich frage mich wirklich, welcher Vollidiot in der Admiralität dem Maschinenpersonal weiße Uniformen zuordnet. Schwarz oder Grau wäre bei all dem Brennsteinstaub sehr viel angemessener.“
„Ich wäre eher für gepunktetes Tuch“, erwiderte der Kapitän lächelnd und ging damit auf ihr Spiel ein, bevor Nels-Bedeat seiner Empörung Luft verschaffen konnte.
„Ihre Uniform ist bestimmt bald verschmutzt“, meinte Tara und wies auf den Ersten. „Sie sollten von der Tür zurücktreten, sonst ruinieren Sie sich das schöne Weiß.“ Sie lachte breit. „Obwohl es ohnehin bald ein paar Blutflecken aufweisen wird.“
„Schön, nachdem wir uns nun über Äußerlichkeiten ausgelassen haben, sollten wir wieder auf wichtigere Dinge zu sprechen kommen.“ Der Kapitän wies auf das wirbelnde Schaufelrad. „Was haben Sie herausgeholt, Tara?“
„Noch drei Kilometer mehr pro Stunde.“ Die stämmige Frau betrachtete seufzend ihre Jacke, schüttelte sie aus und streifte sie dann achselzuckend über. „Aber nur, weil Garmos mit seinem breiten Hintern auf dem Sicherheitsventil sitzt.“ Ihr Blick wurde ernst. „Er sitzt schon ziemlich lange da drauf, Kapitän. Ganz im Ernst, lange werden wir diese Fahrt nicht mehr aufrechterhalten können. Die Kolben glühen fast, obwohl wir sie mit Wasser kühlen, und wenn Sie der Maschine ein bisschen zuhören, Kapitän, dann sind Sie versucht, freiwillig ins Wasser zu springen.“
„Verstehe“, brummte der Kapitän. „Sie meinen, wir müssen mit der Fahrt herunter?“