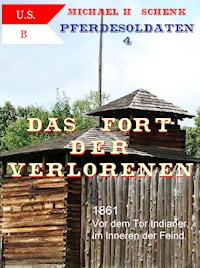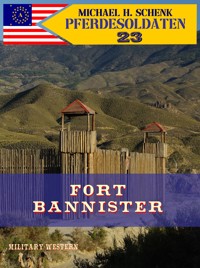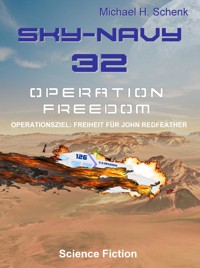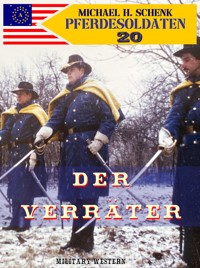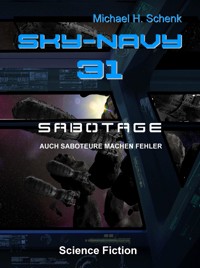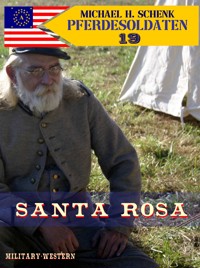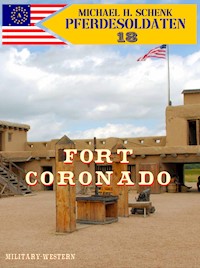
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
In "Fort Coronado" wird der junge Captain Mark Dunhill nach New Mexico versetzt. Hier muss es sich mit Banditen und Apachen auseinandersetzen sowie einem Kommandeur, der dringend nach Bestätigung sucht. Es geht hoch her im Grenzgebiet. Marks Kompanie wird mit unerfahrenen Rekruten, Ex-Konföderierten und straffälligen Unionssoldaten aufgefüllt. Konflikte sind vorprogrammiert und das zu einer Zeit, in der Kompanie "H" der fünften U.S.-Kavallerie nur durch Einigkeit bestehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michael Schenk
Pferdesoldaten 18 - Fort Coronado
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 Was bisher geschah
Kapitel 2 Die Spitze des Säbels
Kapitel 3 Die blutige Hand
Kapitel 4 Marschbefehl nach Süden
Kapitel 5 Die Kutsche
Kapitel 6 Kompanie „Q“
Kapitel 7 Der Rat der Chiricahuas
Kapitel 8 Schüsse
Kapitel 9 Stumme Zeugnisse
Kapitel 10 Flucht in die Freiheit
Kapitel 11 Fort Coronado
Kapitel 12 Die erste Patrouille
Kapitel 13 Die Soldaten des Kaisers
Kapitel 14 Von Kugel und Pfeil
Kapitel 15 Das Stirnband
Kapitel 16 Differenzen
Kapitel 17 Nächtlicher Eindringling
Kapitel 18 Auswirkungen
Kapitel 19 Eine alarmierende Nachricht
Kapitel 20 Feindkontakt
Kapitel 21 Das Wiedersehen
Kapitel 22 Vermisst
Kapitel 23 Kriegsrat
Kapitel 24 Der Treck
Kapitel 25 Der rote Parlamentär
Kapitel 26 Die Forderung
Kapitel 27 Konsequenzen
Kapitel 28 Entscheidungen
Kapitel 29 Strafexpedition
Kapitel 30 Im Sandsturm
Kapitel 31 Ein Zeichen der Geister
Kapitel 32 Die Stellung am Trail
Kapitel 33 Blutiges Ringen
Kapitel 34 Ein guter Tag zum Leben
Kapitel 35 Der Tag wird kommen
Kapitel 36 Karte südlicher Teil von New Mexico
Kapitel 37 Karte Fort Coronado und Umgebung
Kapitel 38 Karte Apachengebiete
Kapitel 39 Ankündigung
Kapitel 40 Historische Anmerkung: Apachen
Kapitel 41 Maße und Geschwindigkeiten
Kapitel 42 Persönliche Freiheiten in den Romanen
Kapitel 43 Bisher erschienen:
Kapitel 44 Hinweis: Für Freiheit, Lincoln und Lee
Impressum neobooks
Kapitel 1 Was bisher geschah
Pferdesoldaten 18
Fort Coronado
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2022
Während sein Vater Matt mit seiner fünften U.S.-Kavallerie gegen die Konföderation kämpft, wird Mark Dunhill mit seiner Freiwilligen-Kompanie „H“ in den Indianergebieten eingesetzt. In Fort Bridger erhielt er den Auftrag, nach einem großen Siedlertreck Ausschau zu halten, von dem man vermutete, dass er Waffen für die Konföderation von Kanada hinunter nach Texas transportieren sollte. Tatsächlich gelang es Mark, diesen zu finden und dabei in die Kämpfe zwischen dem Treck und Ute-Indianern einzugreifen. Nachdem es gelang, den Angriff gemeinsam abzuwehren, geriet die „H“-Kompanie in Gefangenschaft von Colonel Ronay und seiner konföderierten Raiders. Erneute Angriffe der Ute wurden abermals gemeinsam abgeschlagen, so dass man Mark und seinen Männern die Freiheit und Rückkehr nach Fort Bridger gewährte, während der Treck weiter nach Texas fuhr.
Marks Einsatz zum Schutz des Trecks wird ihm nun als Kollaboration mit dem Feind ausgelegt und so stellt man den jungen Captain im Fort Bridger vor ein Militärgericht.
Kapitel 2 Die Spitze des Säbels
Fort Bridger am Oregon-Trail, im Grenzgebiet zwischen Dakota und Utah.
Der Säbel lag auf dem Tisch, sorgfältig ausgerichtet und direkt vor dem Richter des Militärtribunals. Die Spitze zeigte nach links, der Korb nach rechts. Das Gericht hatte alle Zeugen befragt und beriet sich nun über seine Entscheidung. Würde man den Säbel mit der Spitze zum Angeklagten drehen, so war dieser schuldig. Zeigte der Korb zum Beschuldigten, so wurde dieser von jedem Fehlverhalten frei gesprochen und konnte seinen Dienst wieder aufnehmen.
Der vom Richterspruch betroffene Soldat war der junge Captain Mark Dunhill. Er wurde der Kollaboration mit dem Feind und des Verrats beschuldigt und in Zeiten des Krieges konnte ein Schuldspruch nur mit dem Tod enden.
Das Militärgericht war sich seiner Verantwortung bewusst und beriet sich nun schon fast eine Stunde, während alle anderen Beteiligten und die Zuschauer vor der Kommandantur des Forts darauf warteten, wieder eingelassen zu werden und die Entscheidung des Gerichts zu erfahren.
Neben Mark Dunhills Säbel lagen noch das Militärhandbuch und eine Bibel vor Colonel Daniel Probst, dem seine Aufgabe sichtlich unangenehm war, denn bei Mark handelte es sich immerhin um einen Offizier, der sich trotz seiner Jugend schon mehrfach bewährt hatte. Sein Vater war sogar Träger der Ehrenmedaille des Kongresses. Mark Dunhill schuldig zu sprechen würde somit für erhebliches Aufsehen sorgen.
Captain Archer, Befehlshaber von Kompanie „D“ der vierten Utah-Freiwilligeninfanterie, brachte es auf den Punkt. „Gentlemen, es wäre ein Skandal, Dunhill verurteilen zu müssen.“
Lieutenant Keller, Quartiermeister des Forts und Dunhills Verteidiger, nickte. „Man muss die besonderen Umstände seines Einsatzes bedenken.“
Decker, Captain der dritten California-Freiwilligenkavallerie und Ankläger, stieß ein missbilligendes Schnauben aus. „Und wenn schon. Der verdammte Kerl hat an der Seite von Rebellen gekämpft und zugelassen, dass ihr Waffentransport Texas erreicht. Der Bursche ist schuldig wie die Hölle.“
„Na, na“, brummte Probst, der als streng gläubiger Christ zwar an die Hölle glaubte, aber keine unchristlichen Flüche schätzte. „Mister Keller hat recht. Bei dem Treck waren Frauen und auch ein paar Kinder. Es wäre die Pflicht jedes guten Kavalleristen, diese gegen die Indianer zu verteidigen.“
Major Welton, zweiter Richter im Tribunal, hatte bislang geschwiegen. „Dunhills Akte ist beeindruckend. Er hat gegen Sioux gekämpft und auch gegen Konföderierte. Erst unlängst hielt er Camp Elliot und die Siedlung Stevensburg gegen eine erhebliche Übermacht der Rothäute. Sein Regiment ist längst aufgelöst, aber er und die Kompanie ‚H‘ der einstigen fünften Wisconsin haben sich einen solchen Namen gemacht, dass sie vom Gouverneur als Sonderkompanie beibehalten wurden. Er würde einen mächtigen Wirbel verursachen, wenn wir Dunhill nun verurteilen. Gerade jetzt, wo die Union endlich auf der Siegerstraße ist und die Rebellen an allen Fronten zurückdrängt.“
Ein leises Knurren von Decker, der sich prompt einen mahnenden Blick des Colonels einfing. Probst strich nachdenklich über die in Leder gebundene Bibel, die schon seit Generationen im Besitz seiner Familie war. „Nun, Gentlemen, wir haben Lieutenant Furbanks und die Männer der ‚H‘-Kompanie angehört und sie alle sprechen von einer Zwangslage, in der keine Wahl blieb, als vorübergehend an die Seite dieses Colonel Ronay zu treten. In Anbetracht der beim Treck befindlichen Zivilisten bin ich geneigt, mich dieser Meinung anzuschließen. Ich denke, darin sind wir uns einig. Ja, Captain?“
Decker räusperte sich. „Ich sehe dies nicht so, Sir, aber im Interesse der Union bin ich bereit, mich Ihrer Ansicht unterzuordnen, Sir.“
„Schön, dann wäre das ja geklärt“, seufzte Probst erleichtert. Er richtete den Blick auf einen Sergeant, der an der Tür Posten bezogen hatte. „Sergeant Teller, lassen Sie die Leute zur Urteilsverkündung wieder herein.“
Bevor der erste Teilnehmer durch die Tür trat, drehte der Colonel sorgfältig den Säbel von Mark Dunhill. Der Korb würde nun in Richtung des Angeklagten deuten, wenn dieser erneut vor das Militärgericht trat.
Kapitel 3 Die blutige Hand
Im Süden von New Mexico, zwischen Barrows Ranch und Fort Coronado.
Es hieß, dass Indianer in der Nacht nicht kämpften. Es hieß, dass ihre Seelen nicht in die ewigen Jagdgründe fanden, wenn sie bei Finsternis getötet wurden, und dass diese Seelen dann umherirren mussten. Die beiden jungen Kavalleristen hatten davon gehört und glaubten daran. Der Krieger, der sie in dieser Nacht beschlich, fürchtete weder die Dunkelheit noch ein Umherirren seiner Seele, denn er war zuversichtlich, dass es die Seelen der Weißaugen sein würden, die bald durch die Nächte streiften.
Die beiden unerfahrenen Soldaten gehörten zur Besatzung von Fort Coronado und waren als Patrouillenreiter zwischen den abgelegenen Hütten und Ranches der hier lebenden Weißen unterwegs. Wer auch immer ihnen den Befehl gegeben hatte, ohne erfahrene Kameraden aufzubrechen, der sah im Augenblick wohl keine Gefahr für sie. Seit Monaten waren keine mexikanischen Banditen mehr über die nahe Grenze gekommen und einst in der Gegend lebenden Jicarilla-Apachen waren schon 1858 befriedet worden. Einige von ihnen dienten nun sogar der U.S.-Army als Scouts.
Einer der Soldaten hatte sich in Mantel und Decke gehüllt, denn in den Nächten wurde es noch bitter kalt. Im Süden von New Mexico wechselten sich Sand, Geröll und Felsen mit Sand, Geröll, Felsen und ein paar Sträuchern oder vereinzelten Baumgruppen ab. Eine unwirtliche Gegend, die jedoch auch genug grüne Oasen aufwies, um vereinzelten Ranches ein Überleben und Auskommen zu ermöglichen.
Der andere Kavallerist war ebenso jung und unerfahren. Ab und an gab er ein paar dürre Zweige auf das kleine Feuer, damit es nicht ausging und man sich am Morgen einen Kaffee brühen konnte. Ansonsten saß er auf einem nahen großen Stein, den Sharps-Karabiner in der Armbeuge und mehr auf die kleinen Flammen, denn auf die Umgebung achtend.
Der Krieger verstand sich darauf, sich entgegen der Windrichtung anzuschleichen und keine Geräusche zu verursachen. Die Nase des Wachpostens war sicherlich ebenso unempfindlich wie dessen Ohren. Der Krieger hätte seinesgleichen durchaus riechen können, denn Apachen ernährten sich oft von Pemmikan und rieben sich, zum Schutz gegen Insekten, mit Fett ein, so dass ihnen eine typische Ausdünstung anhaftete, ähnlich dem Tabakgeruch der Weißen.
Die Füße des Kriegers glitten mit traumwandlerischer Sicherheit über den Boden. Er trug die einzigartigen Mokassins seines Volkes, die bis auf die Waden reichten. Die Spitzen waren vorne nach oben gebogen und ähneltem dem umgekehrten Schnabel des Adlers. Die Sohlen waren mit Gras gepolstert und erlaubten es dennoch, jede Unebenheit im Boden und jeden Stein zu spüren.
Der Krieger war fast am Ziel. Er brauchte nur noch den Arm auszustrecken und mit dem Messer zuzustoßen.
Es war ein gutes Messer.
Es glitt ganz leicht durch Mantel, Jacke, Hemd und Unterzeug und zwischen die Rippen. Der junge Pferdesoldat der Weißaugen öffnete den Mund zu einem Schrei, doch sein Mörder drehte die Klinge leicht und eröffnete die Lunge. Mit einem merkwürdigen Seufzer sackte der Tote im Griff des Apachen zusammen, der mit der freien Hand den Karabiner auffing. Der Mörder hielt sein Opfer fest und genoss das Gefühl, wie das warme Blut über seine Finger und die Hand sickerte.
Dies war die Art, wie alle Pferdesoldaten sterben sollten, dies war die Art, wie der Krieger zu seinem Namen gekommen war: Dit-laa, Bloody Hand.
Sorgsam ließ der Krieger die Leiche zu Boden sinken, jedes Geräusch vermeidend.
Für einen Moment stand Dit-laa in geduckter Haltung da. Es wäre nun ein Leichtes gewesen, auch das andere Weißauge zu töten, welches noch immer ahnungslos schlief. Doch der Apache war ein kluger Krieger. Sicher, der Tod der Männer mochte Furcht in die Weißaugen der Festung senken, doch diese Furcht wurde noch ungleich größer, wenn sie von jenem Soldaten verbreitet wurde, der am Morgen entsetzt feststellen musste, wie nahe er selbst dem Tode gewesen war.
Ja, noch viele Weißaugen würden durch seine Hand sterben und die anderen seinen Namen fürchten lernen: Dit-laa, die blutige Hand der Chiricahua.
Kapitel 4 Marschbefehl nach Süden
Fort Bridger am Oregon-Trail, im Grenzgebiet zwischen Dakota und Utah.
Mit dem ersten Morgenlicht hatte der Hornist vom Dienst die Reveille zum Wecken geblasen. Nach Feststellung der Vollzähligkeit beim Roll-Call war es zum Frühstück gegangen, anschließend das erneute Antreten, diesmal jedoch unter Waffen und in Paradeuniform. Mit dem Call-to-Colors war die große Unionsfahne am Flaggenmast aufgestiegen. An diesem Tag folgte der Church-Call, der alle Soldaten zum Gottesdienst rief. Die Predigten von Father William galten allerdings nicht nur dem Militär, sondern auch den in der Nähe des Forts lebenden Zivilisten, weswegen der Gottesdienst außerhalb des Forts auf dem angrenzenden Übungsplatz abgehalten wurde. Auch etliche der hier lebenden Indianer kamen herbei, um dem stimmgewaltigen Prediger zuzuhören. Einige von ihnen waren Christen geworden, doch die meisten der Ureinwohner waren einfach neugierig. Jene, die des Englischen mächtig waren, übersetzten die Worte von Williams in ihr eigenes Idiom.
Wie üblich nahm Father Williams Bezug auf örtliche Ereignisse und es machte Mark Dunhill ein wenig verlegen, als der gottesfürchtige Mann von der Gerechtigkeit des Herrn sprach, der eine Verurteilung des braven Captains Dunhill nicht zugelassen habe. An diesem Tag sprach Williams überraschend versöhnlich über die Konföderierten. Während sich sonst der Zorn des Herrn, mit einer großzügigen Portion Feuer und Schwefel, über die „Rebellenbrut“ ergoss, sprach Williams nun von fehlgeleiteten Brüdern und Schwestern, denen der Herr sicher die Irrtümer verzieh und ihnen großmütig die Rückkehr in die Arme der Union ermöglichen werde.
Dieser Wandel in den Predigten war sicher ein Anzeichen dafür, dass man das Ende des unseligen Krieges nahen spürte. Aus Washington war zu hören, dass sich Abraham Lincoln massiv für die Versöhnung mit dem Süden aussprach.
Nach den Chorälen „The Minstrel Boy“ und „Onwards Christian Soldier“ war die Gemeinde zur Dress-Parade entlassen. Hier würden die in Fort Bridger stationierten Truppen an ihrem Kommandeur und der Gemeinde vorbeiparadieren. Eine willkommene Gelegenheit für die Truppen, sich auf möglichst eindrucksvolle Weise zu präsentieren.
Überall, wo das Militär die Fahne der Union repräsentierte, lief der Sonntag nach demselben Muster ab. Gleichgültig, ob in einer großen Garnison des Ostens oder einem kleinen Stützpunkt am Rande des Indianergebiets, man zeigte Flagge und stellte sich bestmöglich dar.
Fußtruppen und berittene Einheiten trugen ihre Paradeuniformen. Die Infanterie mit den langen Frockcoats, an denen die Epauletten aus Messing blitzten, auf den Köpfen die schwarzen Hardeehüte mit den gleichfarbigen Straußenfedern, den Quastenschnüren in hellem Blau und blinkenden Adlerplaketten, welche die linke Hutkrempe an die Krone hefteten, damit das an die Schulter gelegte Gewehr mit dem Bajonett Platz fand. Die Reiter hatten hingegen die rechte Krempe nach oben, denn bei ihnen lag der Säbel an der dortigen Schulternaht. An ihren taillenkurzen Shelljacketts war ebenfalls der Säbelschutz in Form der Messingepaulette befestigt und an den Jacken leuchtete der Besatz in der gelben Farbe der Kavallerie. An den Stehkragen war eine einzelne Litzenschlaufe zu sehen, denn in Bridger waren Freiwillige stationiert, während die Angehörigen der regulären U.S.-Kavallerie zwei Litzenschlaufen am Kragen zeigten.
Colonel Daniel Probst und sein Stellvertreter, Major Welton, zeigten sich mit der sonntäglichen Parade sichtlich zufrieden und Betty, die Frau des Colonels, lud, wie üblich, die Offiziere zu einem anschließenden Umtrunk im Privatquartier des Kommandeurs.
Mark Dunhill erhielt überrascht die Bitte, sich zuvor in der Kommandantur einzufinden. Da diese Aufforderung auch für seinen Stellvertreter, Lieutenant Ted Furbanks galt, ahnte Mark, dass es nicht alleine um ihn, sondern die weitere Verwendung seiner Kompanie ging. So bat er First-Sergeant Jim Heller, sie beide zu begleiten.
Für die Truppen galt hingegen der normale Dienst, noch immer im Full Dress, um die noch anwesenden Gäste auch weiterhin zu beeindrucken. Während die Infanterie sich auf dem Appellplatz des Forts in den verschiedenen Formationen übte, vollzog Marks Kompanie „H“, gemeinsam mit den anderen anwesenden Kavalleristen, den üblichen berittenen Säbeldrill auf dem Übungsplatz außerhalb der Anlage. Noch immer war die Blankwaffe im Nahkampf eine Hauptwaffe der berittenen Einheiten, denn war der Revolver leer geschossen, so blieb oftmals keine Zeit zum Nachladen dieser Waffe oder des Karabiners. Wer sich dann mit Lanze, Kriegsbeil, Schädelkeule oder Messer eines indianischen Reiters konfrontiert sah, der war froh, fast einen Meter blanken Stahls auf seiner Seite zu wissen.
Jim Heller folgte den beiden Offizieren mit dem vorgeschriebenen Abstand, in der Hand sein kleines schwarzes Buch, in dem der First-Sergeant sorgfältig alle Ereignisse der Kompanie sowie Namen und Rang ihrer Zugehörigen mit Bleistift notierte. Derzeit ein wichtiger Nachweis für die offensichtliche Schwäche der Kompanie. Von der einstigen Sollstärke von einhundert Männern standen Mark nur vierundzwanzig zur Verfügung. Von diesen litten vier noch unter den Nachwirkungen ihrer Verletzungen und waren daher nicht voll einsatzfähig. Somit hatte Kompanie „H“ der fünften Wisconsin-Freiwilligenkavallerie kaum noch die Stärke eines Platoons.
Mark Dunhill und Ted Furbanks respektierten einander und doch verspürte man immer wieder eine gewisse Reserviertheit bei Furbanks, der oft ein wenig steif wirkte. Sein langer Uniformrock saß tadellos. Knoten und Quasten der roten Seidenschärpe waren exakt nach Vorschrift gebunden. Kein Fleckchen verunzierte das Weiß seines „Vatermörder“-Kragens. Obwohl sich auch Mark redliche Mühe gegeben hatte, wirkte er neben Ted stets ein wenig nachlässig gekleidet, was im Grunde auch für Jim Heller, den ehemaligen Trapper, galt.
Ein Quartermaster-Sergeant (Company-Grade) der Infanterie führte sie ins Büro des Colonels, der hinter seinem Schreibtisch saß und in einem Schriftstück las. Er lächelte freundlich, als die drei eintraten, und bot ihnen Platz und Kaffee an.
„Gentlemen, Sie werden sich sicherlich fragen, warum ich Sie außer der Reihe zu mir gebeten habe“, begann Probst ein wenig zögernd, „doch nachdem Sie alle vom Militärgericht entlastet worden sind, müssen wir über die weitere Verwendung Ihrer Kompanie sprechen. Zumal mir hierzu ein Schreiben des Kriegsministeriums zugegangen ist. Ein Schreiben, welches wohl auch auf Initiative von Präsident Lincoln beruht.“ Ein abschätzender Blick traf Mark. „Offensichtlich hegt Mister Lincoln ein persönliches Interesse an Ihrem Schicksal, Mister Dunhill, was wohl im Zusammenhang mit Ihrem werten Herrn Vater steht.“
Mark errötete ein wenig, verzichtete aber auf jeglichen Kommentar, obwohl der Colonel diesen zu erwarten schien. Schließlich räusperte sich Probst. „Nun, schön, wie dem auch sei … Sie haben sich einen gewissen Ruf erworben, Captain Dunhill, und dies gilt zweifellos ebenso für Ihren Herrn Vater, der ja bekanntlich Träger der Tapferkeitsmedaille ist. Wie Sie ja wissen, dient er in der fünften U.S.-Kavallerie und wurde unlängst zum Lieutenant-Colonel befördert.“
Letzteres war Mark neu und er freute sich über die Beförderung seines Vaters Matt. Zweifellos hatte dieser ihm geschrieben, doch gelegentlich nahm die Beförderung der Feldpost einige Zeit in Anspruch, so sehr man sich auch um eine rasche Zustellung verdient machte.
Erneut ein Räuspern von Probst, der das Schreiben nun sinken ließ. „Normalerweise bin ich gegen das Protegieren und die Ausnutzung gewisser, äh, Beziehungen, doch in Ihrem Fall und im Fall Ihrer Kompanie kann ich dies durchaus begrüßen. Wie Sie ja wissen. ist Ihre Kompanie überzählig, denn das Regiment, dem sie ursprünglich eingegliedert war, wurde ja inzwischen aufgelöst, da die Dienstzeit abgelaufen ist. Aufgrund der besonderen Leistungen Ihrer Kompanie ‚H‘ hat der Gouverneur von Wisconsin diese jedoch als Sonderkompanie im Dienst behalten. Was allerdings die Zuordnung von Ausrüstung und Ersatz ausgesprochen schwierig gestaltet.“
Mark und seine Begleiter sahen sich kurz an. Dieses Problem beschäftigte sie alle. Es gab kein für sie zuständiges Regiment mehr. Somit keinen direkten Nachschub an Ausrüstung oder Personal. Seit der Entlassung des Regiments zehrte die Kompanie von dem, was andere ihr übrig ließen. Nur selten fand sich ein Freiwilliger, der sich ihr anschloss. und mancher Zahlmeister vergewisserte sich erst beim Gouverneur in Wisconsin, ob der Truppe tatsächlich Sold zustand. Manches Ausrüstungsteil musste privat erworben werden. Glücklicherweise war das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Kompanie dermaßen ausgeprägt, dass die Soldaten immer wieder zusammenlegten. Mark und Ted steuerten den größten Teil ihres Soldes bei. Mark tat dies. weil ihm die Männer am Herzen lagen, bei Ted war es eher so, dass die Existenz der Kompanie seinen Offiziersrang rechtfertigte.
Daniel Probst schien auch jetzt auf eine Erwiderung zu warten und wurde erneut enttäuscht. Schließlich seufzte er vernehmlich. „Na schön, wo war ich? Ah, ja, Organisation … Nun, Gentlemen, auf Grund der bislang erlittenen Verluste musste das fünfte Regiment der U.S.-Kavallerie reorganisiert werden. Teilweise umfasste es nur noch knapp sechzig Säbel“, erläuterte der Colonel und machte sich zu Eigen, dass die Stärke einer Kavallerieeinheit oft mit der Anzahl ihrer Säbel bezeichnet wurde. „Diese Reorganisation wurde seitens des Secretary of War vorgenommen. Es wird Sie sicherlich freuen, Gentlemen, dass Ihre Kompanie dabei, auf ausdrückliche Empfehlung des Präsidenten, berücksichtigt wurde. Mister Dunhill, Mister Furbanks, Ihre Kompanie gehört nunmehr offiziell als Kompanie ‚H‘ zum fünften Regiment der U.S.-Kavallerie.“
Mark und seine Begleiter waren perplex. Mit einer derartigen Überraschung hatte keiner von ihnen gerechnet und plötzlich schien sich manches Problem mit einem Schlag in Luft aufzulösen.
Ted Furbanks schien misstrauisch und wollte sich vergewissern. „Heißt das, Sir, dass wir nunmehr Bestandteil des fünften Regiments sind und dieses für uns zuständig ist?“
„Mit sofortiger Wirkung, Mister Furbanks, mit sofortiger Wirkung“, bestätigte Probst, den die Überraschung seiner Besucher amüsierte. Er legte die Fingerspitzen aneinander. „Sold, Ausrüstung und neue Mannschaften werden Ihnen nunmehr von Ihrem neuen Regiment zugewiesen. Das, äh, gilt rückwirkend mit dem Datum des Schreibens.“
Ted warf einen unsicheren Blick auf Mark. „Colonel, darf ich fragen, wie es um unsere Bestallungen steht?“
Die Bestallung bestand aus einer Urkunde, der „Commission“, welche einem Offizier seinen Rang und sein Regiment zuwies und jeden Offizier, in einer geteerten Papp- oder Lederröhre geschützt, zu seinen Standorten begleitete.
Probst wusste sehr genau, worauf Ted anspielte. „Mister Furbanks, seitens des Secretary of War wird Captain Dunhill in seiner Funktion als regulärer Captain in der fünften U.S.-Kavallerie geführt und Sie als First-Lieutenant im gleichen Regiment. Meine Gratulation zu dieser Graduierung, Gentlemen. Damit werden Ihnen Ihre Ränge nicht als Brevet-Rang, also auf Kriegszeit begrenzt, verliehen.“ Probst sah das erleichterte Aufatmen von Ted. „Dennoch, Gentlemen, muss ich Sie natürlich darauf hinweisen, dass mit Ende des Krieges eine erneute Reorganisation der Army stattfinden kann, die sich möglicherweise auch auf Ihre Ränge auswirkt.“
Diese Aussicht gefiel den beiden Kompanieoffizieren natürlich nicht, noch daran ließ sich nichts ändern. Das Damoklesschwert einer Umorganisation mochte über dem Kopf eines jeden Offiziers in der regulären Armee schweben.
Mark brannte im Augenblick auch ein ganz anderes Thema unter den Nägeln. „Haben Sie denn von Nachschub für uns gehört, Sir?“
Probst seufzte. „Da der Secretary of War über die Situation Ihrer Truppe informiert ist, dürfte sich der Nachschub bereits auf dem Weg befinden.“
Jim Heller bat ums Wort. „Colonel, Sir, wissen Sie zufällig, was wir …?“
Probst schüttelte den Kopf. „Darüber bin ich nicht informiert, Sergeant. Im Übrigen wird der Nachschub für Sie auch nicht nach Fort Bridger geschickt, sondern ist auf dem Weg in Ihren neuen Dienstbereich.“
„Sir?“ Das fragende Wort kam unisono aus drei Mündern.
Probst legte das Schreiben nun zur Seite, nahm einen langen Schluck Kaffee und wandte sich dann der Karte zu, die neben seinem Schreibtisch an der Wand hing. Er benutzte einen Queue des in der Offiziersmesse stehenden Billards als Zeigestab. Mit leisem Tippen der Spitze auf verschiedene Punkte der Karte, bekräftigte er seine Ausführungen.
„Gentlemen, Fort Bridger liegt ja, wie Ihnen bekannt ist, am westlichen Ende des Bridger Passes der Rocky Mountains und damit im Dreieck zwischen den Staaten Idaho, Utah und Colorado, und an der Grenze des nordöstlichen Indianergebietes. Auf Grund gewisser, äh, Umstände, hat man beschlossen, Ihre Kompanie in ein Gebiet zu versetzen, in dem Sie schwerlich mit Konföderierten in Kontakt kommen dürften. Ihre Truppe wird nach Fort Coronado, an der Grenze zwischen New Mexico und der Republik Mexiko, versetzt.“
„Das sind sechs- bis siebenhundert Meilen, Sir“, überschlug Ted Furbanks.
„Wenn Sie ein Vogel wären, Mister Furbanks“, bestätigte Probst lächelnd. „Zu Fuß oder Pferd ist die Distanz doch noch ein wenig größer. Aber keine Sorge, einen guten Teil des Weges werden Sie mit der Eisenbahn zurücklegen. Inzwischen ist die Strecke der Rio Grande Rail Road größtenteils fertiggestellt. Vierzig Meilen südlich von Bridger stoßen Sie auf einen Haltepunkt der Bahn und werden von dort, überwiegend am Rio Grande entlang, bis nach Lareno Creek fahren. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung von rund hundertfünfzig Meilen bis zum Fort. Wobei Sie allerdings einen kleinen Umweg machen müssen. Hier, knapp achtzig Meilen südwestlich von Lareno Creek, liegt der Ort Derning. Weitere zwanzig Meilen westlich, in Richtung auf Lordsburg, liegt Fort Seldon. Ein Militärposten, dessen Verlegung nach Osten in Vorbereitung ist. Doch davon abgesehen werden Sie in Seldon Ihren Nachschub vorfinden. Anschließend begeben Sie sich, von Fort Seldon aus, auf schnellstem Weg nach Camp Coronado.“
„Texas ist nicht allzu weit entfernt“, brachte Mark in Erinnerung.
„Sicher, aber zwischen Coronado und Texas liegt Fort Bliss, eine unserer stärksten Garnisonen im Süden“, wiegelte der Colonel ab. „Höchst unwahrscheinlich, dass sich Rebellen bis Fort Coronado verirren.“
„Bestehen Zweifel an unserer Treue zur Union?“, fragte Ted Furbanks geradeheraus und warf einen raschen Blick zu Mark, dem man ein gewisses Verständnis für die Konföderierten scheinbar nicht absprechen konnte.
Marks Augen erwiderten den Blick seines Stellvertreters entsprechend kühl.
Probst registrierte ein Aufflackern von Unmut zwischen den beiden Offizieren und tippte etwas nachdrücklicher gegen die Karte. „Dem Department of War liegt eine dringende Bitte von Major Selkirk, dem Kommandanten von Fort Coronado vor. Offensichtlich gibt es nicht unerhebliche Aktivitäten mexikanischer Banditen im Grenzbereich. Möglicherweise auch ein paar rebellische Indianer.“
„Apachen, nicht wahr?“, kam es von Ted, der wieder einmal seine Belesenheit unter Beweis stellte.
„Vermutlich“, räumte Probst ein. „Wobei dort unten allerdings auch immer wieder Kiowas und Comanchen aktiv werden. Nun, Gentlemen, darüber wird man Sie in Seldon, und natürlich auch Coronado, besser ins Bild setzen können.“ Er legte den improvisierten Zeigestab zur Seite. „Sie werden übermorgen, nach dem ersten Roll-Call, aufbrechen. Nutzen Sie den morgigen Tag also für die entsprechenden Vorbereitungen. Bis dahin habe ich auch den Transportschein für Ihre Bahnreise ausgefertigt. Noch Fragen, Gentlemen?“
Mark nickte. „Eine nicht unwesentliche, Sir. Unsere Männer hatten sich für die fünfte Wisconsin verpflichtet und blieben dann freiwillig bei ‚H‘, als dass Regiment aufgelöst wurde. Jetzt gehört unsere Kompanie zur fünften U.S.-Kavallerie. Wie ist der Status unserer Männer?“
„Yeah, gut, dass Sie fragen, Mister Dunhill. Mit der Übernahme der Einheit in die fünfte U.S. ist natürlich die freiwillige Verpflichtung Ihrer Männer hinfällig. Das fünfte Regiment der U.S.-Kavallerie bestätigt aber die Übernahme aller in seine Stammrolle, die sich nun für das Regiment entscheiden. Sie sollten das abklären, Captain, und ich hoffe in Ihrem Sinne, dass viele der Männer bei Ihnen bleiben wollen. Immerhin ist es fraglos eine bewährte und kampferprobte Truppe, nicht wahr?“
Jim Heller grinste breit. Er war sich sicher, dass keiner der Männer die verschworene Kameradschaft verlassen würde. Jene, die familiäre oder sonstige Bindungen hatten, waren bereits mit Auflösung der fünften Wisconsin ausgeschieden. Nein, die Männer würden bleiben. Aber der morgige Tag würde mit viel Arbeit verbunden sein. Vorräte und Munition mussten bereitgestellt werden, alle Ausrüstung war zu überprüfen und der Schmied des Forts würde etliche der Pferde neu beschlagen müssen, damit sich auf dem langen Weg kein Hufeisen lockerte.
Sie waren entlassen und Probst erinnerte sie daran, dass in seinem Haus ein kleiner Umtrunk wartete. Es würde sicher interessant werden, denn die anderen Offiziere wussten noch nichts von den Veränderungen.
Jim machte sich auf den Weg zur Kompanie, um den Männern die Neuigkeiten mitzuteilen, während Mark und Ted zunächst der Einladung des Colonels folgten, denn diese zu verweigern wäre eine grobe Unhöflichkeit gewesen.
Während die beiden Offiziere zum Privatquartier der Eheleute Probst schritten, sah Ted seinen Vorgesetzten nachdenklich an. „Gute Neuigkeiten, wie?“
„Das kann man wohl sagen“, bestätigte Mark. „Endlich hat die Kompanie wieder ein Regiment und damit ein Heim.“
Gelegentlich zeigte Ted Furbanks, dass er mit gewissen Dingen nicht wirklich einverstanden war, was sich dann darin äußerte, dass er Mark wieder mit dem förmlichen Sie und Sir ansprach. Dies war auch nun der Fall. „Sieht ganz so aus, als hätte Ihr Vater da einige Beziehungen spielen lassen.“
„Wovon Sie sicherlich auch Ihren Vorteil haben, Ted“, entgegnete Mark freundlich. „Immerhin sind Sie nun First-Lieutenant in einem regulären Regiment.“
„Womit wir eine gute Chance haben, nach dem Krieg weiterhin als Offiziere übernommen zu werden.“
Mark nickte lächelnd. Für ihn war etwas anderes von weit größerer Bedeutung. Er und sein Vater Matt dienten nun im gleichen Regiment und so würde sich vielleicht die Chance ergeben, bald auch gemeinsam Dienst zu tun. In jedem Fall würde er heute noch zwei Briefe auf den Weg bringen. Einen an seinen Vater, der mit der Fünften im Feld stand, und einen an seine Mutter Mary-Anne, eine Südstaaten-Schönheit, die lange vor Kriegsausbruch ihren Unionsoffizier geheiratet hatte und seitdem getreulich an seiner Seite stand, auch wenn es den Eheleuten und auch Matt nur selten vergönnt war, sich persönlich zu begegnen.
Die beiden Kavallerieoffiziere erreichten gerade das Quartier der Eheleute Probst, als vom Übungsplatz vor dem Fort lauter Jubel zu hören war.
Mark lächelte erneut. Die Gemeinschaft der Kompanie „H“ bewährte sich erneut und würde weiterhin geschlossen bleiben.
Kapitel 5 Die Kutsche
Bahnstation von Lareno Creek, am Rio Grande, im Süden von New Mexico.
Kompanie „H“ musste einige Stunden am Haltepunkt der Rio Grande Bahnlinie warten und Mark postierte die Wachen sorgfältig, auch wenn die hier lebenden Indianer im Augenblick keine kriegerischen Absichten zeigten. Die Ute hatten in den vergangenen Kämpfen deutliche Verluste hinnehmen müssen, woran Mark und seine Männer keinen unwesentlichen Anteil trugen. Dennoch waren die Kavalleristen vorsichtig.
Der Zug, mit einem Dutzend Personen- und Frachtwaggons, gehörte zur U.S.M.R.R., der United States Military Rail Road und so benötigte Mark nicht einmal den von Colonel Probst ausgefertigten Transportschein. Die für die Zwecke der Unions-Armee beschlagnahmten Züge beförderten Truppen und Material kostenlos und schnell. Die verstärkte Nutzung des immer weiter ausgebauten Streckennetzes sowie das dichter werdende Telegrafennetz trugen nicht unerheblich zum Sieg über die Konföderation der Südstaaten bei.
In dem Zug reiste eine Abteilung Infanterie, die für Fort Bliss bestimmt war, und Mark, Ted, Jim und der alte Scout Kentucky nutzten die Zeit, sich mit den Infanterieoffizieren zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Die Öffentlichkeit mochte glauben, dass die Kämpfe gegen Indianer nur von der Kavallerie ausgefochten wurden, doch das entsprach nicht den Tatsachen. Infanterie hielt die Forts und Camps besetzt und eskortierte sogar die Transporte, die durchs Indianergebiet führten, denn es fehlte immer wieder an genug berittenen Truppen.
In der kleinen Bahnstation von Lareno Creek verließ die Kompanie den Zug und schlug die Richtung nach Südwesten ein, um den Ort Derning und die Straße nach Lordsburg zu erreichen, an der Fort Seldon lag.
Die Truppe befand sich nun in New Mexico und die Landschaft veränderte sich drastisch. Statt der dichten Wälder im Norden und dem dortigen fruchtbaren Grasboden, begegnete man hier einer deutlich unfruchtbaren und trockeneren Gegend. Wälder waren selten und meist gab es nur Gruppen von Bäumen, die sich über einem eher kargen und von Sand und Fels bedeckten Boden erhoben. Inseln aus Gras bildeten grüne Tupfen und die Anzahl und Größe der Kakteen schien immer mehr zuzunehmen, je weiter man nach Süden vordrang und sich der Grenze von Mexico näherte. Entlang der Flussläufe gab es wiederum blühende Landschaften mit dichtem Grasbewuchs. Am eindrucksvollsten erschien den Männern jedoch die Veränderung der Berge. Wo sie zuvor aufragende Gipfel gesehen hatten, waren es nun Tafelberge und steil aufragende Felsengruppen, deren Oberteil wie abgeschnitten wirkte.
Mehrmals beobachteten die Männer Antilopen und anderes Wild, darunter auch Rinder, die wohl von ihren Ranches fortgelaufen waren. Hin und wieder sahen sie kleine Herden von Büffeln oder Wildpferden. Gelegentlich stieß man auf Spuren unbeschlagener Hufe oder die Abdrücke von Mokassins, aber ihre Besitzer verbargen sich vor den Blicken der Weißaugen.
Insgesamt war es ein bislang ereignisloser Ritt, als man Derning erreichte. Die Kompanie rastete nur kurz, um die Pferde zu versorgen, denn die Order lautete, sich schnellstmöglich nach Fort Seldon zu begeben.
Nun ging es auf der Überlandstraße entlang, die von Las Cruces über Derning nach Lordsburg führte. Die staubige Straße war gut an den Furchen zu erkennen, welche zahlreiche eisenbeschlagene Radreifen in den harten Boden frästen. Immer wieder wurden Stein, ausgetrocknete Erde und hart gebackener Lehm von feinem Sand abgelöst. Letzterer wirbelte unter den Hufen der Pferde oder den Stiefeln der Männer auf, wenn die Soldaten ihre Pferde führten, um sie frisch für eine rasche Attacke zu halten. Der viele Staub setzte sich auf die Uniformen, die zunehmend Grau gepudert waren. Da sich die Gruppen am Ende der Kolonne abwechselten, litten alle Kavalleristen unter dieser Begleiterscheinung. Auf einige Entfernung mochte man die Abteilung für Konföderierte halten. Um etwaige Beobachter von einem Irrtum abzuhalten, befahl Mark daher, den schwalbenschwanzförmigen Wimpel aus der Schutzhülle zu nehmen. Das Seidentuch mit dem Motiv des Unionsbanners, bei dem die goldenen Sterne allerdings in zwei konzentrischen Kreisen und mit vier zusätzlichen Sternen in den Ecken angeordnet waren, bildete mit seinem kräftigen Rot, Weiß und Blau einen auffallenden Kontrast zu den Farben der Umgebung.
Corporal Tanner, der Wimpelträger der Kompanie, führte das bunte Tuch mit sichtlichem Stolz. Er hatte es schon durch manchen Kampf getragen und jedes Loch und jeden Riss mit geschickten Händen sorgfältig geflickt. Das Feldzeichen nun dem aufwirbelnden Staub auszusetzen, behagte ihm daher nicht besonders. Zwar konnte man den Seidenstoff waschen, doch die Sterne waren nicht aufgenäht, sondern mit goldener Farbe aufgetragen worden. Wind, Wetter und Sonne ausgesetzt, wurde diese Farbe nun allmählich brüchig und Tanner hoffte, sie bald ausbessern zu können.
Gewohnheitsmäßig ließ Mark die kleine Abteilung mit Vor- und Nachhut marschieren, auch wenn diese nur aus je zwei Reitern bestand. Vier weitere Kavalleristen flankierten die Kolonne. First-Sergeant Jim Heller und Kentucky verließen sie immer wieder, um sich im Umfeld nach Anzeichen von Indianern oder anderen gefährlichen Lebewesen umzusehen.
„Bewegung auf der Straße hinter uns“, wurde von hinten nach vorne weiter gemeldet.
Mark zügelte sein Pferd, nachdem er es ein wenig zur Seite gezogen hatte. Jetzt konnte er eine Staubwolke sehen, die sich von hinten näherte. Auf die Entfernung verrieten die dunklen Konturen in ihr nicht, ob es sich um Reiter oder Gespanne handelte. Während die Kompanie langsam im Schritt an ihm vorbeitrottete, zog er sein Fernglas hervor und versuchte Einzelheiten zu entdecken.
Schließlich war er sich sicher und ließ die Kompanie halten.
Prompt kamen Ted Furbanks und Standartenträger Tanner sowie erster Hornist Luigi Carelani an seine Seite. Ersterer aus Neugierde, Tanner, um den Standort des Kommandeurs durch den Wimpel kenntlich zu machen, und Luigi, um die Befehle des Captains sofort in Hornsignale umsetzen zu können.
„Keine der häufigen Postkutschen, sondern eine der großen Überlandkutschen“, murmelte Mark. „Bis zu neun Passagiere und acht Gespannpferde. Sie fährt ziemlich schnell, aber das ist im Grunde nichts Ungewöhnliches.“
Die Betreiber der Kutschenlinien unterhielten eine Vielzahl von Pferdewechselstationen, in denen man die Gespanne wechselte und sich die Reisenden kurz erfrischen und stärken konnten. Die sechs bis acht Pferde der großen Gespanne wurden häufig angetrieben, um die Fahrzeit zu verkürzen und möglichen Gefahren durch Schnelligkeit auszuweichen. Im Gegensatz zu den kleineren Stagecoaches konnten die Overlandcoaches jedem berittenen Angreifer ein gutes Rennen liefern und ihm oft einfach davonfahren.
Neben dem Fahrer saß der Begleiter auf dem hohen Kutschbock. Beide Männer waren mit Revolvern und Gewehren bewaffnet, wobei der Begleiter zusätzlich über eine doppelläufige Schrotflinte verfügte, oft mit abgesägten Läufen, was zwar die Reichweite verkürzte, die Streuung aber erhöhte.
Als die Kutsche ausrollte und schließlich auf Höhe des Wimpels zum Stehen kam, wurden die Köpfe mehrerer Passagiere sichtbar, darunter eine ältere Lady, die rasch eine Lorgnette vor die Augen führte, um erkennen zu können, weswegen das Gefährt wohl anhielt.
„Howdy, Captain“, grüßte der Begleiter. „Gut, Sie und Ihre Jungs zu sehen. Auf Patrouille aus Seldon?“
„Lady, Gentlemen …“ Mark tippte grüßend an seinen schwarzen Feldhut und beantwortete dann die Frage. „Nein, Mister, wir sind zwar auf dem Weg nach Fort Seldon, sollen dann aber weiter nach Fort Coronado.“
„Also Verstärkung für Coronado“, stellte der Kutscher fest, beugte sich ein wenig zur Seite und spuckte einen Priem Kautabak in den Straßenstaub. „Wird auch Zeit, dass die Army endlich etwas unternimmt. Rothäute, Bandoleros und jede Menge weißes Gesindel, was sich neuerdings da unten herumtreibt. Manchmal kommen die sogar bis hier herauf.“
„Wurden Sie angegriffen?“, erkundigte sich Mark besorgt.
„Nein, wir hatten bislang Glück. Aber letzte Woche hat es Franky erwischt.“ Ein erneuter Tabakstrahl färbte den sandigen Boden. „War der Begleitschütze. Den haben die roten Bastarde einfach vom Bock geschossen“, erklärte der braungebrannte Mann missmutig. Einen Passagier haben sie verwundet, aber Timothy konnte ihnen dann doch noch entkommen.“
„Tim Barton war der Kutscher“, ergänzte der Begleitschütze. „Der beste Gespannführer im ganzen Süden. Von Brady natürlich abgesehen.“
Das Grinsen des Kutschers verriet, wer mit Brady gemeint war.
„Haben Sie auf Ihrer Fahrt etwas Verdächtiges gesehen?“, hakte Mark nach. „Anzeichen von Indianern oder Banditen?“
„Nein, aber das hat nichts zu besagen“, knurrte der Begleiter. „Vor allem die Apachen sind Meister der Tarnung. Auch wenn Sie die Burschen nicht sehen, Captain, Sie können sich sicher sein, dass sie da sind und Sie beobachten.“
Die ältere Dame schwitzte entsetzlich in ihrem hochgeschlossenen Kleid. Jetzt nahm sie einen Sonnenschirm und stieß dessen Knauf mehrfach heftig gegen das Kutschendach. „Hören Sie, Fahrer, wollen Sie hier noch lange herum stehen? Mein Mann erwartet mich in Lordsburg. Er ist dort der Town-Mayor, wenn Sie verstehen …“
„Yeah, Misses Blinkert, ich weiß, Sie werden sehnsüchtig erwartet. Hören Sie, Ladies und Gentlemen“, wandte sich Brady an die Passagiere im Inneren, „der Captain reitet mit seiner Abteilung nach Fort Seldon. Ich schlage vor, dass wir die Gelegenheit nutzen und …“
„Kommt nicht in Frage“, kam die Erwiderung eines schlanken Mannes im Gehrock. „Ich kenne die Gepflogenheiten der Armee und das ständige Führen der Pferde. Uns vom Captain eskortieren zu lassen, dass würde uns glatt einen halben Tag kosten.“
„Mister Burnett hat recht, Brady“, meinte der Begleiter. „Außerdem denke ich nicht, dass irgendwas passiert … Wenn uns jemand auflauert, dann sieht er ja, dass uns eine Armeeabteilung dicht auf den Fersen ist.“
Mark grüßte nochmals leger, als die Kutsche wieder anrollte.
„Hm … Rote, Bandoleros und weißes Raubgesindel“, sinnierte Ted Furbanks. „Mir schienen Kutscher und Begleitfahrer nicht besonders beunruhigt zu sein.“
Mark nickte. „In Fort Seldon werden wir sicherlich mehr über die Lage hier unten erfahren und darüber, was uns in Fort Coronado erwartet.“