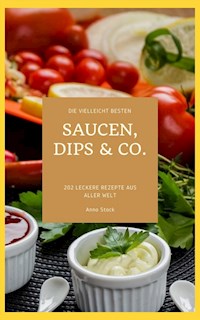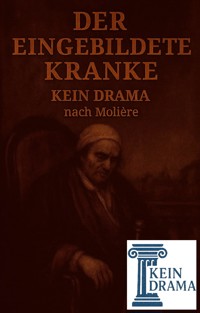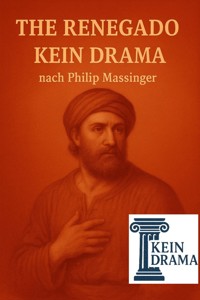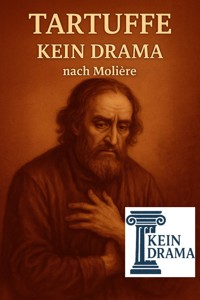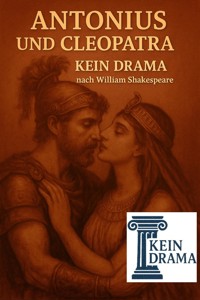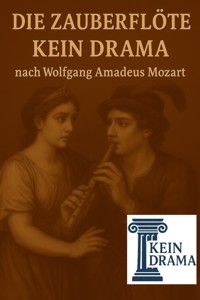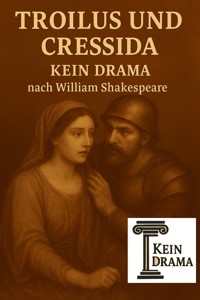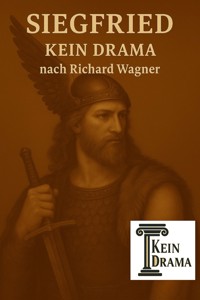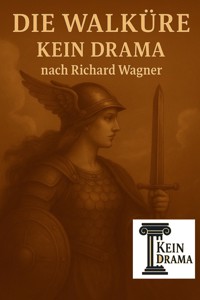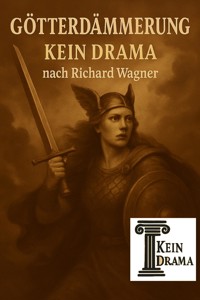
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Eine unsterbliche Liebe. Ein verfluchter Ring. Das Ende einer Welt.Siegfried, der furchtlose Held, der den Drachen bezwang, hat auf einem einsamen Felsen seine große Liebe gefunden: Brünnhilde, die verstoßene Walküre. Gemeinsam schwören sie sich ewige Treue. Doch als Siegfried in die Welt hinauszieht, wird er Opfer dunkler Machenschaften.Am Hof der Gibichungen wartet Hagen, Sohn des Nibelungen Alberich, auf seine Chance. Mit einem teuflischen Plan und einem Vergessenstrank raubt er Siegfried die Erinnerung an seine Geliebte. Der verzauberte Held wird zum Werkzeug eines Komplotts, das nicht nur sein Leben, sondern die gesamte Ordnung der Götter bedroht.Brünnhilde, von ihrem eigenen Geliebten verraten und zu einem Mann gezwungen, den sie nicht will, sinnt auf Rache. Doch als die Wahrheit ans Licht kommt, ist es bereits zu spät. Der Ring – Alberichs verfluchtes Meisterwerk – fordert seinen Preis in Blut und Feuer.Diese epische Romanadaption von Richard Wagners "Götterdämmerung" erzählt die Geschichte von Liebe und Verrat, Macht und Verzweiflung neu. Sie führt den Leser von den lichten Höhen eines Felsens durch die dunklen Abgründe menschlicher (und göttlicher) Schwäche bis zum gewaltigen Finale, in dem eine Welt in Flammen aufgeht – und aus ihrer Asche vielleicht eine bessere entsteht.Ein monumentales Finale des Nibelungen-Rings – als mitreißender Roman für eine neue Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Götterdämmerung - Kein Drama nach Richard Wagner
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Kapitel 1: Das Spinnen der Nornen
Kapitel 2: Siegfried und Brünnhilde – Der Abschied
Kapitel 3: Die Halle am Rhein
Kapitel 4: Hagens Plan
Kapitel 5: Siegfrieds Ankunft
Kapitel 6: Der Vergessenstrank
Kapitel 7: Der Schwur
Kapitel 8: Brünnhilde allein
Kapitel 9: Waltrautes Besuch
Kapitel 10: Die Täuschung
Kapitel 11: Nacht mit Alberich
Kapitel 12: Die Rückkehr
Kapitel 13: Die Doppelhochzeit
Kapitel 14: Das Komplott
Kapitel 15: Vorahnungen
Kapitel 16: Die Jagd beginnt
Kapitel 17: Siegfrieds Tod
Kapitel 18: Der Leichnam kehrt zurück
Kapitel 19: Streit um den Ring
Kapitel 21: Der Scheiterhaufen und die Götterdämmerung
Epilog: Die Stille danach
Nachwort
Impressum neobooks
Table of Contents
Götterdämmerung – Kein Drama nach Richard Wagner
Ein historischer Roman
Anno Stock
Kapitel 1: Das Spinnen der Nornen
Die Nacht lag schwer über dem Felsen. Wolken hingen tief, verschlangen die Sterne und ließen nur vereinzelt das matte Leuchten des Mondes durch ihre zerrissenen Schwaden dringen. Der Wind heulte um die schroffen Klippen, auf denen einst Brünnhildes Flammenring gebrannt hatte. Doch die Flammen waren längst erloschen, seit Siegfried sie durchschritten und die schlafende Walküre erweckt hatte. Nur verkohlte Steine und schwarze Brandspuren zeugten noch von jenem magischen Feuer, das die Tochter Wotans so lange beschirmt hatte.
Am Fuß der mächtigen Tanne, die einsam auf dem höchsten Punkt des Felsens ragte, saßen drei Gestalten. Sie wirkten wie aus der Zeit gefallen, wie Schatten einer vergangenen Epoche, die sich noch einmal materialisiert hatten, ehe sie für immer im Nebel der Geschichte verschwanden. Es waren die Nornen, die Schicksalsspinnerinnen, Töchter der Urweisheit, Hüterinnen des Weltgedächtnisses.
Die erste, die älteste, saß mit dem Rücken gegen den gewaltigen Stamm gelehnt. Ihr Gesicht war von unzähligen Falten durchzogen wie eine uralte Landkarte, auf der jede Linie eine Geschichte erzählte, jede Furche ein Zeitalter bezeugte. Ihre Augen, tief in den Höhlen liegend, glommen wie ferne Kohlen, in denen das Wissen um Anfang und Werden bewahrt lag. Ihr Haar, einst vielleicht golden wie das der Götter, war nun grau wie Asche, grau wie die Zeit selbst.
Die zweite Norn, die mittlere, saß zur Linken der ersten. Sie verkörperte die Fülle des Seins, die Gegenwart in ihrer ganzen Komplexität. Ihr Gesicht trug noch Züge einer herben Schönheit, doch auch hier hatte die Zeit bereits ihre Spuren hinterlassen. Ihre Augen waren wachsam, ruhelos, als verfolgten sie tausend Fäden gleichzeitig, die sich in diesem Moment durch die Welt spannten. Ihr Haar fiel in dichten, dunklen Wellen über ihre Schultern.
Die dritte, die jüngste, kauerte rechts von der ersten. Sie hätte beinahe jung wirken können, wäre da nicht der Ausdruck tiefer Melancholie in ihren Zügen gewesen. Ihre Augen blickten in eine Ferne, die noch nicht existierte, und in diesem Blick lag eine schmerzliche Vorahnung. Ihr Haar schimmerte silbern im schwachen Mondlicht, als wäre es bereits vom Frost einer kommenden, ungewissen Zeit berührt.
In ihren Händen hielten sie ein Seil. Es war kein gewöhnliches Seil aus Hanf oder Flachs, sondern das Weltenseil selbst, gewoben aus dem Schicksal aller Dinge, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es glänzte matt im Dunkel, und manchmal schienen Funken durch seine Fasern zu laufen, als pulsierten Geschichten und Leben durch seine Struktur.
Die älteste Norn begann zu sprechen. Ihre Stimme klang wie das Knarren uralter Äste, wie das Rauschen längst versiegter Quellen.
„Wisst ihr noch, Schwestern, wie alles begann?" Sie warf das eine Ende des Seils zur mittleren Norn, die es geschickt auffing. „An der Weltesche stand ich einst, als sie noch grünte und blühte, als ihre Krone noch den Himmel berührte und ihre Wurzeln tief in den Urquell der Weisheit reichten. Unter ihrem Schatten saßen wir drei, und das Weltenseil war stark und fest. Jeder Faden war klar, jedes Schicksal lesbar."
Die zweite Norn nickte langsam und begann, ihrerseits den Faden zu spannen. „Ich erinnere mich", sagte sie mit einer Stimme, die tiefer klang als die der ersten, erdiger, voller der Schwere des Gegenwärtigen. „Dann kam er, der Wanderer, der sich selbst einen anderen Namen gab: Wotan, der Götter Herr. Er kam zum heiligen Baum, getrieben von seinem unstillbaren Durst nach Wissen, nach Macht, nach Herrschaft über das Schicksal selbst."
Sie warf das Seil zur jüngsten Norn, die es mit zitternden Händen empfing. Die jüngste sprach, und ihre Stimme war ein Flüstern wie das Rascheln welker Blätter im Herbstwind.
„Er trank aus der Quelle der Weisheit und zahlte den Preis. Ein Auge gab er hin für das Wissen. Doch das genügte ihm nicht. Er brach einen Ast vom heiligen Baum, vom Stamm der Weltesche selbst. Aus diesem Ast schnitzte er seinen Speer, und in den Schaft ritzte er Runen, Runen der Verträge und Gesetze, mit denen er die Welt regieren wollte."
Die jüngste Norn warf das Seil zurück zur ältesten, und der Kreis schloss sich. Das Seil tanzte durch die Nacht, spannte sich, erschlaffte, spannte sich erneut.
„Von dem Tag an", fuhr die älteste Norn fort, und ihre Stimme wurde düsterer, „begann die Weltesche zu welken. Die Wunde, die Wotan ihr geschlagen hatte, heilte nie. Der Baum verdorrte, seine Blätter fielen, seine Zweige wurden brüchig. Die Quelle der Weisheit versiegte. Und wir, wir konnten nicht mehr unter seinem Schatten sitzen und das Schicksal weben wie einst."
Der Wind wurde stärker, zerrte an den Gewändern der drei Schicksalsfrauen. Die mittlere Norn fing das Seil auf und wickelte es um ihre Hand.
„Wotan herrschte mit seinem Speer", sagte sie. „Er baute Walhall, die glänzende Götterburg, errichtet von den Riesen Fasolt und Fafner. Doch die Bezahlung – erinnert ihr euch? – die Bezahlung war der Fluch, der noch immer über allem liegt."
„Alberichs Gold", flüsterte die jüngste Norn. „Der Nibelungenhort. Das Gold, das aus des Rheines Tiefe geraubt wurde. Das Gold, für das der Zwerg der Liebe entsagte. Das Gold, aus dem er den Ring schmiedete, den Ring der Macht."
„Und Wotan nahm es ihm", fuhr die mittlere fort. „Nahm Gold und Ring, um die Riesen zu bezahlen. Doch Alberich, in seiner grenzenlosen Wut, verfluchte den Ring. Wer ihn besitzt, den soll er quälen. Wer ihn nicht hat, den soll er nagen. Mord und Tod soll er bringen, bis er zum Rhein zurückkehrt."
Die älteste Norn schüttelte den Kopf, und ihre Stimme klang nun noch hohler, noch verzweifelter.
„Alles, was seitdem geschah, geschah unter dem Schatten dieses Fluches. Fasolt erschlug Fafner um des Ringes willen. Fafner wurde zum Drachen und hütete den Hort in der Neidhöhle. Die Welt verdunkelte sich. Und Wotan – Wotan begriff, dass er, der mit dem Speer die Verträge hütete, nicht selbst den Fluch brechen konnte. Die Runen auf dem Speer banden ihn an seine eigenen Gesetze."
Das Seil spannte sich straffer zwischen ihren Händen. Es vibrierte leise, als liefe ein Schauder durch seine Fasern.
„Darum zeugte er die Wälsungen", sagte die zweite Norn. „Menschen, frei von den Gesetzen der Götter, frei, um zu tun, was er selbst nicht tun durfte. Siegmund und Sieglinde. Aus ihrem verbotenen Bund sollte der Held erwachsen, der den Drachen erschlagen und den Ring gewinnen würde."
„Doch auch das ging schief", warf die jüngste ein, und in ihrer Stimme lag bittere Erkenntnis. „Fricka, die Hüterin der Ehe, zwang Wotan, Siegmund fallen zu lassen. Brünnhilde, seine liebste Tochter, die Walküre, gehorchte ihrem Herzen statt seinem Befehl. Sie wollte Siegmund retten. Und dafür bestrafte Wotan sie: Nahm ihr die Göttlichkeit, versenkte sie in Schlaf, umgab sie mit Feuer."
Die älteste Norn zog am Seil, und es gab einen dumpfen Ton von sich, wie eine Saite, die zu reißen droht.
„Siegmund fiel", sagte sie. „Doch Sieglinde entkam und gebar Siegfried. Siegfried, der von nichts wusste, der ohne die Götter aufwuchs, der frei war von allen Verträgen. Siegfried, der Nothung neu schmiedete, das Schwert, das einst im Stamm der Weltesche gesteckt hatte. Siegfried, der Fafner erschlug und den Ring gewann."
„Siegfried, der durch das Feuer schritt", fuhr die mittlere fort, „und Brünnhilde erweckte. Siegfried, der den Ring nun trägt, ohne die Last seiner Geschichte zu kennen."
Die jüngste Norn starrte in die Dunkelheit, und ihre Augen weiteten sich, als sähe sie etwas Schreckliches.
„Und Wotan? Was ist mit dem Götter Herrn?"
Die älteste Norn seufzte tief. „Er wandert nicht mehr. Er sitzt in Walhall, stumm und starr. Um ihn herum hat er die Trümmer der Weltesche aufschichten lassen, die gefällten Äste und Stämme des heiligen Baumes. Die Helden, die in Walhall versammelt sind, haben sie dort aufgehäuft wie Scheitholz für einen gewaltigen Brand. Wotan wartet. Er wartet auf das Ende."
„Sein Speer ist zerbrochen", fügte die mittlere hinzu. „Siegfried zerschlug ihn, als Wotan ihm den Weg zu Brünnhilde versperren wollte. Der Speer der Verträge, die Runen der Ordnung – alles zerbrochen. Wotans Macht ist dahin."
Das Seil zwischen ihnen begann zu flackern. Die Fasern schienen sich zu lockern, einzelne Fäden lösten sich.
„Ich kann nicht mehr klar sehen", rief die jüngste Norn plötzlich mit bebender Stimme. „Das Seil – es wird wirr, die Fäden verheddern sich. Was wird geschehen? Was kommt?"
Die mittlere Norn zerrte am Seil, versuchte es zu straffen, doch es gehorchte nicht mehr wie früher. „Auch mir verschwimmt die Sicht", gestand sie. „Die Gegenwart selbst wird unklar. Zu viele Fäden kreuzen sich, zu viele Schicksale sind noch unentschieden."
Die älteste Norn erhob sich mühsam, ihre alten Knochen knarrten. Sie hielt das Seil mit beiden Händen und versuchte, es um den Stamm der Tanne zu schlingen, wie sie es seit Urzeiten getan hatte. Doch der Stamm fühlte sich anders an, rau, fremd, als würde er sie nicht mehr erkennen.
„Die Tanne selbst ist nicht mehr dieselbe", murmelte sie. „Seit die Weltesche gefallen ist, seit Walhall dem Untergang geweiht ist, hat auch dieser Baum seine Kraft verloren. Er kann das Weltenseil nicht mehr halten."
Sie versuchte es dennoch, wickelte den Faden um den Stamm, doch als sie zog, rutschte er ab, verfing sich in der rauen Borke. Die zweite Norn sprang auf, eilte herbei, versuchte zu helfen. Auch die jüngste erhob sich, ihre Hände zitterten, als sie nach dem Seil griff.
„Was ist das?" Die jüngste starrte auf das Seil in ihrer Hand. „Es ist rau geworden, kratzig. Es schneidet mir in die Handflächen."
„Es ist alt", sagte die mittlere Norn. „So alt wie die Welt, und die Welt ist müde geworden."
Sie versuchten weiter zu weben, ließen das Seil zwischen sich hin und her wandern, doch jede Bewegung fiel schwerer als die vorherige. Die Fäden wollten sich nicht mehr fügen. Immer wieder verhedderten sie sich, bildeten Knoten, die sich nicht mehr lösen ließen.
„Ich sehe Feuer", flüsterte die jüngste plötzlich. „Loderndes Feuer, das alles verschlingt. Ich sehe Walhall brennen, die Götter in den Flammen. Ich sehe..."
„Still!" Die älteste versuchte, sie zu unterbrechen, doch es war zu spät.
„Ich sehe den Ring", fuhr die jüngste fort, ihre Augen waren nun weit aufgerissen, starrten ins Leere, sahen Dinge, die noch nicht geschehen waren. „Der Ring wechselt die Hand. Blut fließt. Verrat und Tod. Der Rhein wird ihn zurückfordern. Das Feuer wird..."
Mit einem Mal gab es einen scharfen Laut, wie das Knacken eines brechenden Astes, nur vielfach lauter, durchdringender. Das Weltenseil riss.
Die drei Nornen schrien auf. Die Gewalt des Reißens schleuderte sie auseinander. Das Seil fiel zu Boden, seine Enden zuckten wie die Glieder eines sterbenden Tieres.
Die älteste Norn rappelte sich als erste auf. Sie starrte auf die zerrissenen Faserenden, hob sie mit zitternden Fingern auf. „Es ist vorbei", sagte sie tonlos. „Das Weltenseil ist zerrissen. Unsere Weisheit ist zu Ende."
Die mittlere Norn kniete nieder, versuchte verzweifelt, die Enden zusammenzuknoten, doch die Fasern glitten auseinander, weigerten sich, sich wieder zu vereinen. „Es will sich nicht fügen", schluchzte sie. „Ich kann es nicht heilen. Die Gegenwart selbst ist zerbrochen."
Die jüngste Norn stand da, die Arme hilflos herabhängend. Tränen liefen über ihr Gesicht. „Die Zukunft ist dunkel", flüsterte sie. „Ich sehe nichts mehr. Nur Schatten, nur Rauch, nur das Echo eines gewaltigen Falls."
Die älteste Norn ließ die Seilenden fallen. Sie richtete sich auf, so gerade, wie ihr alter Körper es erlaubte, und blickte zu ihren Schwestern.
„Hinab", sagte sie mit einer Stimme, die plötzlich seltsam fest klang, fest in der Akzeptanz des Unvermeidlichen. „Hinab zu Erda, unserer Mutter, der Urmutter allen Wissens. Wenn das Weltenseil zerrissen ist, wenn die Schicksalsfäden nicht mehr zu lesen sind, dann ist auch unsere Zeit vorbei. Lasst uns hinabsteigen in die Tiefe, zurück zur Erde, aus der alles kam."
„Zu Erda", wiederholte die mittlere Norn leise. „Ja. Sie schläft in den Tiefen der Welt. Vielleicht weiß sie mehr. Vielleicht kann sie uns sagen, was all dies bedeutet."
„Oder sie schläft weiter", sagte die jüngste, „und träumt das Ende der Welt, ohne es zu wissen."
Die drei Nornen sammelten die Reste des zerrissenen Seils ein. Sie hielten die Stücke wie Reliquien einer vergangenen Zeit, Zeugnisse einer Ordnung, die nicht mehr existierte. Dann wandten sie sich dem Abgrund zu, der sich am Rande des Felsens öffnete, jenem bodenlosen Schacht, der hinab in die Urgründe der Erde führte.
„Die Götter gehen ihrem Ende entgegen", sagte die älteste Norn noch einmal, bevor sie den ersten Schritt in die Dunkelheit tat. „Walhall wird brennen. Wotan hat es selbst so gewollt, seit er erkannte, dass seine Herrschaft mit Schuld erkauft war. Er wartet nur noch auf das Ende."
„Und die Menschen?" fragte die mittlere Norn. „Was wird aus ihnen, wenn die Götter vergehen?"
Die älteste Norn blieb stehen, drehte sich noch einmal um. Der Wind zerrte an ihrem grauen Haar. Im Osten begann der Himmel sich leicht aufzuhellen, das erste fahle Morgengrauen kündigte sich an.
„Die Menschen", sagte sie langsam, „werden allein sein. Ohne die Götter, ohne Schicksal, ohne Weisheit der Nornen. Sie werden selbst entscheiden müssen, was sie aus der Welt machen. Vielleicht ist das die einzige Hoffnung, die bleibt: dass sie es besser machen als wir, als die Götter, als all jene, die unter der Last uralter Verträge und Flüche zusammenbrachen."
Dann verschwand sie in der Tiefe. Die zweite Norn folgte ihr, und schließlich auch die jüngste. Ihre Schritte hallten kurz auf dem Stein, dann war nur noch Stille.
Der Wind heulte um die einsame Tanne. Die Fetzen des zerrissenen Weltenseils lagen verstreut auf dem Felsen, und das erste Morgenlicht ließ sie aufleuchten wie die letzten Funken eines ersterbenden Feuers.
Die alte Ordnung war zu Ende. Die Götter waren sterblich geworden. Und ein neuer Tag brach an, ein Tag, an dessen Ende die Welt nicht mehr dieselbe sein würde.
Kapitel 2: Siegfried und Brünnhilde – Der Abschied
Das Morgenrot färbte den östlichen Himmel in zartem Rosa und Gold. Die Nacht wich langsam, zögernd, als wolle sie sich nicht von diesem Ort trennen, der so viel Wunderbares und Schreckliches gesehen hatte. Die Wolken, die noch vor Stunden schwer und drohend gehangen hatten, lösten sich auf, zerflossen zu durchsichtigen Schleiern, durch die das erste Sonnenlicht hindurchbrach.
Auf dem Felsen, wo eben noch die Nornen ihr düsteres Werk verrichtet hatten, stand nun eine Höhle. Ihr Eingang war von mächtigen Steinblöcken gerahmt, die aussahen, als hätte die Natur selbst sie zu einem Portal geformt. Ranken und wildes Gestrüpp umwucherten die Felsen, doch in der Mitte blieb der Durchgang frei, weit genug für einen Menschen – oder einen Gott –, um hindurchzuschreiten.
Aus der Tiefe der Höhle drang sanftes Licht, nicht das kalte Leuchten des Mondes oder das flackernde Zucken von Feuer, sondern ein warmes, goldenes Glühen, als brenne dort drinnen eine Quelle des Lebens selbst. Und mit diesem Licht kam ein Klang: Lachen, helles, freudiges Lachen, das wie das Läuten silberner Glocken durch die Morgenluft hallte.
Brünnhilde trat aus der Höhle ins Freie.
Sie war verwandelt. Jene stolze Walküre, die einst in goldener Rüstung über die Schlachtfelder geritten war, die mit Schild und Speer die Gefallenen erwählt hatte, existierte nicht mehr. An ihre Stelle war eine Frau getreten, eine Frau in der vollen Blüte ihres Lebens, erfüllt von einer Liebe, die alles andere in den Schatten stellte.
Ihr langes, goldenes Haar fiel in weichen Wellen über ihre Schultern und den Rücken hinab, nicht mehr von einem Helm gebändigt, sondern frei und wild wie das Haar sterblicher Frauen. Sie trug ein einfaches Gewand aus weißem Leinen, das ihre Gestalt umschmeichelte und im Morgenwind leicht flatterte. Keine Rüstung mehr, kein Metall, nichts von der kriegerischen Pracht vergangener Zeiten. Nur diese schlichte, reine Schönheit, die umso strahlender wirkte.
Ihre Augen leuchteten in einem tiefen Blau, dem Blau des Sommerhimmels, dem Blau endloser Hoffnung. Und in diesen Augen lag ein Glück, das so vollkommen war, dass es beinahe schmerzte, es anzusehen. Es war das Glück einer Frau, die alles aufgegeben hatte – ihre Unsterblichkeit, ihre göttliche Macht, ihre Stellung unter den Himmlischen –, und die dafür etwas gewonnen hatte, das alle diese Dinge überstieg: die Liebe eines Menschen.
Hinter ihr erschien Siegfried.
Er war ein Bild von makelloser männlicher Schönheit und Kraft. Groß und breitschultrig stand er da, sein Körper war durchtrainiert von Jahren des Wanderns, Kämpfens und Jagens. Sein Haar, hell wie reifer Weizen, fiel ihm in unordentlichen Locken in die Stirn. Seine Augen, grau wie Stahl und doch warm wie ein Sommerregen, blickten auf Brünnhilde mit einer Intensität, die zeigte, dass auch er von dieser Liebe erfüllt war, die keine Götter kannte, keine Gesetze, nur das Hier und Jetzt.
Er trug sein Schwert Nothung am Gürtel, die gewaltige Klinge, die er selbst geschmiedet hatte aus den Bruchstücken, die sein Vater Siegmund hinterlassen hatte. Der Tarnhelm hing an seiner Seite, jenes wundersame Ding, das Alberich einst geschaffen hatte und das seinem Träger erlaubte, jede Gestalt anzunehmen oder unsichtbar zu werden. Doch von all diesen Waffen und Werkzeugen ging in diesem Moment keine Bedrohung aus. Siegfried war nicht der Drachentöter, nicht der Held – er war einfach ein Mann, der seine Geliebte ansah und lächelte.
„Brünnhilde", sagte er, und ihre Namen klang in seinem Mund wie ein Gedicht. „Der Morgen ist schön, aber nicht so schön wie du."
Sie lachte, jenes helle, fröhliche Lachen, das die Luft selbst zum Vibrieren brachte. „Du Schmeichler", neckte sie ihn. „Hast du das von den Vögeln gelernt, die dir einst ihre Lieder sangen?"
„Von den Vögeln lernte ich Warnung und Weisheit", erwiderte er und trat zu ihr. „Aber die Sprache der Liebe lernte ich von dir, nur von dir."
Er legte seine Arme um sie, zog sie an sich, und sie schmiegte sich in seine Umarmung wie in den sichersten Hafen der Welt. Einen langen Moment standen sie so, während die Sonne höher stieg und ihr Licht den Felsen in flüssiges Gold tauchte.
Doch dann löste sich Brünnhilde sanft aus seiner Umarmung. Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, kaum wahrnehmbar, aber Siegfried, dessen Sinne geschärft waren vom Leben in der Wildnis, bemerkte es sofort.
„Was ist?" fragte er besorgt. „Warum trübst du dich?"
Brünnhilde schüttelte den Kopf, als wolle sie einen unangenehmen Gedanken vertreiben. „Es ist nichts", sagte sie rasch. „Nur... die Nacht war seltsam. Ich träumte wirre Träume. Ich hörte Stimmen, die von fernen Schicksalen sprachen, von Enden und Anfängen. Aber Träume sind Schäume, nicht wahr? Der Tag ist da, und du bist hier. Was sollte ich fürchten?"
Siegfried sah sie prüfend an. „Träume", murmelte er. „Ich verstehe nicht viel von Träumen. Mime, der mich aufzog, sprach manchmal von Dingen, die noch nicht waren, aber kommen würden. Doch ich lebte immer nur im Jetzt. Was nützt es, über Morgen zu grübeln, wenn heute so viel Schönheit bietet?"
„Du hast recht", sagte Brünnhilde und zwang sich zu einem Lächeln. „Du hast immer recht, mein Held ohne Furcht."
„Ohne Furcht", wiederholte Siegfried nachdenklich. „Weißt du, Brünnhilde, manchmal frage ich mich, ob das wirklich eine Tugend ist. Mime wollte mir das Fürchten beibringen, und ich verstand nie, was er meinte. Selbst als ich den Drachen Fafner erschlug, als sein feuriger Atem mich anwehte und seine Klauen nach mir schlugen – ich fühlte keine Furcht. Nur... Tatendrang. Den Wunsch zu kämpfen, zu siegen."
„Und dann kamst du zu mir", sagte Brünnhilde leise. „Und durchschrittest das Feuer, das keinen anderen durchgelassen hätte."
„Das Feuer", sagte Siegfried und lachte. „Das Feuer war wie ein Gruß, wie ein Willkommen. Es hätte mich nicht aufhalten können, selbst wenn es gewollt hätte. Denn dahinter lag ja du."
Er nahm ihre Hand, führte sie an seine Lippen und küsste sie sanft. „Als ich dich zum ersten Mal sah, da liegend in deiner Rüstung, im tiefen Schlaf – da lernte ich, was das Fürchten ist. Nicht Furcht vor Gefahr oder Tod. Nein. Furcht, dass du nicht erwachen würdest. Furcht, dass ich dich verlieren könnte, noch ehe ich dich gewonnen hatte."
Tränen stiegen Brünnhilde in die Augen. „Siegfried", flüsterte sie. „Mein Siegfried. Du weißt nicht, wie sehr ich dich liebe. Du weißt nicht, was ich für dich aufgegeben habe."
„Deine Göttlichkeit", sagte er ernst. „Das weiß ich. Wotan, dein Vater, nahm sie dir, weil du seinem Befehl nicht gehorchtest. Weil du Siegmund, meinen Vater, retten wolltest."
„Ich bereue es nicht", sagte Brünnhilde fest. „Keinen Augenblick. Was ist Unsterblichkeit wert, wenn man nicht lieben darf? Was bedeuten die Hallen Walhalls, wenn das Herz leer bleibt? Nein, Siegfried. Ich habe nichts aufgegeben. Ich habe alles gewonnen."
Sie standen Hand in Hand, während die Sonne weiter stieg. Die Wärme des neuen Tages breitete sich aus, vertrieb die letzte Kühle der Nacht. Vögel begannen zu singen, ihr Gezwitscher erfüllte die Luft mit fröhlicher Lebendigkeit.
Doch dann wandte sich Siegfried um und blickte in die Ferne, über die Berge hinweg, die sich unter ihnen ausbreiteten wie ein gefaltetes Tuch aus grünem Samt und grauem Stein. Seine Miene veränderte sich. Der zärtliche Ausdruck wich einem anderen – nicht hart, nicht kalt, aber rastlos, getrieben von einem inneren Feuer.
„Brünnhilde", sagte er nach einer Weile. „Ich muss fort."
Die Worte trafen sie wie ein Schlag. „Fort?" wiederholte sie, und ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. „Wohin? Warum?"
Siegfried fuhr sich durch das Haar, eine Geste der Verlegenheit. „Ich... ich weiß es nicht genau. Aber ich spüre es. Hier auf diesem Felsen, so schön er ist, so sehr ich dich liebe – ich kann nicht ewig bleiben. Ich bin ein Mann der Tat, Brünnhilde. Ich muss in die Welt hinaus. Neue Abenteuer suchen, neue Kämpfe, neue Siege."
„Neue Siege", wiederholte Brünnhilde, und ein bitterer Unterton schlich sich in ihre Stimme. „Reicht es nicht, dass du den Drachen erschlagen hast? Dass du durch mein Feuer geschritten bist? Was willst du noch beweisen?"
„Nichts beweisen", sagte Siegfried rasch. „Es ist nicht Eitelkeit, die mich treibt. Es ist... ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist, als würde etwas in mir rufen, als würde eine Stimme sagen: Geh! Sieh die Welt! Tu Taten! Ich bin jung, Brünnhilde. Ich habe so viel Kraft in mir. Diese Kraft muss raus, muss sich beweisen."
Brünnhilde wandte sich ab. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten. Sie wusste, dass er recht hatte. Sie wusste, dass es in Siegfrieds Natur lag, zu wandern, zu kämpfen, zu erobern. Er war nicht geschaffen für ein stilles Leben auf einem einsamen Felsen. Und doch – der Gedanke, ihn gehen zu lassen, zerriss ihr fast das Herz.
„Wie lange?" fragte sie schließlich mit gepresster Stimme. „Wie lange willst du fort sein?"
„Nicht lange", versicherte Siegfried und trat zu ihr. „Nur ein wenig. Ich werde hinabsteigen zu den Menschen, sehen, wie sie leben, vielleicht jemandem helfen, der in Not ist. Und dann kehre ich zurück. Zu dir. Immer zu dir."
„Versprichst du das?"
„Ich verspreche es."
Sie drehte sich zu ihm um, und er sah die Tränen in ihren Augen. „Siegfried", sagte sie, und ihre Stimme brach. „Die Welt dort unten ist gefährlich. Nicht, weil dort Drachen oder wilde Tiere auf dich warten. Nein. Die Gefahr liegt in den Herzen der Menschen. In ihrer Gier, ihrem Neid, ihrer Verschlagenheit. Du kennst nur Ehrlichkeit, nur Offenheit. Du hast nie gelernt zu lügen, nie gelernt, andere zu durchschauen. Das macht dich stark, aber auch verwundbar."
„Verwundbar?" Siegfried lachte. „Brünnhilde, ich habe im Drachenblut gebadet. Meine Haut ist hart wie Horn. Keine Waffe kann mich verletzen."
„Doch", sagte Brünnhilde leise. „Eine Stelle. Dein Rücken, zwischen den Schulterblättern. Dort, wo das Lindenblatt lag, als du im Blut des Drachen lagst. Diese Stelle ist verwundbar."
Siegfried zuckte mit den Schultern. „Dann muss ich eben aufpassen, niemandem den Rücken zuzukehren."
„Das ist es nicht", insistierte Brünnhilde. „Siegfried, hör mir zu. Es gibt schlimmere Waffen als Schwerter und Speere. Es gibt Verrat. Es gibt Täuschung. Es gibt Menschen, die lächeln, während sie das Messer wetzen."
Siegfried nahm sie bei den Schultern, zwang sie sanft, ihm in die Augen zu sehen. „Brünnhilde, meine geliebte, weise Brünnhilde. Ich verstehe deine Sorge. Aber ich bin nicht so dumm, wie du vielleicht denkst. Ich habe Mime durchschaut, oder? Ich wusste, dass er mich töten wollte, als er mir den vergifteten Trank brachte. Ich habe den Vogel verstanden, der mich warnte. Ich bin vorsichtig. Ich verspreche es."
Brünnhilde seufzte. Sie wusste, dass sie ihn nicht aufhalten konnte. Und vielleicht durfte sie es auch nicht. Ihre Liebe zu ihm bedeutete auch, ihn frei zu lassen, ihm zu erlauben, der zu sein, der er war.
„Dann", sagte sie schließlich, „dann nimm wenigstens dies."
Sie zog einen Ring vom Finger. Es war nicht irgendein Ring. Es war der Ring, den Siegfried ihr gegeben hatte, als er zum ersten Mal zu ihr kam. Der Ring, den er vom Drachenhort genommen hatte. Der Ring, den einst Alberich geschmiedet hatte. Der Ring der Macht.
Das Gold schimmerte im Morgenlicht, ein tiefes, sattes Rot-Gold, das beinahe zu leuchten schien. Runen waren in das Metall eingraviert, Zeichen uralter Macht, die weder Siegfried noch Brünnhilde zu lesen vermochten.
„Nein", sagte Siegfried sofort. „Der Ring ist dein. Ich gab ihn dir als Zeichen meiner Liebe."
„Und deshalb sollst du ihn jetzt tragen", beharrte Brünnhilde. „Als Zeichen meiner Liebe zu dir. Als Erinnerung an mich, wo immer du auch sein magst. Und als Schutz."
„Schutz?" Siegfried lachte. „Brünnhilde, es ist ein Ring. Wie soll er mich schützen?"
„Er ist mehr als ein Ring", sagte Brünnhilde ernst. „Er birgt Macht, große Macht. Ich spüre es, auch wenn ich nicht genau sagen kann, welcher Art diese Macht ist. Solange du ihn trägst, bin ich bei dir. Meine Gedanken, meine Liebe, mein Schutz."
Siegfried zögerte, dann streckte er die Hand aus. Brünnhilde schob ihm den Ring auf den Finger. Er passte perfekt, als wäre er für ihn gemacht.
„Ich werde ihn ehren", sagte Siegfried feierlich. „Wie ich dich ehre. Und ich werde ihn hüten, wie ich unser Glück hüte."
Brünnhilde nickte, doch tief in ihrem Herzen regte sich Unbehagen. Der Ring... es war nicht nur Liebe, die ihn umgab. Es war auch etwas anderes. Etwas Dunkles, Drohendes. Aber sie schob den Gedanken beiseite. Siegfried war stark. Siegfried würde mit allem fertig werden.
„Und du", sagte Siegfried nun. „Was gibst du mir noch mit auf den Weg?"
Brünnhilde dachte nach. Dann hellte sich ihr Gesicht auf. „Mein Wissen", sagte sie. „Alles, was ich als Walküre wusste, all die Weisheit, die Wotan mir einst schenkte. Ich will sie dir geben."
Sie trat näher, legte ihre Hände an seine Schläfen. Siegfried spürte eine Wärme durch seinen Kopf strömen, ein Kribbeln, als würden tausend winzige Funken in seinem Gehirn zünden. Bilder fluteten durch seinen Geist: Schlachten, die vor Jahrhunderten geschlagen wurden. Helden, deren Namen längst vergessen waren. Götter in ihren strahlenden Hallen. Die Weltenesche in voller Blüte. Der Rhein in seiner Urzeit, klar und rein.
Und dann... Warnungen. Dunkle Vorahnungen. Gesichter von Menschen, die lächelten, aber Böses im Sinn führten. Der Klang von Verrat, schrill wie ein Missklang in einer Symphonie.
Brünnhilde nahm die Hände von seinem Kopf. Siegfried taumelte einen Moment, fing sich dann. „Das war... intensiv", murmelte er.
„Es ist alles, was ich habe", sagte Brünnhilde. „Alles, was ich dir geben kann. Nutze es weise."
„Das werde ich", versprach Siegfried.
Dann ging er zu einer Ecke des Felsens, wo sein Pferd stand. Es war kein Pferd wie andere Pferde. Grane, so hieß das Tier, war ein Schlachtross der Walküren gewesen, edel, mächtig, mit Augen, die Intelligenz und Stolz ausstrahlten. Sein Fell glänzte wie poliertes Ebenholz, seine Mähne wehte im Wind wie eine dunkle Fahne.
„Grane", sagte Brünnhilde und trat zu dem Pferd. Sie legte ihre Stirn gegen die des Tieres. „Du warst mein treuer Gefährte in so vielen Schlachten. Nun trage du Siegfried. Beschütze ihn, wie du mich beschützt hast. Bring ihn sicher wieder zu mir zurück."
Grane wieherte leise, als verstünde er jedes Wort.
Siegfried schwang sich in den Sattel. Von dort oben blickte er auf Brünnhilde hinab, und einen Moment lang schien Unsicherheit über sein Gesicht zu huschen. Dann wich sie einem strahlenden Lächeln.
„Ich werde an dich denken", sagte er. „Jede Stunde, jeden Moment. Und ich werde wiederkommen. So wahr ich Siegfried heiße, der Sohn Siegmunds."
„Geh", sagte Brünnhilde, obwohl es ihr das Herz brach. „Geh und kehre zurück. Ich werde hier auf dich warten."
Siegfried zog die Zügel an, Grane wieherte erneut, dann setzte sich das Pferd in Bewegung. Es trabte zunächst, dann galoppierte es, hinab vom Felsen, den schmalen, steilen Pfad, der sich zwischen den Klippen hindurchwand.
Brünnhilde stand am Rand des Felsens und sah ihm nach. Sie sah, wie Siegfried kleiner und kleiner wurde, wie er schließlich zwischen den Bäumen verschwand, die am Fuß des Berges wuchsen. Sie hob die Hand zum Abschied, obwohl er sie nicht mehr sehen konnte.
„Kehre zurück", flüsterte sie. „Bitte, kehre zurück."
Dann war er fort. Nur der Wind war noch da, und die Vögel, und die Stille eines Felsens, der plötzlich unendlich leer wirkte.
Brünnhilde wandte sich um und ging zurück in die Höhle. Ihre Schritte waren langsam, schwer. Das Licht, das vorhin noch so warm geleuchtet hatte, schien nun gedämpft, als hätte auch es etwas von seiner Lebendigkeit verloren.
Sie setzte sich auf eine steinerne Bank, die in den Fels gehauen war. Ihre Hände lagen im Schoß, leer nun, ohne den Ring, den sie so lange getragen hatte.
„Er wird zurückkommen", sagte sie laut zu sich selbst. „Er muss zurückkommen."
Aber tief in ihrem Herzen, dort wo die Überreste ihrer göttlichen Weisheit noch flackerten, regte sich eine dunkle Vorahnung. Sie sah Bilder, verschwommen und unklar: Siegfried, umgeben von fremden Gesichtern. Ein Becher, der gereicht wurde. Lachen, das falsch klang. Und dann... Dunkelheit.
„Nein", flüsterte sie und schüttelte heftig den Kopf. „Nein. Das sind nur Ängste. Nichts weiter."
Aber die Bilder wollten nicht weichen.
Draußen stieg die Sonne weiter. Der Tag wurde hell und warm. Doch auf dem Felsen, in der einsamen Höhle, saß eine Frau und wartete, und mit jeder Minute, die verging, wuchs die Last auf ihrem Herzen.
Kapitel 3: Die Halle am Rhein
Weit im Westen, wo die Berge sanft in die Ebene übergingen und das Land sich öffnete wie eine ausgebreitete Hand, da floss der Rhein. Mächtig und breit wälzte er seine Wasser nach Norden, ein silbernes Band, das sich durch grüne Auen und fruchtbare Felder schlängelte. Sein Rauschen war wie ein ewiger Gesang, ein Lied, das älter war als die Menschen, älter vielleicht sogar als die Götter selbst.
Am Ufer dieses Stromes, auf einer leichten Anhöhe, die gerade hoch genug war, um bei Hochwasser sicher zu sein, stand die Halle der Gibichungen.
Es war ein gewaltiger Bau, errichtet aus mächtigen Eichenstämmen, die von Generationen längst vergangener Handwerker behauen und zusammengefügt worden waren. Das Dach war hoch und steil, gedeckt mit Schindeln aus dunklem Holz, die im Lauf der Jahre eine silbergraue Patina angenommen hatten. An den Giebelenden waren kunstvolle Schnitzereien angebracht: Drachenköpfe, die zum Himmel starrten, Runen, die Schutz und Segen verheißen sollten, und verschlungene Muster, in denen sich Ranken und Tiere zu einem endlosen Ornament verbanden.
Die Halle war lang und breit genug, um hundert Krieger zu beherbergen. Ihre Wände waren dick und solide, gebaut, um Wind und Wetter zu trotzen, aber auch Angriffen von Feinden standzuhalten. Denn dies war eine kriegerische Zeit, eine Zeit, in der Frieden nur eine kurze Pause zwischen zwei Schlachten bedeutete.
Rund um die Halle erstreckten sich weitere Gebäude: Stallungen für die Pferde, Vorratsschuppen, Gesindehäuser, Waffenkammern. Eine niedrige Palisade umschloss das gesamte Anwesen, nicht stark genug, um eine ernsthafte Belagerung abzuwehren, aber ausreichend, um wilde Tiere fernzuhalten und Überfälle zu erschweren. Wachtürme an den Ecken ermöglichten es, die Umgebung zu überschauen und nahende Besucher – ob Freunde oder Feinde – frühzeitig zu erkennen.
Es war früher Morgen, und die Sonne stand noch tief am Himmel, tauchte alles in ein goldenes, schräges Licht. Rauch stieg aus den Öffnungen im Dach der Halle, wo die Feuer brannten, die niemals erlöschen durften. Der Geruch von Holzrauch und gebratenem Fleisch hing in der Luft, vermischt mit dem würzigen Duft von frisch gebrautem Bier und dem feuchten, erdigen Geruch des Flusses.
Männer und Frauen bewegten sich durch das Anwesen, gingen ihren morgendlichen Verrichtungen nach. Knechte führten Pferde zu den Stallungen, Mägde trugen Wassereimer vom Brunnen, Wachen wechselten auf den Türmen ihre Posten. Es war das alltägliche Leben einer großen Hofhaltung, ein Rhythmus, der sich seit Jahrhunderten kaum verändert hatte.
Im Inneren der Halle jedoch, dort wo das Licht der Fackeln und des großen Herdfeuers die Dunkelheit zurückdrängte, herrschte eine eigentümliche Spannung.
Die Halle selbst war ein beeindruckender Raum. Die hohe Decke wurde von gewaltigen Balken getragen, die so dick waren, dass drei Männer sie kaum hätten umfassen können. An den Wänden hingen Schilde und Waffen, Trophäen vergangener Schlachten, Geweihe erlegter Hirsche, Banner, deren Farben im Rauch der Jahre verblasst waren. Lange Tische standen in Reihen, flankiert von Bänken, an denen bei Festgelagen die Gefolgschaft des Herrn saß und aß und trank und die alten Lieder sang.
Am oberen Ende der Halle, auf einer leicht erhöhten Plattform, stand der Hochsitz des Königs. Er war aus dunkler Eiche geschnitzt, mit Armstützen, die in Wolfsköpfe ausliefen, und einer hohen Rückenlehne, in die das Wappen der Gibichungen eingraviert war: ein stilisierter Eber, wild und stark, bereit zum Angriff.
Auf diesem Hochsitz saß Gunther.
Er war ein Mann in seinen besten Jahren, vielleicht dreißig Sommer alt, mit dem Körperbau eines Kriegers: breitschultrig, muskulös, groß gewachsen. Sein Gesicht war kantig und scharf geschnitten, mit hohen Wangenknochen und einer geraden, aristokratischen Nase. Die Augen waren dunkelbraun, fast schwarz, und in ihnen lag ein rastloser Ausdruck, eine Unzufriedenheit, die selbst in Momenten der Ruhe nicht ganz zu verbergen war.
Sein Haar war dunkelblond und reichte ihm bis auf die Schultern. Er trug es offen, nur von einem schmalen Stirnreif aus Bronze zurückgehalten, der sein königliches Amt symbolisierte. Sein Bart war kurz und gepflegt, was ihm ein gepflegtes, fast vornehmes Aussehen verlieh.