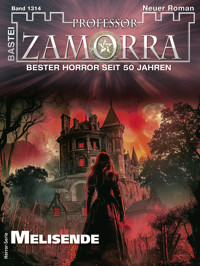1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Viele Jahrhunderte hatte sie geschlafen. Nun war sie erwacht, doch um sie herum war nichts als Dunkelheit. Ihr Körper schien völlig taub zu sein, sie fühlte nichts und war wie gelähmt. Dann wurde ihr bewusst, dass sie unter der Erde lag. Ihr Fleisch war verbrannt, nur die Knochen waren übrig - und ihr Geist. Doch die Befreiung war nahe, sie konnte es deutlich spüren. Sie brauchte Blut, und sie würde es bekommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Personenliste
Unter Einfluss
Leserseite
Vorschau
Impressum
Die Hauptpersonen des Romans sind:
Professor Zamorra: Der Meister des Übersinnlichen; Besitzer von Château Montagne
Nicole Duval: seine Lebens- und Kampfgefährtin
Julius Gaius Caesar: römischer Staatsmann, Feldherr und Autor
Vercingetorix: gallisch-keltischer Fürst
Erin:
Unter Einfluss
von Michael Schauer
Viele Jahrhunderte hatte sie geschlafen. Nun war sie erwacht, doch um sie herum war nichts als Dunkelheit. Ihr Körper schien völlig taub zu sein, sie fühlte nichts und war wie gelähmt. Dann wurde ihr bewusst, dass sie unter der Erde lag. Ihr Fleisch war verbrannt, nur ihre Knochen waren übrig – und ihr Geist. Doch die Befreiung war nahe, sie konnte es deutlich spüren. Sie brauchte Blut, und sie würde es bekommen ...
Gallien, 52 v. Chr.
Der kühle Wind, der an diesem grauen, von Wolken verhangenen Morgen mit seinem lichten Haar spielte, war ein nur allzu deutlicher Vorbote des nahenden Herbstes. Julius Gaius Caesar fröstelte und zog seinen roten Mantel enger um sich. Auf der Stadtmauer von Alesia waren um diese frühe Tageszeit nur wenige Verteidiger unterwegs. Sie sprachen miteinander oder lehnten an der Brüstung und starrten ins Leere. Sicher grübelten sie darüber nach, ob sie einen Sieg erringen oder bald tot sein würden, vermutete Caesar. Angesichts ihrer Lage erschien ihm das mehr als naheliegend.
Eine aus vier Männern bestehende Gruppe hatte ihn offenbar erkannt, denn sie deuteten hektisch in seine Richtung und riefen ihren Kameraden etwas zu. Sie waren zu weit entfernt, als dass er ihre Worte hätte verstehen können, doch der Tonfall klang nicht gerade freundlich. Der Größte von ihnen zog sein Schwert und drohte damit in seine Richtung. Als auch die anderen ihn bemerkten, erhob sich ein wütendes Geschrei.
Dumme gallische Barbaren, dachte Caesar, wobei ein abschätziges Lächeln seine dünnen, blassen Lippen umspielte. Die Distanz war zu groß, als dass sie ihn mit einem Pfeil oder einem Speer hätten treffen können. Außerdem waren da die beiden Soldaten, die sich rechts und links neben ihm postiert hatten. Beim kleinsten Anzeichen einer Bedrohung würden sie sich mit ihren schweren Schilden vor ihren Feldherrn werfen. Was hier und jetzt aber nicht notwendig werden würde.
Beinahe zärtlich strich er über das hölzerne Geländer des Belagerungsturms. Roms Legionäre hatten den Ruf, Außergewöhnliches vollbringen zu können, doch mit ihren jüngsten Bauwerken hatten sie sich selbst übertroffen. Sechzigtausend Mann hatten in nur wenigen Tagen die fast elf Meilen lange innere Schanze aus Erdwällen, Gräben, Türmen und Zäunen errichtet, die Alesia praktisch vollkommen einschloss. Und das war nur die kleinere Glanztat.
Bis jetzt hatte Vercingetorix, der letzte verbliebene Anführer der Aufständischen, den römischen Angriffen standgehalten. Mehr noch, seinem Cousin Vercassivellaunus war mit seiner Kavallerie der Durchbruch durch ihre Reihen gelungen. Sie waren davongeritten, um Verstärkung zu holen. Caesar wusste, dass in diesem Moment zweihundertfünfzigtausend weitere gallische Krieger auf dem Weg nach Alesia waren.
Zusammen mit den achtzigtausend Eingeschlossenen hätten sie seinen Legionen durchaus gefährlich werden können, und das nicht nur wegen der zahlenmäßigen Überlegenheit. Zweifellos hatten sie vor, ihn von zwei Seiten anzugreifen. Also hatte er einen zweiten Schanzring bauen lassen, der den ersten umgab und sogar mehr als fünfzehn Meilen lang war. Seine Soldaten würden zwar trotzdem an beiden Fronten kämpfen müssen, sobald Vercingetorix' Entsatzheer eintraf. Doch die Ringe würden sie schützen.
Seine Feinde hatten keine Chance. Er war ihnen überlegen. Schon allein deshalb, weil er ein Römer war. Davon war er fest überzeugt.
Sein Blick fiel auf den breiten Streifen zwischen der Alesia umgebenden Mauer und seinem inneren Belagerungsring. Dort unten lagen die Leichen der Unglücklichen im Gras, die in den vergangenen Tagen elendig gestorben waren. Es waren Hunderte, wenn nicht Tausende, ausschließlich Frauen, Kinder, Alte und Kranke. Vercingetorix hatte sie aus der Siedlung gejagt, weil seine Vorräte rapide schwanden und er jedes Stück Brot, jeden Fetzen Fleisch und jeden Krug Bier für seine Krieger brauchte. Caesar hatte sich gefragt, ob sein Gegner geglaubt hatte, dass er diese Menschen durch seine Reihen ziehen lassen oder sie sogar aufnehmen und verpflegen würde.
Er hatte weder das eine noch das andere getan.
Die Stadtmauer hinter sich und die feindlichen Soldaten vor sich, waren einige von ihnen so verzweifelt gewesen, dass sie versucht hatten, der tödlichen Umklammerung zu entkommen. Halb wahnsinnig vor Hunger und Durst, waren sie auf die Legionäre zugestürmt, in der verrückten Hoffnung, sich an ihnen vorbeidrängen zu können. Die meisten hatten sich an deren scharfen Speeren selbst aufgespießt, die übrigen waren mit Schwertern niedergehauen worden.
Immer noch besser, als langsam zu krepieren, hatte Marcus Antonius, einer seiner fähigsten Kommandeure, die blutigen Szenen kommentiert.
Dem hatte Caesar nur zustimmen können. Marcus hatte eine bestechende Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Eine weitere von vielen Eigenschaften, die er an ihm schätzte.
Insgeheim musste er sich eingestehen, dass er erleichtert gewesen war, als die Schreie der Sterbenden endlich verstummten, und er fragte sich, was der Grund dafür sein mochte. Wurde er mit seinen achtundvierzig Jahren allmählich sentimental? Oder gar weich? Er schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu verscheuchen. Es gab noch genug Schlachten, die geschlagen werden mussten, da konnte er sich solche weibischen Gefühle nicht leisten.
Wortlos wandte er sich ab und ging zur Leiter, um ins Lager hinabzusteigen, gefolgt von den beiden Legionären. Heute Morgen wollte er in seinem Zelt an seinen Aufzeichnungen weiterarbeiten. Vom gallischen Krieg würde das Werk heißen und noch von seinen Siegen künden, wenn er längst diese Welt verlassen hatte.
Sein bislang größter Sieg stand kurz bevor. Alesia und damit Gallien würde fallen. Schon bald.
Heute.
Lily Bonnet drückte Noah Lefleurs Hand fester. »Komm schon«, flüsterte sie und beschleunigte ihre Schritte.
Noah erwiderte nichts, gehorchte ihr aber. Ein Lächeln stahl sich um Lilys Lippen, als sie über die nächtliche Ausgrabungsstätte von Alesia eilten. Der Himmel war wolkenlos, der fast volle Mond tauchte das Gelände in sein fahles Licht. Rechts von ihnen erhob sich die gewaltige, beinahe sieben Meter hohe Kupferstatue des gallischen Feldherrn Vercingetorix, der an diesem Ort vor über zweitausend Jahren seine bitterste und zugleich endgültige Niederlage erlitten hatte.
Als Geschichtsstudentin war Lily von der Statue und der Geschichte des Mannes fasziniert, und bei der Exkursion heute Mittag hatte sie kaum den Blick von der mächtigen Figur mit dem großen Schnauzbart und den fast schulterlangen Haaren abwenden können.
Doch jetzt hatte sie etwas anderes im Sinn. Etwas ganz anderes.
Noah war ihr aufgefallen, als sie mit den anderen Studenten aus ihrem Kurs durch die Überreste der alten Stadt geschlendert war. Er stammte aus Nancy, wie sie inzwischen wusste, und wie sie studierte er Geschichte und hielt sich im Rahmen eines von seiner Universität organisierten Ausflugs in Alesia auf. Sein kurzes, rabenschwarzes Haar war verstrubbelt und stand in allen Richtungen vom Kopf ab. Er war nicht besonders groß, hatte aber einen muskulösen Körper und ein fein geschnittenes Gesicht. Am meisten faszinierten sie seine wasserblauen Augen.
Lily war eine Frau, die sich nahm, was sie haben wollte. Und so hatte sie keinen Moment gezögert und ihn angesprochen, als er gerade die Überreste eines Theaters inspizierte. Mit seinen dreiundzwanzig Jahren war er ein Jahr älter als sie, jedoch deutlich schüchterner. Während Lily keine Scheu hatte, auf fremde Menschen zuzugehen und sie anzusprechen, hatte er kaum ein Wort herausgebracht und sie nur angestarrt. Dafür hatte sie wie ein Wasserfall geredet.
Was nichts war, was Lily nicht gewohnt gewesen wäre. Bei ihrem Anblick waren schon viele Männer ins Stottern geraten. Für eine Frau war sie sehr groß, fast einsachtzig. Das braune Haar fiel ihr in Wellen bis über die schmalen Schultern. Die hohen Wangenknochen, die vollen Lippen und die nussbraunen Augen verliehen ihr ein überaus attraktives Aussehen, wobei die auffällig dichten Augenbrauen für eine besonders interessante Note sorgten. Wo sie auftauchte, zog sie die Blicke des anderen Geschlechts auf sich. Wer es wagte, sie nicht sofort zu beachten, der hatte von Vornherein bei ihr verspielt.
Nachdem sie sich Noah ausführlich vorgestellt hatte und er, verlegen stockend und mit leicht gerötetem Gesicht, ihr das Wichtigste über sich erzählt hatte – Alter, Wohnort, Studiengang –, war sie ganz nah an ihn herangetreten und hatte ihm ihre nächsten Worte ins Ohr geflüstert. Wobei sie sich darüber im Klaren gewesen war, dass dabei ihr Atem seine Haut streifte, was ihm mit Sicherheit die Knie weich werden ließ. So war es nämlich fast immer, und sie hatte diese Methode inzwischen perfektioniert.
»Ich würde dich gerne näher kennenlernen«, hatte sie gesagt, ganz frei heraus und unverblümt, wie es ihre Art war. »Wollen wir uns heute Abend treffen?«
Daraufhin hatte er erstmal Luft holen müssen. »Wir?«
Das hatte sie zum Kichern gebracht. »Genau. Du und ich. Ist gerade sonst keiner in der Nähe, oder?«
»Natürlich. Wie dumm von mir. Und wo?«
Darüber hatte sie kurz nachdenken müssen. Der Ort Alise-Sainte Reine mit seinen kaum sechshundert Einwohnern hatte außer einer Pizzeria, dem Hotel, in dem sie mit ihren Kommilitonen untergebracht war, und der Ausgrabungsstätte selbst nichts zu bieten.
Der Gedanke war plötzlich in ihrem Kopf gewesen.
»Wie wäre es mit hier?«
Seine Augen hatten sich geweitet. »Hier? Du meinst ... in den Ruinen?«
»Warum nicht?«
»Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist«, hatte er mit gesenkter Stimme erwidert und sich dabei umgesehen, als planten sie gerade eine geheime Verschwörung.
Sie hatte mit ihrem verführerischsten Lächeln gekontert. »Tust du immer nur das, was erlaubt ist?«
Die verheißungsvolle Betonung dieser Worte und der Blick, dem sie ihm dabei zugeworfen hatte, hatten ihn überzeugt.
Jetzt war es neun Uhr. Vor knapp zwanzig Minuten hatten sie sich am Museum getroffen und waren kurz darauf aufgebrochen. Bis zur Vercingetorix-Statue waren es knapp zwei Kilometer und von dort etwa hundert Meter bis zur Ausgrabungsstätte. Sie mussten also einen kleinen Spaziergang machen, doch das hatte sie einkalkuliert. Vorfreude war bekanntlich die schönste Freude.
Während sie nebeneinander hergingen, zeigte sich Noah deutlich gesprächiger als bei ihrem ersten Treffen am Nachmittag. Wobei er seine Nervosität nicht völlig verbergen konnte, denn er verhaspelte sich ständig. Sie erfuhr, dass er ein begeisterter Angler war – was sie ziemlich langweilig fand – und beinahe täglich für seinen großen Traum, einmal am Ironman Hawaii teilzunehmen, trainierte. Das klang schon wesentlich spannender.
Als sie die Ruinen erreicht hatten, hielt Lily Ausschau nach einer geeigneten Stelle. Sie fand sie zwischen drei gut hüfthohen, U-förmig angeordneten Mauern, die einst zu einem Wohnhaus gehört haben mochten. Der Boden war mit Gras bedeckt und weich, wie sie feststellte, als sie in die Knie ging und ihn mit beiden Händen betastete. Eine perfekte Stelle.
»Komm«, hauchte sie und zog ihn zu sich hinab. Kaum saß er neben ihr, schlang sie ihre Arme um seinen Nacken und presste ihre Lippen auf seine. Sie spürte, dass er sich versteifte, aber anders, als sie sich das vorgestellt hatte. Sanft schob er sie von sich.
»Geht ... geht das nicht ein bisschen schnell?«, fragte er.
Sie lächelte ihn an. »Hör zu, Noah, du bist ein echt süßer Typ, sonst wäre ich jetzt nicht mit dir hier. Aber du wohnst in Nancy und ich in Paris, da liegen beinahe dreihundertfünfzig Kilometer dazwischen. Morgen fahre ich nach Hause. Wahrscheinlich werden wir uns nach heute Nacht nie mehr wiedersehen. Warum also warten?«
Ein Anflug von Enttäuschung huschte über sein Gesicht. Innerlich verdrehte Lily die Augen. Das kannte sie schon. Männer wollten immer gleich eine Beziehung mit ihr. Aber daran hatte sie kein Interesse, denn sie genoss ihre Freiheit. Für derlei war irgendwann später noch genug Zeit.
Noah schien beschlossen zu haben, dass der Spatz in der Hand besser war als die Taube auf dem Dach, denn er beugte sich vor und küsste sie, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Das gefiel ihr schon viel besser. Noch besser wurde es, als seine Hand unter ihre dünne Jacke wanderte und seine Finger nach ihren Brüsten tasteten.
Unter seinen forscher werdenden Küssen – diese Disziplin beherrschte er bravourös, wie sie erfreut feststellte – ließ sie sich langsam zu Boden sinken. Dabei stützte sie sich mit einer Hand an der Mauer neben ihr ab.
Ein scharfer Schmerz auf ihrer Handfläche.
»Verdammt«, entfuhr es ihr.
»Was ist los?«, fragte er, wobei er sie zum Glück weiter festhielt, sonst wäre sie mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeschlagen.
»Ich habe mich geschnitten.« Sie führte sich die verletzte Hand vor Augen. Die Wunde war selbst im Mondlicht nicht zu übersehen, sie zog sich vom Daumen bis knapp unter den kleinen Finger und begann in diesem Augenblick heftig zu bluten.
»Lass mal sehen«, verlangte er und nahm ihre Hand. »Das sieht übel aus. Es blutet wie verrückt.«
»Was war das nur?« Ihre Blicke tasteten über das Mauerwerk, während die ersten dunklen Tropfen im Gras landeten. Da, eine messerscharfe Kante, beinahe direkt vor ihrer Nase. Der Stein glänzte feucht von ihrem Blut.
Auch Noah hatte die Kante entdeckt. »Das sieht echt gefährlich aus. Ein Wunder, dass sich bis jetzt noch keiner verletzt hat. Sonst hätten sie da bestimmt etwas gemacht.«
»Das hilft mir gerade auch nicht weiter«, erwiderte sie, etwas heftiger, als sie beabsichtigt hatte. Sie starrte auf die Wunde, die schmerzhaft zu pulsieren begann. »Hast du ein Taschentuch oder so was? Ich blute wie sau. So eine blöde Scheiße.«
»Warte mal.«
Während Noah in seinen Taschen kramte, biss sich Lily auf die Lippen, Die Lust auf Sex war ihr schlagartig vergangen. Ihr war klar, dass ein Pflaster nicht ausreichen würde, um die Blutung zu stillen. Die Wunde musste genäht werden, der Schnitt war einfach zu tief. Das Gras unter ihr war bereits vollgeblutet. Was bedeutete, dass sie die Ambulanz rufen mussten.
Verfluchter Mist.
Zwischen ihren Beinen hatte sich eine kleine Lache gebildet, die im Mondlicht schwarz schimmerte. Plötzlich wurde ihr schwummerig, kalter Schweiß trat ihr auf die Stirn. Hoffentlich wurde sie nicht ohnmächtig. Das hätte ihr gerade noch gefehlt.
»Kein Taschentuch«, zischte Noah und begann, einen Streifen Stoff aus seinem weißen Hemd zu reißen, was sie trotz ihrer Übelkeit sehr beeindruckte. Vielleicht war er es wert, dass sie sich näher mit ihm beschäftigte. Dreihundertfünfzig Kilometer waren ja jetzt auch nicht die Welt.
Er wollte erneut nach ihrer Hand greifen, stockte aber in der Bewegung.
»Was ist los?«, wollte sie wissen.
»Das Gras raucht. Zwischen deinen Beinen.«
Sie senkte den Blick. Tatsächlich. Um die Stelle, an der ihr Blut auf und in den Boden tropfte, stiegen dünne Rauchfäden auf.
Ich wusste gar nicht, dass ich so heiß bin, schoss es ihr durch den Kopf, und beinahe hätte sie trotz der Schmerzen laut aufgelacht.
Der Rauch wurde dichter und begann im nächsten Moment in einem fahlen Blau zu leuchten. Nach wenigen Sekunden hatten sie die Schwaden eingehüllt, während sie Noah nicht einmal berührten. Als würde der Wind den Rauch in ihre Richtung wehen. Nur war es vollkommen windstill.
»Was ist das bloß?«, hörte sie Noah sagen.
Der Schmerz in ihrer Hand verschwand. Verblüfft stellte sie fest, dass sich die Wunde geschlossen hatte. Dann wurde alles schwarz.
Gallien, 52 v. Chr.
Das Gefühl von Verzweiflung war etwas Neues für Vercingetorix, und nun übermannte es ihn mit voller Wucht, während er von der Stadtmauer auf seine toten Krieger hinabblickte und über den Verlauf der zurückliegenden Schlacht grübelte. Das war alles, was ihm noch zu tun blieb. Darüber nachzudenken, wie er hatte scheitern können.
Als das Entsatzheer nach Wochen bangen Wartens endlich eingetroffen war, hatte er sofort einen Ausfall befohlen, um die Römer von zwei Seiten zu attackieren. Einem solchen Zangenangriff würden Caesars Legionen nicht standhalten können, davon war er vollkommen überzeugt gewesen.
Nun musste er sich eingestehen, dass er einem gewaltigen Irrtum erlegen war.
Den ersten Ansturm seiner Männer hatten die tückischen Fallen, die die Römer entlang der beiden Schanzringe errichtet hatten, zum Stocken gebracht. Vor allem die messerscharfen Fußangeln, die überall im hohen Gras versteckt waren, hatten ihren Zweck mehr als erfüllt – wenn man es aus der Sicht der Feinde sah. Sehr zum Leidwesen der Krieger, die in vollem Lauf hineingetreten waren und denen das Metall Fleisch und Sehnen durchbohrt hatte. Zudem hatten sich Hunderte von ihnen an den Pfählen aufgespießt, die schräg in den Boden getrieben worden waren. Wie eine tödliche Wand aus spitzen Zähnen.
Mit alldem hatte er gerechnet. Die Verluste waren schmerzhaft, aber unausweichlich gewesen.
Die nachfolgenden Gallier hatten die Wachtürme erreicht und Sturmleitern aufgestellt, die sie ohne Zögern hinaufgeeilt waren. Die Pfeile und Speere der Verteidiger waren wie ein mörderischer Platzregen auf sie niedergeprasselt und hatten Dutzende weiterer Männer in den Tod gerissen. Ihre Kameraden hatten derweil damit begonnen, die Tore der Schanzanlagen mit Rammböcken zu bearbeiten. Das donnernde Dröhnen, mit dem die eisenbewehrten Pfähle auf das Holz trafen, war über den Schlachtenlärm hinweg bis in die Stadt zu hören gewesen.
Doch die römischen Soldaten hatten ihren wilden Angriffen getrotzt. Schließlich war ihre germanische Reiterei vorgeprescht und wie ein Sturm zwischen die bereits erschöpften Männer des Entsatzheeres gefahren. Die Krieger waren geflohen, nur um sich kurz darauf wieder zu sammeln, denn ihre Kundschafter hatten eine Schwachstelle im Verteidigungsring ausgemacht. Schon waren die ersten von ihnen durchgebrochen, und Vercingetorix hatte seine Aufregung kaum zügeln können. In den Moment schien ihm der Sieg zum Greifen nahe.
Dann jedoch war Caesar höchstpersönlich auf dem Schlachtfeld erschienen, unverkennbar an seinem purpurfarbenen Mantel. Vercingetorix hatte ihn zwar sehen, seine Worte jedoch nicht verstehen können. Was immer er seinen Soldaten zugerufen hatte, es hatte ihnen neuen Mut eingeflößt, denn sie hatten ihre Kräfte verdoppelt. Und während die Gallier staunend den römischen Befehlshaber angestarrt hatten, mussten sich feindliche Truppen in ihren Rücken geschlichen haben. Nur so war es zu erklären, dass sie plötzlich wie aus dem Nichts hinter ihnen aufgetaucht waren.
Das war der Anfang vom Ende gewesen.
Die Männer des Entsatzheeres hatten ihre Waffen fallen gelassen und waren erneut geflohen, diesmal endgültig. Was den Römern Gelegenheit gegeben hatte, sich voll und ganz den entsetzten Verteidigern von Alesia zu widmen.
Vercingetorix hatte den Befehl zum Rückzug gegeben. Er hatte genug Kämpfe bestritten, um eine Niederlage zu erkennen, wenn sie sich anbahnte, und es war nicht seine Art, sinnlos gallisches Blut zu vergießen.
Drei Stunden waren seitdem vergangen. Inzwischen war die Dämmerung angebrochen. Die Dunkelheit begann langsam ihren gnädigen Mantel über die Leichenberge zu seinen Füßen auszubreiten. Raben landeten dort krächzend, um sich an den Toten zu laben.