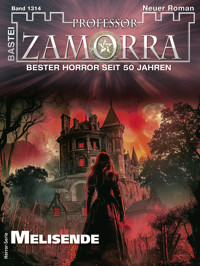1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zamorra hat es schon immer geahnt: Das Kellerlabyrinth unter dem Château Montagne birgt jahrhundertealte Geheimnisse. Und die sollte man besser ruhen lassen - es sei denn, sie kommen von selbst ans Tageslicht gekrochen ...
-Tief unten stoßen drei Arbeiter auf ein gefangen gehaltenes Mädchen.
-Was passiert, wenn ein Horror-Autor mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert wird?
-Woher kommt der Junge, der plötzlich im Kellerlabyrinth des Châteaus auftaucht?
-Das ist nicht tot, was ewig liegt - erst wenn ein Witz das Dunkle Herz besiegt! Wetten?
-Und selbst eine kleine Klettertour kann ganz schnell zum Verhängnis werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Katakomben des Schreckens
Vorschau
Impressum
Katakomben des Schreckens
von Adrian Doyle, Stefan Hensch, Christian Schwarz, Michael Schauer und Thilo Schwichtenberg
Zamorra hat es schon immer geahnt: Das Kellerlabyrinth unter dem Château Montagne birgt jahrhundertealte Geheimnisse. Und die sollte man besser ruhen lassen – es sei denn, sie kommen von selbst ans Tageslicht gekrochen ...
– Tief unten stoßen drei Arbeiter auf ein gefangen gehaltenes Mädchen.
– Was passiert, wenn ein Horror-Autor mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert wird?
– Woher kommt der Junge, der plötzlich im Kellerlabyrinth des Châteaus auftaucht?
– Das ist nicht tot, was ewig liegt – erst wenn ein Witz das Dunkle Herz besiegt! Wetten?
– Und selbst eine kleine Klettertour kann ganz schnell zum Verhängnis werden.
1. Ein Flüstern
Adrian Doyle
»Bonjour, mon Capitaine!«
Zamorra genoss die launige Begrüßung, mit der sich Nicole auf ihn rollte und damit die dünne Zudecke ergänzte, unter der er geschlafen hatte. Die Hitze der letzten Tage erlaubte nicht mehr. Jetzt, am frühen Morgen, allerdings lag die Lufttemperatur noch so weit unter der Körpertemperatur, dass die Wärme, die Nicole durch den Stoff auf ihn übertrug, eine Wohltat war.
»Ich liebe es, so geweckt zu werden«, murmelte Zamorra. »Was steht noch auf dem Programm?«
»Oh, da hätte ich einiges anzubieten«, gurrte sie ihm ins Ohr.
Bevor sie ihm ein konkretes Angebot machen konnte, summte das Visofon auf dem Nachttisch und das ins Aschfahle tendierende Gesicht von Butler William erschien auf dem Display. »Ich bin untröstlich ...« Er rang sichtlich um Fassung. »Aber ...«
»Aber?«, fragte Nicole, als die Stimme von Raffael Bois' Nachfolger ins Stocken geriet.
William, der längst ebenso eine Institution auf Château Montagne geworden war wie sein Vorgänger, haspelte: »Nun, ich habe meinen üblichen Kontrollgang im Keller getätigt, die Weinbestände kontrolliert, die ...«
»Ja, ja«, unterbrach ihn Nicole, weniger aus Ungeduld als um es dem betagten Butler zu ersparen, sich in unnötigen Details zu verlieren. »Und was hat Sie da so erschreckt?«
Ein tiefer Seufzer löste sich aus Williams Brust. »Nicht was«, antwortete er schleppend. »Wer wäre die korrekte Formulierung.«
Bei diesen Worten rückten einige der aktuell auf dem Schloss beheimateten Personen ins Visier seiner Zuhörer.
Erstmals schaltete sich nun auch Zamorra in das Gespräch ein. »Jemand hat Ihnen einen Streich gespielt, William? Auf Anhieb fallen mir da Henry oder Lucia ein. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden. Es kann nicht angehen ...«
»Nein!«, fiel der Butler ihm ins Wort. »Die beiden sind unschuldig – ausnahmsweise. Ich hätte Sie bestimmt auch nicht damit belästigt, aber so wie es sich tatsächlich verhält, kann ich eine akute Gefährdung von uns ... von uns allen nicht ausschließen.«
»Werden Sie bitte konkret«, verlangte Zamorra.
William holte tief Luft, ehe er antwortete: »Ich hatte einen Zusammenstoß in den Gewölben – und dabei den Eindruck, dass ich die Person fast mehr erschreckte, als sie mich. Nichtsdestotrotz gibt es keine Erklärung für ihre Anwesenheit. Es sei denn, sie wäre noch spätnachts und ganz ohne mein Wissen angekommen und von Ihnen, Monsieur, eingelassen worden. Weshalb sie sich dann aber im Keller herumtreibt und noch dazu in einem so verwahrlosten Zustand ...«
»Himmel, William, von wem reden Sie?« Nicole legte jegliche Zurückhaltung ab. »Haben Sie einen Eindringling gestellt? Jemanden, der die M-Abwehr überwunden hat und Übles plant?« Kopfschüttelnd fügte sie hinzu: »In einem solchen Fall würde ich aber meinen, dass Sie fast noch zu wenig schockiert wirken.«
Der Butler nickte. »Ja. Nein ...« Seine anhaltende Verunsicherung gipfelte in dem Eingeständnis: »Mir ist der Junge definitiv unbekannt. Aber er wirkte nicht wie ein Attentäter, sondern eher wie jemand, der ... nun, der Hilfe braucht.«
»Junge? Reden wir von einem Kind?« Nicht nur Nicole horchte auf.
William verneinte. »Eher einem Halbwüchsigen. Ich schätze ihn auf vierzehn, fünfzehn Jahre. Wie ich schon sagte, er ist völlig verwahrlost, voller Schmutz, die Kleidung besteht nur aus Lumpen und ...«
»Aber es ist nicht Thierry?« Die plötzliche Schärfe in ihrer Stimme verriet, wie sehr das ungeklärte Verschwinden des kleinen Thierry Bouchard aus Saint-Cyriac ihr auch nach Monaten noch zu schaffen machte. Thierrys Eltern waren in dem unterhalb des Châteaus gelegenen Dorf ermordet worden und er der einzige Überlebende gewesen. Sie hatten sich seiner angenommen ... annehmen wollen, aber dazu war es nicht gekommen, weil er unter mysteriösen Umständen verschwunden war. Es hatte noch einmal ein Lebenszeichen von ihm gegeben, im Schlossgarten, aber auch die Spur war im Sand verlaufen.
»Nein. Der Junge ist älter. Andere Statur. Andere ... Augen. Dieser Blick, als er mich ansah ...« William kniff kurz die Augen zusammen, als müsste er sich von der Erinnerung, die ihm zusetzte, befreien.
»Wo ist er jetzt?«
Der Butler nickte. »Genau das ist es. Ich wünschte, ich hätte ihn festhalten können. Aber er war nicht zu bändigen, riss sich los, nachdem ich ihn schon am Schlafittchen gepackt hatte, und konnte vor mir flüchten!«
»Wohin? In die Stollen?«
William verneinte. »Er muss irgendwo im Schloss sein, sich versteckt haben. Das Erste, als ich oben ankam, war, die Türen zu überprüfen, die ins Freie führen. Sie waren noch verschlossen, wie immer um diese Uhrzeit. Er muss also noch im Gebäude sein, irgendwo.«
»Möglicherweise hat er ein Fenster genutzt, um ...«
»Auch das habe ich kontrolliert.« William schüttelte den Kopf. »Es bleibt dabei: Wir haben einen Blinden Passagier an Bord. Und er scheint auf der Flucht zu sein, von wo auch immer er kam!«
Vergangenheit
»Wie lange n-noch, Oheim?« Mathis wälzte die Zunge im Mund wie ein Stück abgestorbenes Holz. »Wie lange müssen wir noch g-graben, Steine schleppen ... um ... um eine Pause betteln? Wann dürfen wir endlich wieder ... schlafen?«
»Still, Junge, still! Nicht reden!«, zischte sein Mutterbruder ihm zu und blickte gehetzt dorthin, wo ihr Aufpasser stand; einer der mitleidlosen Schergen, deren Gebein im Dunkeln glomm, als würde es in einem abseitigen Feuer brennen. Derweil ertönte aus den Nebengängen das nie verstummendes Hämmern und Poltern der Sklaven, immer wieder von deren Schmerzensschreien durchbrochen. So viele geschundene Männer, Frauen und Kinder, die das Los von Mathis und seinem Onkel teilten, dem Bergfried mit bloßen Händen oder primitivem Werkzeug zu Leibe rücken mussten und dabei immer neue Stollen in die Eingeweide des Berges trieben, beginnend unter der trutzigen Burg des Tyrannen, die hoch über Tal und Fluss thronte wie das Gestalt gewordene Verhängnis.
Mathis konnte seit seiner Verschleppung nicht mehr zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Wie viele Tage vergangen waren, seit die Knochenreiter in ihrem Weiler aufgetaucht waren, hätte er nicht zu sagen vermocht. Aber die entsetzlichen Bilder waren ihm noch allgegenwärtig. Wer nicht fliehen konnte, war in Eisen geschlagen und hinauf zur Dunklen Feste getrieben worden. Kaum dort angekommen, war Mathis von Vater und Mutter und allen Geschwistern getrennt worden. Nur sein Mutterbruder Reignier war in denselben Stollen geschickt worden wie er. Darüber, wer von der Familie sonst noch lebte, konnte er nur rätseln.
Er stöhnte auf, weil der Hunger wie ein eingesperrtes Tier in seinen Gedärmen wühlte. Sein früheres Leben drohte wieder in den Nebeln des Vergessens zu versinken, die sich um Geist und Gemüt gelegt hatten.
Sein früheres Leben ... Beim Gedanken daran wurde ihm weh ums Herz. Für einen Moment huschten vertraute Gesichter an ihm vorbei, und ihm wurde klar, dass er erst jetzt, da er alles verloren hatte, begriff, wie gesegnet sein Leben gewesen war, bevor die Reiter gekommen waren. Bilder von sonnengefluteten Wiesen und Äckern kämpften sich durch das Vergessen zu ihm vor; Erinnerungen an Heuernten oder wie er mit seinem jüngeren Bruder Gernot die Schafe der Familie gehütet hatte. Die Geschichten, die die Alten am Feuer erzählten, das Gelächter, die Tränen ... je nachdem, was gerade erzählt wurde.
Auch daheim hatte es Mühsal und Sorgen gegeben, aber niemals diese erstickende Furcht, wie sie in den labyrinthischen Stollen herrschte. Die jedem Atemzug innewohnte, jedem Schlag seines pumpenden Herzens.
Ohne seinen Oheim hätte sich Mathis nicht so lange auf den Beinen halten können, wie es der Fall war. Aber mit jeder Stunde fiel es ihm schwerer, einen Sinn in dieser Standhaftigkeit zu erkennen. Warum weiterschuften, wenn am Ende als »Lohn« nicht die Freiheit winkte, sondern nur das elende Sterben durch die Hand der Knöchernen, von denen just in diesem Moment prompt einer auf den Wortwechsel zwischen Reignier und Mathis aufmerksam geworden war und sich ihnen näherte. Die Flammenpeitsche in der einen, das Kurzschwert in der anderen skelettierten Faust war klar, was folgen würde. In Mathis krümmte sich bereits in Erwartung der Bestrafung alles zusammen. Allzu oft hatte er beobachten müssen, wie andere ausgepeitscht worden waren, nicht selten mit tödlichen Folgen.
Als das wandelnde Gerippe sie fast erreicht hatte, warf der Oheim seine Hacke von sich und schob sich ohne ein Wort der Erklärung zwischen den Untoten und Mathis.
»Nicht den Jungen!« Reignier hob abwehrend die blutig geschundenen Hände und wiederholte: »Nicht den Jungen! Strafe mich! Ich bin schuld, dass er für einen Moment abgelenkt war ... ich!«
Mathis wollte protestieren und hinter seinem Mutterbruder hervortreten, seinerseits ihn in Schutz nehmen. Auch wenn ihm das Herz bis in den Hals schlug; auch wenn er mehr Angst vor den sengenden Hieben des Unheimlichen hatte als vor irgendetwas sonst.
Aber der Skelettierte war schneller. Mit donnerndem Knall schnellten die Schnüre seiner Peitsche auf Oheim Reignier zu und begnügten sich nicht damit, ihm Striemen zuzufügen, die seine Haut wie Risse zerklüfteten, sondern saugten sich an ihm fest, als wären es die Tentakel eines Meeresungeheuers. Und während der Mann unter den Kräften, die zwischen ihm und dem über die Stränge mit ihm verbundenen Aufseher hin und her liefen, als wären es zum Bersten mit Blut gefüllte Adern, zappelte, wurde Mathis klar, dass es genau das war: Blut. Blut, das seinem Mutterbruder entzogen wurde, als ... als würde dessen Körper wie die Zitze eines Tieres gemolken. Wie unter Kontraktionen erzitterten die prallen Schnüre, und dort, wo sie in den Schaft der Peitsche mündeten, sah es aus, als ergössen sich Fontänen über die Knochenfaust des Schinders; Lebenssaft, der verdampfte und sich als Nebel um das Gebein legte, gerade so, als versuche etwas, daraus eine Ahnung jenes Fleisches zu modellieren, das der Untote vor langer Zeit in seinem Grab an die Maden und Würmer verloren hatte; das Grab, dem er, von abseitigem Zauber beseelt, schließlich wieder entstiegen war, nachdem ihm – so erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand – ein zweites »Leben« geschenkt worden war.
»Neeeeiiinn!«, schrie Mathis, weil sich alles in ihm sträubte, das Opfer, das sein Oheim offenbar auf sich zu nehmen bereit war, zu akzeptieren. »Hör auf, d-du böses Ding ...!«
Augenblicklich erstarben die Bewegungen seines Mutterbruders. Erstarben die Kontraktionen der Peitschenschnüre, die gleichzeitig ihre Transparenz einbüßten, sich schmatzend vom Körper des Mannes lösten und zu ihrem Besitzer zurückschnellten, als wären sie aus Gummi, das sich zu beliebiger Länge dehnen konnte. Wieder in der Faust des Skelettwächters angekommen, waren die Stränge nicht länger als eine Elle und baumelten wie morastige Grashalme vom hölzernen Schaft, den der Unhold umklammert hielt.
Derweil richtete sich der Glutblick des Totenschädels auf Mathis und die Totenfratze formte ein grausames Grinsen. Als der fleischlose Arm dann ausholte, um nun Mathis die gleiche Strafe zuteilwerden zu lassen wie seinem Oheim, wollte der Knabe davonrennen und sein Heil in der Flucht (Flucht wohin?) suchen. Aber bevor er seine Absicht in die Tat umsetzen konnte, lähmte ihn das, was mit Reignier geschah.
Die gebrochenen Augen des Mannes verrieten, dass er die Attacke des Wächters nicht überlebt hatte. Augen, die Mathis im Widerschein, der von dem »brennenden« Schinder ausging, um Vergebung zu bitten schienen, weil sein Opfer letztlich sinnlos gewesen war. Sein Schutzbefohlener hatte ebenso wenig Gnade zu erwarten wie er selbst.
Mathis war geschockt vom Tod seines letztverbliebenen Vertrauten – aber das allein bannte ihn nicht auf die Stelle. Vielmehr war es das, was sich Reigniers unmittelbar nach dessen Ableben bemächtigte. Und was Mathis daran zweifeln ließ, all die Stunden und Tage seit seiner Gefangenschaft lediglich auf totes Gestein eingehackt und dem Berg die Fortsetzung des begonnenen Stollenarms abgerungen zu haben. Denn dort, wo sein Oheim hingesunken war, schien der Fels seine Härte und Festigkeit zu verlieren, ganz weich und nachgiebig zu werden, sodass der ausgemergelte Leichnam darin wie in Wasser eintauchte und binnen eines Atemzugs, den Mathis tat, ohne dass er überhaupt merkte, wie er entsetzt Luft holte ...
... spurlos im Boden verschwand.
Kaum war der Tote versunken, kehrte mit bloßem Auge erkennbar die ursprüngliche Beschaffenheit des Bodens zurück.
Als hätte der Fels ihn verschlungen. Mathis schauderte zusammen. Gefressen. Wie ein Tier, das es gewohnt ist, seine Beute nicht selbst zu erlegen, sondern sich von dem zu nähren, was andere ihm hinterlassen. Aas ...
Der von ihm angestellte Vergleich brachte Mathis abermals zum Erschaudern. Und vielleicht war es dieses Schaudern, das ihm half, das unsichtbare Korsett, in das seine überbordende Angst ihn presste, zu sprengen, die Starre, die ihn befallen hatte, abzuschütteln.
In dem Moment, als der Knochenwächter nun auch ihm die tückischen Stränge seiner Waffe entgegenschleuderte, warf er sich gedankenschnell zu Boden, rollte sich in Richtung des Schrecklichen ab und kam fast neben ihm aus der Bewegung heraus wieder zum Stehen. Kurz spielte er dabei mit dem Gedanken, den Versuch zu unternehmen, dem Untoten das Werkzeug zu entreißen, mit dem er, je nach Belieben, Marter oder Tod austeilte. Aber dann obsiegte die Vernunft, und statt länger zu verharren, setzte er seine panische Flucht fort, folgte seinen Instinkten und Reflexen und nichts sonst in die einzige Richtung, die ihm offenstand, weil hinter ihm der Stollen endete, noch nicht weitergetrieben war.
Mathis reduzierte sein Denken einzig auf das Lenken seiner Schritte. Er schlug Haken, wie er es von Hasen kannte, die damit selbst bedeutend schnelleren Verfolgern zu entkommen im Stande waren. Hier unten im Stollen beschränkten sich diese Manöver jedoch auf engsten Raum und hatten einzig den Zweck, den Peitschenschnüren zu entkommen, die den ersten Fehlversuch ebenso wenig hinnehmen wollten wie der Knöcherne, der sie Mathis hinterherschickte.
Rechterhand schlugen sie an der Stelle, von der er sich gerade mit beiden Händen abgestoßen hatte, um zur anderen Seite zu gelangen, gegen den Fels und ließen Funken sprühen, die den Stein, auf den sie trafen, wie Kohle in einer Esse aufglühen ließen.