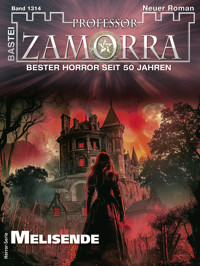1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Der Dämon war uralt, und seine Stunde war gekommen. In Millionen von Jahren hatte er mit seinen Feinden unzählige Kämpfe ausgetragen, nur um ihnen am Ende doch zu unterliegen. Schwer verwundet hatte er sich auf die Erde zurückgezogen.
Nun lag er im feuchten Dunkel einer Höhle, von nichts als Felsen und tiefster Schwärze umgeben. Er fühlte sich schwach und müde. Von fern hörte er das Rauschen der Wellen, die sich unablässig an den Klippen brachen. Mit einem letzten Seufzer schloss er seine faltigen Lider. Und starb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Dämonen-Inferno
Leserseite
Vorschau
Impressum
Dämonen-Inferno
von Michael Schauer
Der Dämon war uralt, und seine Stunde war gekommen. In Millionen von Jahren hatte er mit seinen Feinden unzählige Kämpfe ausgetragen, nur um ihnen am Ende doch zu unterliegen. Schwer verwundet hatte er sich auf die Erde zurückgezogen, einem noch jungen Planeten, der von drachenähnlichen Lebewesen bevölkert wurde, die über keinerlei Intelligenz zu verfügen schienen. Auf einem Eiland inmitten der gewaltigen Ozeane hatte er den Platz gefunden, an dem er in einen ewigen Schlaf fallen wollte ...
Nun lag er im feuchten Dunkel einer Höhle, von nichts als Felsen und tiefster Schwärze umgeben. Er fühlte sich schwach und müde. Von fern hörte er das Rauschen der Wellen, die sich unablässig an den Klippen brachen. Mit einem letzten Seufzer schloss er die faltigen Lider. Und starb.
Kapitän Liban hatte beinahe vergessen, wie sich das anfühlte. Das letzte Mal, dass er Angst gehabt hatte, lag viele Jahre zurück. Damals war er noch ein Kind gewesen, und die Furcht vor seinem Vater hatte Tag für Tag sein Herz umklammert wie eine eiskalte Hand. Der alte Boula war ein übellauniger und gewalttätiger Kerl gewesen. Wenn er nach der Arbeit auf den Feldern in ihre Hütte zurückkehrte, genügten ein falsches Wort oder eine unbedachte Bewegung, und er begann mit seinen klobigen Fäusten auf eines seiner drei Kinder oder seine Frau einzuschlagen, je nachdem, wer gerade in der Nähe war. Manchmal bedurfte es auch gar keines Anlasses.
Kurz nach seinem sechzehnten Geburtstag hatte Liban dem Alten die Kehle aufgeschlitzt. Damit hatten die Tage der Furcht geendet, und mit der Zeit war seine Erinnerung daran allmählich verblasst. Er war zu einem kräftigen und kampfeslustigen Mann herangewachsen, der keine Brutalität scheute und vor dem alle anderen zitterten. Er war Pirat geworden und musste nichts und niemanden mehr fürchten.
Der Anblick der Trireme jedoch hatte die Angst mit Macht zurückkehren lassen. Sein Magen krampfte sich zusammen, und seine Blase schien zum Bersten voll zu sein, obwohl er sich erst vor einer halben Stunde erleichtert hatte. Das römische Kampfschiff war äußerst wendig und vor allem schneller als ihre Galeere. Talbo, der Grieche mit den scharfen Augen, hatte es am Mittag entdeckt, als es kaum mehr als ein kleiner Punkt am Horizont gewesen war. Seitdem war es Stunde um Stunde näher gekommen. Noch bevor sich der Tag zu Ende neigte, würde es sie eingeholt haben.
Liban war klar, was das bedeutete. Seine Mannschaft war schlachtenerprobt und zu allem entschlossen, doch die Legionäre auf der Trireme waren ausgebildete Krieger und zudem in der Überzahl. Im Kampf gegen sie zu fallen, würde eine Gnade sein, denn was sie mit den Überlebenden anstellen würden, darüber wollte er lieber nicht nachdenken.
Aus dem Augenwinkel erhaschte er eine Bewegung. Samos, der riesige Nubier und sein engster Vertrauter, war neben ihn getreten. Seine schwarze Haut glänzte im Licht der Nachmittagssonne. Mit seiner gewaltigen Hand beschattete er die Augen, während er nach den Verfolgern Ausschau hielt.
»Verfluchter Pompeius«, murmelte er.
Pompeius war der Name des Feldherrn, der die Aufgabe übernommen hatte, das Mittelmeer von den Piraten zu säubern. Nach allem, was man sich in den Wirtshäusern erzählte, war er damit überaus erfolgreich. So sehr, dass Liban ernsthaft darüber nachgedacht hatte, das Seeräubertum an den Nagel zu hängen und sich in Kilikien eine neue Existenz aufzubauen. In den vergangenen Jahren hatten sie reichlich Beute gemacht, und er hatte genügend Gold übrig.
Dafür war es nun zu spät.
»Was machen wir, wenn sie uns eingeholt haben?«, fragte Samos.
»Kämpfen natürlich«, stieß Liban ohne sonderliche Überzeugung hervor. Die Schlacht würde kurz und blutig werden.
Samos leckte sich über die Lippen. »Ich habe gehört, wenn sich ein römischer Offizier in einer aussichtslosen Lage befindet und ihm nur der Tod bleibt, stürzt er sich in sein Schwert. Das gilt als ehrenvoll. Vielleicht sollten wir es genauso machen. Auf keinen Fall will ich mich von ihnen gefangen nehmen lassen.«
Liban nickte nur. Die Zunge schien ihm mit einem Mal am Gaumen zu kleben. Ohne dass es ihm bewusst war, hatte er die Finger um das raue Holz der Reling gekrallt und klammerte sich daran fest, als hinge sein Leben davon ab. Ein Splitter hatte sich tief in den Ballen unter dem rechten Daumen gebohrt. Trotz des stechenden Schmerzes konnte er einfach nicht loslassen.
»Kapitän!«, hörte er hinter sich Talbos meckernde Stimme. »Das musst du dir ansehen.«
»Was ist?«, fragte, ohne sich umzudrehen.
»Da ist Land. Direkt vor uns!«
Liban runzelte die Stirn. Hatte Talbo den Verstand verloren? In diesem Teil des Mittelmeers kannte er sich so gut aus wie in seiner eigenen Kajüte. Hier gab es weit und breit kein Land.
Mit grimmiger Miene schaute er sich nach Talbo um. »Was redest du da für einen ...«, polterte er los, aber weiter kam er nicht. Der Mund blieb ihm offen stehen. Seine Augen weiteten sich. Seine Hände lösten sich von der Reling, als er sich umwandte. Der Splitter blieb in der Haut stecken.
Das war nicht möglich.
Vor dem blauen Nachmittagshimmel erhob sich eine zerklüftete schwarze Felswand, die über hundert Fuß hoch und wenigstens dreihundert Schritte breit war. Unaufhörlich brachen sich die Wellen an dem dunklen Gestein.
»Tja, das hilft uns leider auch nicht weiter«, meinte Samos lapidar. »Es gibt keinen Strand, an dem wir anlegen könnten, und schau dir mal die Klippen an.«
Der Nubier hatte recht. Die vorgelagerten Felsen ragten wie scharfe Zähne aus dem Meer. Wenn sie ihnen zu nahe kamen, würden sie sich den Kiel aufschlitzen und damit den Römern die Arbeit abnehmen. Doch Liban hatte noch etwas anderes entdeckt, was seinem alten Freund offenbar entgangen war.
»Sieh mal, dort am östlichen Ende«, sagte er und deutete mit seinem rechten Zeigefinger in die Richtung. »Da ist ein Spalt in der Wand.«
Samos kniff die Augen zusammen, dann nickte er. »Du hast recht. Sieht ziemlich schmal aus.«
»Ja, er ist schmal, aber breit genug für uns. An der Stelle scheint es zudem nicht so viele Klippen zu geben, jedenfalls sehe ich kaum welche. Für die Trireme dagegen ist die Lücke zu eng. Da kommt sie niemals durch. Wir könnten es schaffen.«
»Du weißt nicht, was dahinter liegt.«
»Das Schicksal bietet uns eine Chance, Samos, also sollten wir zugreifen. Wenn wir erstmal durch sind, verlieren uns die Römer aus den Augen. Wir haben genug Vorräte, um eine ganze Weile dort auszuharren. Wenn ihnen das klar wird, geben sie vielleicht auf und verschwinden.«
»Glaubst du wirklich?«, hakte Samos nach, und an seinem Gesicht konnte Liban ablesen, dass er nicht überzeugt war.
»Es ist eine schwache Hoffnung, zugegeben. Allerdings haben wir wohl kaum eine Alternative.«
Mit einem entschlossenen Knurren löste er sich von seinem Platz und begann seinen Männern Befehle zuzubrüllen. Während sie auf ihre Posten eilten, schwor Liban bei seiner toten Mutter, dass er nach Kilikien gehen würde, wenn er lebend aus dieser Geschichte herauskam. Die Götter selbst mussten ihnen die Insel geschickt haben.
Obwohl es an der Stelle tatsächlich kaum Klippen gab, war es für den Steuermann eine Herausforderung, sie zu umfahren. Als sie den Spalt erreicht hatten, hielt Liban ein ums andere Mal den Atem an, denn immer wieder drohten sie von den Wellen gegen die Felswände geworfen zu werden. Nachdem sie es endlich geschafft hatten, stand ihm der Schweiß auf der Stirn.
Hinter dem Spalt lag eine enge Rinne, die sich zwischen den schwarzen Wänden hindurchschlängelte. Liban sah sich nach der Trireme um. Sie war ein weiteres Stück näher gekommen, schien jedoch langsamer geworden zu sein. Zweifellos war der Kommandant nicht erfreut darüber, dass sich seine sicher geglaubte Beute soeben seinem Zugriff entzogen hatte. Dann passierte das Piratenschiff eine Biegung, und die Verfolger gerieten aus Libans Blickfeld.
An Bord herrschte eine beinahe gespenstische Stille. Niemand sprach ein Wort. Nur das platschende Geräusch, mit dem die Ruder ins Wasser eintauchten, war zu hören. Der schmale Ausschnitt des Himmels über ihnen war jetzt nicht mehr blau, sondern grau. Je weiter sie vorankamen, desto stärker wurde in Liban das Gefühl, als würde ihm etwas die Luft abschnüren. Hier drin fühlte es sich eng und bedrückend an.
»Das verfluchte Eiland scheint nur aus Felswänden zu bestehen«, flüsterte Samos. Auch auf seiner Stirn perlte der Schweiß, dabei war es merklich kühler geworden.
Weiter und weiter glitten sie durch die schmale Rinne. Als Liban die Felswände genauer in Augenschein nahm, stellte er fest, dass sie tatsächlich schwarz wie Kohle waren. Manchmal kamen sie ihnen so nahe, dass er sie mit den Fingerspitzen hätte berühren können, doch er wagte es nicht, sie anzufassen. Der Splitter in seinem Handballen pulsierte schmerzhaft. Er wollte ihn gerade herausziehen, als Talbos Stimme die Stille durchbrach.
»Sackgasse!«, rief er.
Liban eilte zum Bug. Keine fünfzig Schritte vor ihnen endete die Rinne an einem grauen, schmalen Strand. Dahinter erhob sich eine weitere Felswand, die wie die anderen zu hoch und zu steil war, um sie erklimmen zu können. Am Fuß der Wand entdeckte er eine Öffnung. Sie war gerade so hoch und so breit, dass zwei Männer nebeneinander hindurchpassten.
»Eine Höhle«, murmelte er.
Auch Samos hatte sie bemerkt. »Ich weiß nicht, ob ich da reingehen möchte«, sagte er. »Ich werde nämlich das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmt.«
Liban kam nicht dazu, etwas zu erwidern, denn im nächsten Moment durchfuhr ein gewaltiger Ruck das Schiff und riss ihn von den Füßen. Mit den Händen voraus krachte er aufs Deck. Der Splitter in seinem Ballen brach ab. Blut floss aus der Wunde. Fluchend rappelte er sich auf.
»Wir sind auf Grund gelaufen, Kapitän«, meldete Talbot, der sich ebenfalls wieder auf die Beine mühte, überflüssigerweise.
»Wäre mir gar nicht aufgefallen«, knurrte er. »Los, wir gehen von Bord.«
Einer seiner Männer warf eine Leiter über die Reling, und dann kletterten sie nacheinander hinunter. Das Wasser war an dieser Stelle kaum fünf Fuß hoch. Schweigend wateten sie auf den Strand zu.
»Was machen wir jetzt?«, wollte Talbot wissen, als sie ihn erreicht hatten.
Liban fühlte sich plötzlich so unbehaglich, dass er am liebsten umgekehrt wäre. Grauen Sand hatte er noch nie gesehen. Als würde der Strand aus Asche bestehen.
Nur warteten da draußen die Römer auf sie.
Das Schicksal bietet uns eine Chance, also sollten wir zugreifen. Das waren seine eigenen Worte gewesen.
Beim Hades, was war nur los mit ihm? Zögerlich zu sein, war normalerweise nicht seine Art. Vielleicht wartete in der Höhle ein Schatz nur darauf, von ihnen entdeckt zu werden. Am Ende hatten die Götter ein Spiel mit ihnen gespielt, und in Wahrheit war heute ihr Glückstag.
Sie würden es herausfinden.
»Rixos, hast du die Fackeln dabei?«, wandte er sich an den hageren, einäugigen Piraten, dessen nackte Brust eine riesige rote Narbe zierte.
Zur Antwort nickte er und präsentierte ihm den Sack mit den Fackeln.
»Wir gehen rein«, verkündete Liban.
Sein Blick fand Samos. Der Nubier hatte die Lippen so fest zusammengepresst, dass sie einen Strich bildeten. Seine rechte Hand ruhte auf dem Griff seines Schwerts. Liban hatte noch nie gesehen, dass sich dieser Bär von einem Mann fürchtete. Heute schien es so weit zu sein.
Nachdem sie die Fackeln entzündet hatten, marschierten sie im Gänsemarsch in die Höhle. Liban ging natürlich voran, dicht gefolgt von dem Nubier. Je weiter sie vordrangen, desto niedriger wurde die Decke. Bald mussten die Größten unter ihnen den Kopf einziehen, um nicht dagegen zustoßen. Der Schein der Fackeln warf flackernde Schatten an die Wände.
»Scheiße, ich kriege Platzangst«, greinte einer der Männer.
»Schnauze halten«, polterte Liban.
Seltsamerweise konnte er das Rauschen des Meeres hören. Es wurde sogar lauter, je weiter sie kamen. Irgendwo musste es einen zweiten Zugang geben.
Er hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als der Gang hinter einer letzten Biegung in eine riesige Höhle mündete. Libans Schritte hallten von den Wänden wider, als er sie betrat. Die Höhle hatte eine kreisrunde Form und war so gewaltig, dass sie seinem Schiff wenigstens zehn Mal Platz geboten hätte. Zur Decke hin verjüngten sich die Wände zu einem Trichter, der in einer ebenfalls runden Öffnung endete, die etwa so groß wie ein Wagenrad war. Durch die Öffnung konnten sie den Himmel sehen. Daher also das Meeresrauschen.
Dann entdeckte Liban den Schädel. Er lag im Zentrum der Höhle auf einem Haufen grauen Sands. Schwarze Augenhöhlen starrten ihm entgegen. Beinahe hatte er das Gefühl, als habe ihn der Schädel erwartet und wollte ihn nun willkommen heißen.
Hinter ihm sogen mehrere Männer scharf die Luft ein.
»Bleibt zurück«, befahl er.
»Was hast du vor?«, flüsterte Samos.
Ohne zu antworten, ging er auf den Schädel zu. Die Form kam ihm seltsam vor. Nicht rund und gewölbt, wie bei einem Menschen, sondern eigenartig kantig. Auf der Schädeldecke prangte eine Art Dorn. So lang und dick wie sein kleiner Finger. Das vorspringende Kinn glich einer Speerspitze. Die Zähne waren die eines Raubtiers. Zwei Reihen kleiner scharfer Dolche.
Und noch etwas fiel ihm auf. Das Ding bestand nicht aus Knochen. Die Flamme seiner Fackel reflektierte darin.
Ein Diamant, durchfuhr es ihn. Der Schädel war in Wahrheit ein riesiger Diamant. Das erklärte auch die eigentümliche Form. Liban hatte schon eine Menge Edelsteine gesehen, aber nichts davon kam dem hier gleich. Er musste ein Vermögen wert sein.
Langsam ging er in die Hocke und streckte die Hand aus.
»Ich weiß nicht, ob ich das Ding anfassen würde«, hörte er Samos' Stimme. Er beachtete ihn nicht. Seine Hand schwebte über dem Schädel. Ein Tropfen Blut löste sich aus der Wunde, die der Splitter hinterlassen hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass seine Hand und der Saum seines Ärmels blutverschmiert waren.
Der Tropfen landete auf dem Dorn.
In den dunklen Augenhöhlen leuchteten zwei glühende kleine Punkte auf, doch Liban wich nicht zurück. Seine Fingerspitzen berührten den Schädel. Er fühlte sich eiskalt an.
Alles wurde rot.
»Schöne rote Farbe«, sagte Professor Zamorra, schwenkte das Weinglas und betrachtete im Schein der Kerze die Schlieren, die sich im Glas gebildet hatten. Dann setzte er es an die Lippen und probierte einen Schluck. Die intensive Farbe hatte nicht zu viel versprochen. Der Wein schmeckte köstlich.
»Gut, nicht?«, fragte Ethan Marcont, der ihm gegenübersaß.
»Gut ist kein Ausdruck«, erwiderte Zamorra und schnalzte mit der Zunge.
»Ich habe mir erlaubt, einen Rioja für dich zu ordern, während du auf der Toilette warst. Ist eine verdammte Schande, dass ich in Frankreich einen spanischen Wein bestelle, aber ich habe in jüngster Zeit einfach zu viele Enttäuschungen mit unseren einheimischen Winzern erlebt. Und teuer waren sie noch dazu. Die Weine, nicht die Winzer.«
Zamorra lächelte und trank einen weiteren Schluck. Er und sein alter Freund und Kollege saßen im Chez Pauline, dem einzigen Lokal im Dörfchen Beure vor den Toren von Besançon. Tische und Stühle bestanden ebenso wie der Tresen aus dunklem, schwerem Holz. An den weiß getünchten Wänden hingen Gemälte, die herbstliche Landschaften zeigten. Trotz der noch frühen Abendstunde war das Restaurant bis auf den letzten Platz belegt, was bedeutete, dass um die vierzig Menschen an den Tischen saßen. Trotzdem war es eigentümlich still, wenn man vom Klappern des Geschirrs und dem Klirren der Gläser absah. Zamorra war nicht entgangen, dass ihm einige der anderen Gäste hin und wieder verstohlene Blicke zuwarfen, wenn sie sich nicht gerade über ihre Teller beugten.
Ethans Anruf hatte ihn gestern Abend erreicht. Erst hatte Zamorra seine Stimme nicht erkannt, was ihm im Nachhinein ein wenig peinlich war. Wie viel Zeit war vergangen, seit sie sich zum letzten Mal begegnet waren? Das musste Jahre her sein. Wie es immer seine Art gewesen war, war Ethan dennoch ohne lange Vorreden sofort zur Sache gekommen und hatte ihn gebeten, ihn in Beure aufzusuchen. Es gäbe da etwas, was er unbedingt mit ihm bereden wolle. Da Zamorra in dieser Woche keine Verpflichtungen hatte, war er gleich heute Morgen aufgebrochen.
Rein äußerlich hatte sich Ethan, der ehemalige Professor der Psychologie, kaum verändert, wenn man davon absah, dass sein volles, einst blondes Haar grau geworden war. Seine schlanke Figur hatte er sich bewahrt, und seine blauen Augen wirkten wach wie eh und je.
Zum Leidwesen seiner Vorgesetzten an der Universität hatte er seine Professur vor zwei Jahren an den Nagel gehängt und war nach Beure in das kleine Haus gezogen, das er von seinen Eltern geerbt hatte, wie er Zamorra auf ihrem Weg ins Chez Pauline erzählt hatte. Jetzt lebte er von seinem Ersparten und erfüllte sich seinen lang gehegten Traum, ein Kinderbuch zu schreiben.
Die Nacht würde Zamorra in Ethans Gästezimmer verbringen. Seit seine Frau vor über zwanzig Jahren gestorben war, lebte er allein. Er hatte nicht mehr geheiratet und auch kein Interesse an einer neuen Beziehung.
Eine rothaarige Kellnerin trat an ihren Tisch und stellte zwei dampfende, mit Suppe gefüllte Teller vor ihnen ab. »Hier ist Ihre Bouillabaisse«, erklärte sie. »Frederic, das ist der Koch, und ich wünschen guten Appetit«.
Sie schenkte Zamorra ein Lächeln, bevor sie sich abwandte, um sich um die Gäste am Nebentisch zu kümmern.
»Ich hatte noch gar nichts bestellt«, staunte Zamorra, während er die Suppe begutachtete. Große Fischstücke schwammen in der roten Brühe.
»Auch das habe ich mir erlaubt, für dich auszusuchen«, klärte ihn Ethan auf. »Du musst sie unbedingt probieren. Das ist die beste Bouillabaisse des Landes, jedenfalls wenn du mich fragst.«
»Wurde sie aus spanischen Fischen gekocht?«
Er schüttelte den Kopf und grinste. »Was das Essen angeht, kann uns das übrige Europa nicht das Wasser reichen. Viele Dinge mögen sich ändern, aber manches bleibt zum Glück immer gleich.«
Ethan hatte nicht übertrieben, wie Zamorra nach dem ersten Löffel feststellte. Die Bouillabaisse gehörte zu den schmackhaftesten, die er je gegessen hatte.
»Es tut mir wirklich leid, dass wir uns so lange nicht gesehen haben«, sagte er.
Sein Gegenüber winkte ab. »So spielt das Leben, mein Freund. Menschen kommen zusammen und verlieren sich wieder. Wie Blätter, die im Wind umhergewirbelt werden, um es prosaisch auszudrücken. Du hattest bestimmt eine Menge zu tun.«
»Das würde ich in der Tat nicht abstreiten.«